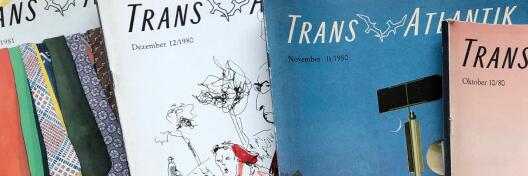Betreute Arbeiten
Niklas Gödde: Schreibweisen der Reeducation. Zu einer deutschsprachigen Literatur im Geist der US-amerikanischen Demokratie bei Lepman, Andersch, Lenz und Johnson (1945-1985)
Das Dissertationsvorhaben nimmt die US-amerikanische Demokratisierungspolitik ‚Reeducation‘ im Kontext der deutschsprachigen Literatur zwischen 1945 und 1985 in den Blick. Dabei geht es nicht zuletzt um literaturpolitische Maßnahmen und Programme der Reeducation und deren Inanspruchnahme im deutschen Literaturbetrieb der Nachkriegszeit. Das Interesse der Studie ist aber vorrangig literarischer Natur: Unter dem Schlagwort ‚Literatur der Reeducation‘ werden unikale Schreibweisen rekonstruiert mit denen – so die These – ausgewählte Texte und Autor*innen die semantischen, ästhetischen und ideengeschichtlichen Impulse von Reeducation und US-Demokratie literarisch verarbeiten und weiterentwickeln. Mit dieser neuen Perspektive auf die deutschsprachige Nachkriegsliteratur zwischen 1945 und 1985 gerät eine prägnante Konstellation in den Fokus: Im Mittelpunkt stehen literaturpolitische und ideengeschichtliche Einflüsse, deren literarische Produktivität und Transformation sowie eine komplexe, kritisch-affirmative Rezeptionslinie der USA und ihrer Demokratie. Vor dem Hintergrund einer literarhistorischen Re-Evaluierung der Reeducation kann zugleich auch ihre Neubewertung als ideengeschichtliche Triebkraft in der deutschen Nachkriegsgeschichte diskutiert werden.
Abgeschlossene Arbeiten
Eva Tanita Kraaz: Anthologien ins Deutsche übersetzter Schwarzer US-amerikanischer Lyrik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Mit dem wachsenden Interesse der germanistischen Literaturwissenschaft für die transnationalen Dimensionen ihrer Untersuchungsgegenstände gerät die ohnehin wankende Vorstellung der Germanistik als Nationalphilologie zunehmend ins Taumeln. Sehr effektiv trägt hierzu die Erforschung transatlantischer literarischer Bedingungen und Beziehungen von Großautoren wie z.B. Thomas Mann. Nicht weniger aufschlussreich für die Frage nach der inneren kulturellen Heterogenität deutschsprachiger Literaturen sind die transnationalen Verstrickungen von Protestliteraturen und Literaturen marginalisierter Autor*innen.
Das Promotionsprojekt beschäftigt sich mit den deutschsprachigen Übersetzungsanthologien Schwarzer US-amerikanischer Lyrik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, namentlich Anna Nussbaum: Afrika singt (Weimarer Republik 1929), Hanna Meuter, Paul Therstappen: Amerika singe auch ich (Weimarer Republik 1932), Stephan Hermlin: Auch ich bin Amerika (SBZ 1948) und Eva Hesse, Paridam von dem Knesebeck: Meine dunklen Hände (BRD 1953). Nimmt man Anthologien als „besonders wertvolle Quelle für die Rekonstruktion von Literaturgeschichte“ (Dietger Pforte) ernst, so lassen sich an den infragestehenden Übersetzungsanthologien in besonderer Dichte die historischen Ausformungen des Kulturtransfers Schwarzer US-amerikanischer Lyrik ins Deutsche für die Zeit vor und nach dem Nationalsozialismus anstellen. In der Kontextualisierung von Produktion und Rezeption mit der Materialität und paratextuelle Rahmung, Auswahl, Anordnung und Übersetzung der Anthologien werden die jeweiligen Vermittlungsstrategien entschlüsselt. Die so erkannten historischen transatlantischen Kontinuitäten und Diskrepanzen leisten einen Beitrag zur Erforschung der deutschsprachigen Rezeption und Adaption Schwarzer US-amerikanischer Literatur und Kultur im Spannungsfeld der oft missachteten deutschen Schwarzen Literatur und Kultur.
Cosima Mattner: Elective Affinities: Hannah Arendt’s and Susan Sontag’s Transatlantic Portraits
This dissertation traces transatlantic links between two of the most prominent women intellectuals of the twentieth century: Hannah Arendt and Susan Sontag. Building on substantial recent academic and public interest in both writers’ lives and works, the study substantiates anecdotally noted affinities between Arendt and Sontag through an archivally grounded exploration of analogies in their work and their genealogy. Zooming in on their respective portraits of Walter Benjamin, this project argues that Sontag and Arendt developed the portrait as a transatlantic genre of literary criticism through which they increasingly emancipated from academic towards more literary modes of writing. Thus, they not only challenged prevailing power hierarchies in the field of criticism (like the Frankfurt School’s editorial hegemony over Benjamin’s legacy) but also excelled in finding genuinely new answers to the question how to interpret literature – a question that preoccupied both writers in strikingly similar ways and remains contested terrain in contemporary (US and German) literary studies.
Die Arbeit ist mittlerweile erschienen unter dem Titel Citation and Tradition: Hannah Arendt’s and Susan Sontag’s Walter Benjamin Portraits.
Roman A. Seebeck: Transatlantische Mobilität. Thomas Mann und die amerikanische Vortragskultur
Das Projekt untersucht Thomas Manns vielfältiges Engagement als Vortragskünstler während dessen amerikanischer Lebensphase (1938–1952). Ziel ist eine umfangreiche kulturpoetische Rekonstruktion verschiedener ephemerer Vortragsszenarien, die der Komplexität dieses kulturellen Phänomens – dem Ensemble aus Räumen, Institutionen, Praktiken, Texten, Akteur*innen und (Medien)Techniken – Rechnung trägt. Dabei soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, inwiefern Thomas Manns intellektueller Annäherungsprozess an die Vereinigten Staaten durch sein konkretes Handeln ergänzt wurde und welchen Beitrag Thomas Manns Begegnung mit der amerikanischen Vortragskultur zu seiner amerikanisch geprägten Westbindung geleistet hat.