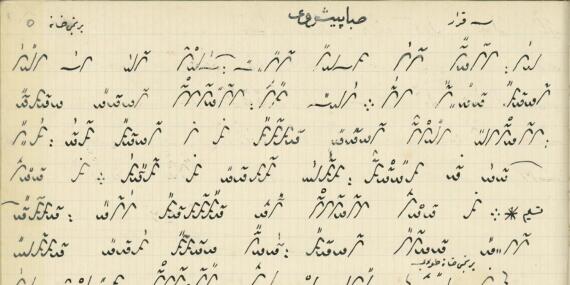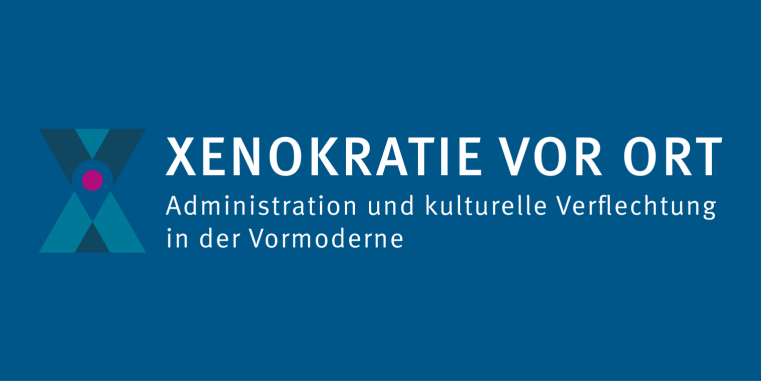Forschung am GKM: Aktuelle Förderzusagen
Die Liste der Forschungsprojekte der im GKM vernetzten Wissenschaftler/innen ist lang und vielfältig: Es ist eine Vielzahl von drittmittelgeförderten Forschungsvorhaben zu nennen, die zum Teil individuell, zum Teil in Arbeitsgruppen und teilweise auch in enger Kooperation mit in- und ausländischen Universitäts- und Forschungsinstitutionen durchgeführt werden. Darunter sind DFG-Langzeitprojekte, Akademienprojekte, zwei Emmy-Noether-Forschungsgruppen und eine Leibniz-Preis-Forschungsstelle. Einen Eindruck von den Forschungstätigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Sie hier:
Übersicht der Forschungsprojekte am GKM
In dem an der Universität Münster angesiedelten Exzellenzcluster Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne“ sind seit 2007 viele Forscherinnen und Forscher engagiert, die schon seit Jahren im GKM zusammenarbeiten. Das GKM bildet die Grundlage der altertumswissenschaftlichen Forschung und gibt dem Exzellenzcluster dadurch eine historische Tiefensicht.