









Die Arbeitsgemeinschaft Ökohydrologie und Biogeochemie gehört zum Institut für Landschaftsökologie (ILÖK) der Universität Münster.
Die Aufklärung von Wasser- und Stoffkreisläufen in Mooren und Oberflächengewässern steht im Mittelpunkt der international ausgerichteten Forschungen des Arbeitsbereiches. Zu diesem Zweck quantifizieren wir über hydrologische Ansätze Stoffflüsse und identifizieren und charakterisieren biogeochemische und geochemische Prozesse mit Hilfe chemisch-analytischer Methoden. Mathematische Simulationsmodelle und statististische Verfahren werden unterstützend eingesetzt um das Verhalten der untersuchten Systeme herauszuarbeiten. Das gewonnene Prozess- und Systemverständnis nutzen wir um die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf Moore und Oberflächengewässer auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Maßstäben abzuschätzen und zu prognostizieren.



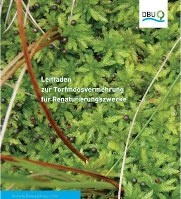
Bulttorfmoose sind von zentraler Bedeutung für das Ökosystem Hochmoor. Wie Untersuchungen zum Renaturierungserfolg zeigen, kommt es vielfach auch nach über 30 Jahren nicht zur Etablierung von Bulttorfmoosen. Als wesentliche Ursache hierfür ist Ausbreitungslimitierung infolge anthropogener Habitatfragmentierung sowie einer generell geringen Bedeutung der generativen Vermehrung bei Bulttorfmoosen zu nennen.
Das Institut für Landschaftsökologie hat in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Stiftung Lebensraum Moor und dem Substrathersteller Gramoflor GmbH & Co. KG, einen Leitfaden zur Vermehrung von Bulttorfmoosen für Renaturierungszwecke erstellt um diese gezielt in Renaturierungsflächen einbringen zu können. Im Rahmen des mit Mitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekts, wurden verschiedene Vermehrungsverfahren auf künstlich bewässerten Gewächshaustischen erprobt und beispielhaft ins Freiland übertragen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind jetzt in einem von Norbert Hölzel , Till Kleinebecker , Klaus-Holger Knorr , Peter Raabe und Gabriela Gramann erstellten Leitfaden erschienen. Dieser Leitfaden richtet sich vor allem an Akteure im Moorschutz und in der Hochmoorrenaturierung.
Weiterführende Links:
Stiftung Lebensraum Moor