Alexander von Humboldt-Professur
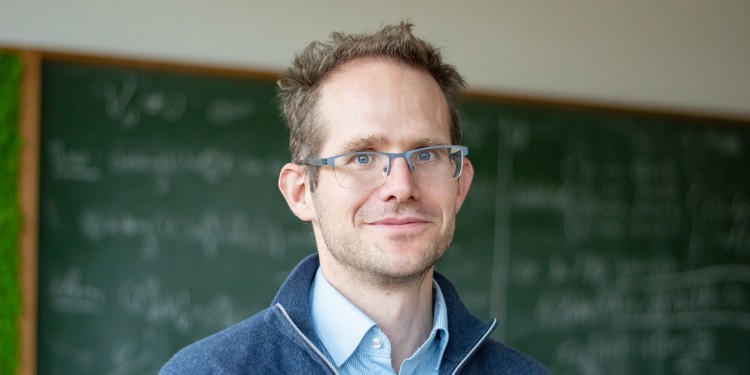
Die Alexander von Humboldt-Professur ist der höchstdotierte deutsche Wissenschaftspreis und ermöglicht bislang im Ausland tätigen Wissenschaftler*innen die Durchführung langfristiger zukunftsweisender Forschungen an einer Universität in Deutschland. Die Humboldt-Professuren werden von der Alexander von Humboldt-Stiftung verliehen und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Ziel ist es, langfristig zukunftsweisende Forschungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland zu ermöglichen und somit zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Forschungsstandortes Deutschland beizutragen. Aktuell forschen drei Humboldt-Professor*innen an der Universität Münster.
Die Humboldt Professur verschafft mir eine außergewöhnliche Freiheit, meine wissenschaftlichen Ziele verfolgen zu können. In Münster konnte ich so eine große internationale Gruppe mit breitem Forschungsspektrum in der Relativitätstheorie aufbauen und viele Gastwissenschaftler für längere Zeit nach Münster holen. Dies schafft eine besondere Dynamik, in der neue mathematische Ideen entstehen und verwirklicht werden können.
