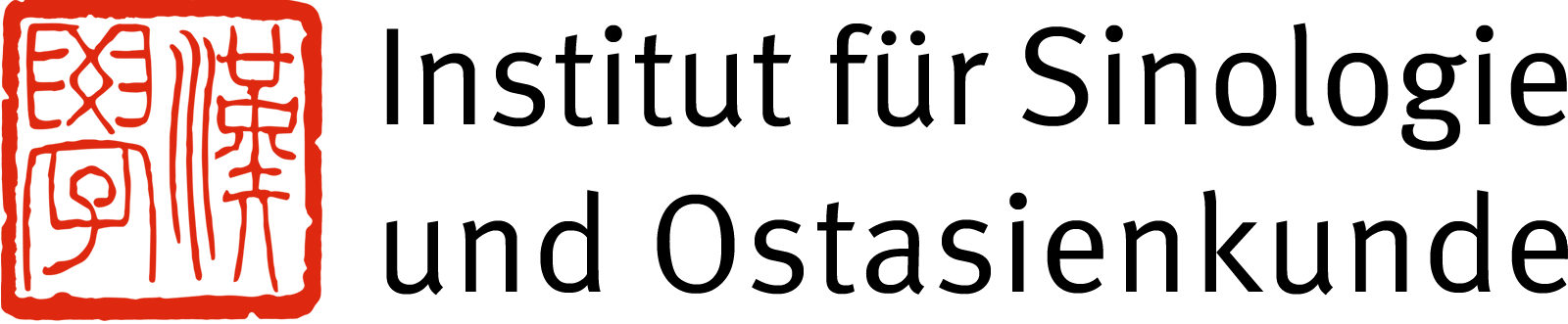PWE: Hello Ms. Zhuang, could you briefly introduce yourself and tell us what brought you to the institute? Also, could you share a bit about your role here and the kinds of courses or activities you are involved in?
ZXD: Yes! My name is Zhuang Xin-Di, and I am a student in the Teaching Chinese as a Second Language master’s program at NTU (National Taiwan University) and I currently work as a language teaching assistant at the Sinology Department at the University of Münster.
As a language teaching assistant, I support Dr. Gao Yue by reviewing and practicing the course content with students. I am involved in several courses: Tutorium Chinesisch, Modernes Chinesisch, and Sprachpraxis. In addition to my work at the university, I also teach AG courses in three secondary schools in Germany that are part of the “Jugend trifft China” project: the Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster, Gymnasium Dionysianum in Rheine, and Euregio Gesamtschule, also in Rheine.
One of the main reasons I chose this university and turned down two other job offers was the recommendation of the previous language assistant, Lee Hui-Yu, who is both my classmate and close friend. She encouraged me to come to Münster because she said, “It is a wonderful opportunity. The city is beautiful, the colleagues are very friendly, and the students are amazing.”
PWE: Teaching a language always involves cultural exchange. How do you integrate cultural aspects into your lessons, and how do students respond to learning about Chinese culture alongside the language?
ZXD: For example, we organized a Chinese New Year celebration for our AG groups here at the institute. We included several traditions from Taiwan, such as giving out red envelopes. And instead of real money, we filled them with chocolate money.
We also sat together at a round table as we would traditionally do in Taiwan, because it symbolizes a family reunion. We also handed out the red envelopes while teaching them auspicious phrases. In Taiwanese culture, when elders give you a red envelope, you’re expected to say something positive in return.
PWE: What have been some of the most rewarding moments in your teaching so far? Are there specific experiences or interactions with students that have stood out to you?
ZXD: One example is when I wrote some lucky words on each of those envelopes, and many students were curious about their meanings. They came to ask me questions, which led to some really engaging conversations. Moments like that make me feel a strong sense of achievement in my
teaching.
PWE: From your perspective as a native Chinese speaker and language assistant, what do you think are the biggest challenges German students face when learning Mandarin Chinese?
ZXD: I think the biggest challenges for German students are tones and characters. Many students underestimate their importance and their power. But a small change in the tones can completely change the meaning of a word, which can lead to funny misunderstandings.
For example, one typical sentence: “我想吻你⼀个问题” instead of “我想问你⼀个问题”. So instead of saying “I want to ask you a question,” they accidentally say “I want to kiss you a question.”
Characters are also a big challenge. Slight differences in how a character is written can completely change the word and its meaning. Many students overlook these small details and end up writing the wrong character. So, I would say tones and characters are the most common difficulties.
PWE: Before coming here, what were your expectations about living and working in Germany? How did you prepare yourself for this international teaching experience?
ZXD: Teaching Chinese abroad is very different from teaching in Taiwan. I tried to prepare as much as I could for teaching by gaining classroom experience and collecting useful teaching materials. Luckily, my landlord here provided a fully furnished flat. I didn’t have to worry about much in terms of daily life setup. I just packed a lot of instant noodles because I really need some hot food! In Taiwan, we love eating warm meals, so I brought those comforts from home with me.
PWE: Living abroad can be both exciting and challenging. How would you describe your overall experience living in Germany, both inside and outside of work? What cultural differences have surprised you the most?
ZXD: The courses are similar to what I have taught in Taiwan, and the workload is fine. The most challenging aspects for me are the weather and the food. In Taiwan, everything is super convenient. You can buy food anytime, anywhere. In Germany, if you want to eat well without spending a lot, you really have to cook for yourself. Eating out every day would be too expensive.
PWE: Finally, what advice would you give to other young professionals or students who are considering an international teaching assistantship or a similar experience abroad?
ZXD: Living abroad naturally always comes with unpredictable challenges and difficulties, so it is important to keep an open mind and be ready to embrace all kinds of possibilities. Treat every situation as a learning opportunity. Be curious about the local culture and do not be afraid to participate in any kind of activity, whether it is a party, a cultural event, or just hanging out with people. Try to make friends from all over the world. I think it will broaden your worldview.
Zhuang Xin-Di & Pia Wend-Erdel