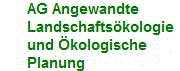Methodenworkshop: Sozialwissenschaftliche und ethnographische Methoden in der Landschaftsökologie
Der Methodenworkshop richtet sich an Studierende, die sich für ihre Abschlussarbeiten über sozialwissenschaftliche Forschungsverständnisse, Methoden, Arbeitsweisen und Themen austauschen möchten. Die Themen für die einzelnen Treffen werden nach Bedarf gemeinsam gewählt. Der Methodenworkshop richtet sich an Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen, er ist übercurricular und ergänzt das Studium der Landschaftsökologie durch Hinzufügung qualitativer Methoden und Ansätze.
Die Terminplanung für den Methodenworkshop im Wintersemester 2025/26 finden Sie hier.WS 2023/24 Seminar: Pflanzen, Tiere und ihre Rechte – Rechte der Natur
Die Würde der Natur gebietet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, zu pflegen und zu wahren und den Eigenwert der natürlichen Mitwelt im Ganzen der Natur zu achten.
So oder so ähnlich könnte eine Ergänzung des Grundgesetzes in § 1 lauten. Würde das etwas ändern am fortschreitenden Zerfall und der Übernutzung des Planeten Erde? Wären damit grundlegende Veränderungen im Sinne eines umfassenden Biodiversitäts- und Klimaschutzes leichter? Würde es auch eine andere Wirksamkeit von Geldströmen, Subventionen geben und gleichzeitig eine Ächtung Umweltzerstörenden Verhaltens bedeuten – inklusiver rechtlicher Konsequenzen?
Diesen Fragen widmet sich die Tagung: Rechte der Natur ins Grundgesetz, die vom ZIN mit dem Franz Hitze-Haus und dem ITZ ausgerichtet wird.
Zu dieser Tagung wird ein interdisziplinäres Seminar angeboten, das diese Tagung zum Kern hat und sie in eine Vor- und Nachbereitung einbindet. Nähere Informationen finden Sie auf der Ausschreibung.
Aktuell sind noch Plätze frei. Melden Sie sich bitte bei Prof. Dr. Tillmann Buttschardt.
Exkursion Ökolandbau Convergence 19.-22. Oktober 2023
Wir beschäftigen uns in der AG Ökoplanung mit den Besonderheiten und Gemeinsamkeiten von alternativen Formen das Landbaus. Hierzu haben wir eine eigene Forschungslinie, die der Agroökologie bei uns in der AG aufgebaut.
Wir wollen Sie einladen, im Rahmen des Moduls Exkursionen, an einem viertägigen Treffen in Steyerberg (einer intentionalen Gemeinschaft - Ökodorf) teilzunehmen, an dem in einem recht offenen Format Biolandbau und Permakultur zusammentreffen.
Mehr Informationen finden Sie in der Ausschreibung. Da es auswärts ist und Übernachtungen etc. anfallen, entstehen natürlich auch Kosten, die wir leider nicht von der Uni oder AG tragen können.
Paludikultur: Potenziale in NRW
Im Rahmen des Projektpraktikums im Modul M7 Landschaftsnutzung und -management werdern wechselnd praktische Aufgaben mit Stakehodern und Landnutzuenden gelöst und transformativ bearbeitet. Im Sommersemester 2023 bestand die Aufgabe darin, die Potentiale von Paludikulturen im Münsterland sowie ihren regionenübergreifenden Möglichkeiten darzustellen und Limitierungen aufzuzeigen. Entstanden ist eine Website, die den Facettenreichtum an Fragenstellungen, beginnend mit einer grundlegenden Einführung in die Paludikultur, der Ausweisung von theoretischen Flächenpotentialen, die Nutzung und Wertschöpfung dieser Form der Landwirtschaft, ihre ökologischen Vorteile und schließlich die tatsächliche Umsetzung in Verbindung mit unterschiedlichsten Stakeholdern. Das Webangebot soll als verhältnismäßig niedrigschwelliger Einstieg dienen und durch die oben genannten Aspekte einen generellen Überblick bieten. Die Website richtet sich an regionalpolitische Akteure und soll ebenfalls als Informationsquelle für Interessierte dienen.
Die Website finden sie hier.
Seminarreihe "Landnutzung Jenseits der Moderne"
Im Sommersemester 2022 startete eine dreiteilige Seminarserie. Sie besteht aus folgenden, inhaltlich aufeinander aufbauenden Teilen:
- Erster Teil: Geosphäre - Biosphäre - Noosphäre (Sommersemester 2022)
- Zweiter Teil: Agroökologie - Permakultur - Tiefe Ökologie (Wintersemester 22/23)
- Dritter Teil: Ethik - Religion - Spiritualität (Sommersemester 2023)
Die Reihe begann im Sommersemester 2022 mit einem dreigeteilten Blick auf das was ist und wie wir Materie, Leben und Geist erfassen, erleben, erdenken und abstrahieren. Sie setzte sich im Wintersemester 2022/23 fort mit einer Analyse ganzheitlicher Landnutzungssysteme mit ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten.
Schließlich wird es im dritten Teil (Sommersemester 2023) darum gehen, unser eigenes gestaltendes und ökologisches Selbst zu erfahren und Wege zu finden, wie wir zu einer "Regerativen Kultur" beitragen können.
Teil 3: Seminar "Ethik - Religion - Spiritualität" (Sommersemester 22/23)
Im nun folgenden dritten Teil gehen wir von der Überlegung aus, "dass die ökologische Wissenschaft alleine nicht geeignet ist, uns klare Verhaltensregeln für unseren Umgang mit der Natur zu geben" (A. Naess). Wir haben aufbauend auf vorhergehenden Seminare gelernt, dass wir unterschiedliche Erklärungs- und Erkenntniskonzepte für die Materie, lebende Systeme und die Verbindung vom Menschen zur mehr-als-menschlichen Welt benötigen. Wir haben ganzheitliche und regenerative Landnutzungskonzepte, wie die Agroökologie, Permakultur und Tiefe Ökologie näher betrachtet und deren Grundlagen vertieft angesehen. Sie alle haben bestimmte ethischen Grundlagen, Prinzipien oder Plattformen. Sie münden in eine "neue Sicht der Erde" oder "great turning" (J.Macy), den großen Wandel. Diese/r ist nötig, weil ja die sonst so erfolgreichen westlichen (Natur-)Wissenschaften uns als Gattung und unseren Planeten als globales Ökosystem in eine existenzielle Krise gestürzt haben, die in einer Disruption bzw. einem Kollaps enden könnte. "Wir müssen lernen die Welt besser und tiefer zu verstehen, um zu erkennen, was wir da tun" (H. Skolimowsky). Dieses Verständnis beginnt jedoch nicht im Außen, sondern beim Individuum, bei uns selbst. Ausgehend von der Frage, welche Haltung wir selbst gegenüber der Welt einnehmen, werden wir die anthropozentrische der holistischen Ethik gegenüberstellen. Die Trennung der Moderne, das Vorherrschen von Dominanzsystemen oder auch Materialismus und Transhumanismus verdienen eine vertiefte Betrachtung, um zu sehen, welche Möglichkeiten ein erweitertes Verständnis von Religion und Spiritualität für eine "Wieder-Verheiligung der Welt" (G. v. Lüpke) anbieten.Eine Anmeldung ist auch ohne Belegung möglich.Es ist geplant, das Seminar als Block in der vorlesungsfreien Zeit im Sommer stattfinden zu lassen. Ort: sicher schön; Essen: sicher gut und bio; Gruppe: sicher cool; Spaß: sicher groß. Eine Vorbesprechung ist Ende der Vorlesungszeit WS 2022/23 geplant.
Anfragen richten Sie bitte an Prof. Dr. Tillmann Buttschardt
Teil 2: Seminar "Agroökologie - Permakultur - Tiefe Ökologie" (Wintersemester 22/23)
Im zweiten Teil geht es darum, ganzheitliche Ansätze und Systeme der "Regenerativen Entwicklung" kennen zu lernen und ihre Interpretation der Dreiheit Geosphäre - Biosphäre - Noosphäre auszuloten. Im Semiar werden Hintergründe, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Agroökologie, Permakultur und Tiefen Ökologie herausgearbeitet und die drei Metakonzepte dahingehend diskutiert, welche Beiträge sie einerseits leisten können, um den großen Krisen des Anthropozäns zu begegnen und andererseits, welche konstruktiven Impulse von ihnen ausgehen könnte für die gesellschaftkliche Transformation insbesondere auch für das Agrar-Ernährungssytem.
Teil 1: Seminar "Geosphäre - Biosphäre - Noosphäre" (Sommersemester 2022).
Das Seminar verband Ideengeschichte, prägende Forscher*innenpersönlichkeiten mit ihren Ideen (sorry - oft Männer) und Wissenstheorie mit grundlegenden Deutungen in der Landschaftsökologie.
Ausgehend von der Frage nach dem Wesen der festen Materie und deren räumlicher Repräsentation auf dem Planeten Erde stellt sich die ganz grundsätzliche Frage an das "Stoffliche" und dessen Manifestation.
Bereits in der Mitte des vorletzten Jahrhunderts wurde der Begriff der Geosphäre von Wladimir Iwanowitsch Wernadski geprägt und beschäftigt die Geowissenschaften bis heute. Wir besprechen im Seminar methodologische, ontlogische und epistemologische Zugänge zu dieser Debatte und lenken unseren Blick auf die positivistischen Wissenschaftskonzepte. Der Klimawandel ist ja eine Kenngröße der geosphärisch ablaufenden Gegebenheiten. Nicht zuletzt diesen versuchen wir im Seminar besser einordnen zu können.Wesentlich schwieriger schon ist das Konzept der Biosphäre, setzt es doch voraus, dass wir das Leben an sich definitorisch fassen und in seiner allerletzten Dimension verstehen können. Der Verlust der Biodiversität als eines der ganz großen, die Welt und die Wissenschaft bewegenden Themen führt ja wirklich zu einem Rückgang der Lebensformen, der unwiederbringlich ist, auch wenn wir darauf hoffen, dass neuartige Technologien hier Abhilfe schaffen könnten. Das Konzept der Biospähre wurde von Eduard Suess in seinem Buch zur Entstehung der Alpen (also einem geoshärischen Befund) eingeführt und ist daher ebenfalls schon ein Veteran unter den Konzepten. - Gleichwohl Bedeutung über die Fachwissenschaften hinaus erlangte er erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und durch die Gaia-Hypothese von Lynn Margulis und James Lovelock. Sie zeigen erstmals auf, dass mechanistische Konzepte (wie die vorherrschende Interpretation der COVID-19 Pandemie) viele Phänomene nicht ausreichend erklären können. Daher wurde im Seminar auch dem Ansatz der Phänomenologie hier ein Augenmerk geschenkt.
Schließlich die Noosphäre: Hier wird es spannend! Ausgangspunkt ist die Kontroverse zwischen Wernadski und Teilhard de Chardin. Letzterer vertrat die Ansicht dass auf eine gewisse Art ein "überindividuelles Erkenntnis-Netzwerk" bestehe, das er als "Noosphäre" interpretierte. Im Gegensatz zu Wernadsky setzte er also eine weitere (spirituelle) Ebene zu jener, die Wernadsky "nur als die Ebene des Geistes" beschrieb hinzu. Die sich hier anschließende Frage lautete: Mit welcher Wissenschaftstheorie kann diese Frage am besten analysiert und verstanden werden? Eignet sich der Konstruktivismus oder ist die Quantenmechanik (die gar keine Mechnik ist!) besser geeignet?
Die Ausarbeitungen bildeten die Grundlagenliteratur für das Seminar "Agroökologie - Permakulur - Tiefe Ökologie" im Wintersemester 2022/23.
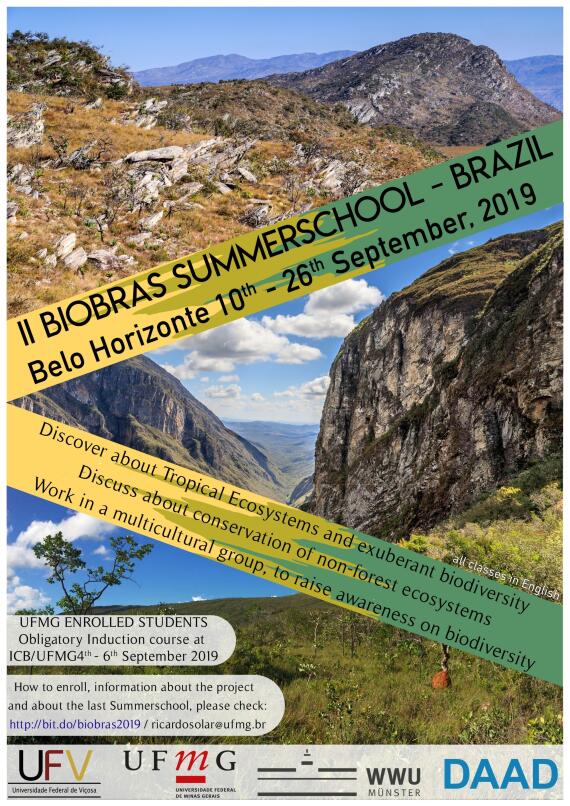
© R. Solar Internationale Sommerschulen in Deutschland und Brasilien
STAR Intensive Programme
Sommersemester 2014
Coordinated by Prof. Dr. Gabriele Schrüfer (University of Münster, Germany) this Intensive Programme is supported by our partners Fisun and Selahattin Aksit from the Erciyes University (Turkey) and Roser Badia and Miquel F. Oliver Trobat from the University of Balearic Islands (Spain). Partners from the coordinating university (University of Münster) include Tillmann Buttschardt, Gesine Hellberg-Rode, Armin Stein und Nina Brendel.
weblog
websiteDas innovative Lehrprojekt wurde vom DAAD gefördert.
Peak Oil Münster
Wintersemester 2012/13
Das Erdölzeitalter neigt sich unweigerlich dem Ende entgegen und aktueller denn je stellt sich die Frage nach der Abhängigkeit unserer Industriegesellschaft von so zentralen Ressourcen wie Öl. Gefragt sind lokale Antworten, die kreativ-gestaltend mit den globalen Herausforderungen umgehen und die Lebensqualität durch Ressourcenschonung steigern.
Das von Studierenden initiierte Forschungsprojekt im Wintersemester 2012/13 an der Uni Münster ist die Grundlage für den vorliegenden Peak-Oil-Bericht und ein hervorragender Anknüpfungspunkt für weitere Forschungs- und Anschlussprojekte. Sowohl in Münster, als auch NRW und ganz Deutschland. Es wurde von der deutschen UNESCO-Sektion als Einzelbeitrag zur Dekade zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet und stellt eine Methode der partizipativen, interdisziplinären und offenen Forschung dar, die weitergetragen werden möchte!
Peak Oil Bericht online lesen
website Peak Oil MünsterIn der Zeitschrift 'entgrenzt - studentische Zeitschrift für Geograhisches' ist ein Artikel von Jörn Hamacher über das Peak-Oil Seminar erschienen. Er trägt den Titel: Wie transformativ ist die Geographie? und kann hier gelesen werden. Wer nur den Artikel und nicht das gesamte Heft lesen will kann den Artikel hier finden.
Innovative Lehre
der AG Angewandte Landschaftsökologie und Ökologische Planung