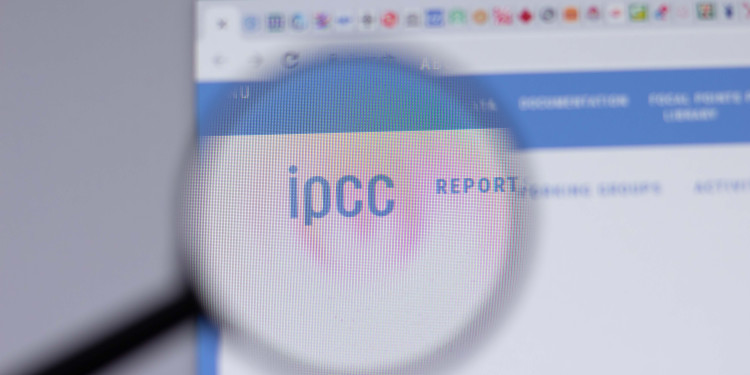
„Jede nicht emittierte Tonne Kohlenstoffdioxid zählt“
Prof. Dr. David De Vleeschouwer vom Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Münster ist Ende August zum Leitautor der Arbeitsgruppe I „The Physical Science Basis“ des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) berufen worden. Seit Januar 2022 hat er die Juniorprofessur für Erdsystemforschung an der Universität Münster inne. In den kommenden drei Jahren verantwortet er im siebten Sachstandsbericht des IPCC das Kapitel zu großräumigen Veränderungen im Klimasystem und deren Ursachen. Der IPCC ist ein Gremium der Vereinten Nationen, das den wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Klimawandel zusammenführt und politische Entscheidungen wissenschaftlich untermauert. Im Interview mit Kathrin Kottke schildert David De Vleeschouwer, was er von seiner Rolle erwartet und wie die Wissenschaft politische Entscheidungen beeinflusst.
Worum geht es im siebten Sachstandsbericht allgemein, und wofür sind Sie federführend verantwortlich?
Der siebte Sachstandsbericht fasst das weltweite Wissen zum Klimawandel zusammen – von den physikalischen und chemischen Grundlagen über beobachtete Veränderungen bis hin zu Projektionen und Szenarien für die Zukunft. Ich bin Leitautor des Kapitels, das sich mit großräumigen Veränderungen im Klimasystem und deren Ursachen befasst. In diese Arbeit fließt auch meine Forschung zu Klimaveränderungen in der Erdgeschichte ein. Solche Langzeitperspektiven helfen dabei, aktuelle Entwicklungen wie die Ozeanversauerung nicht nur für die nächsten zehn oder hundert Jahre, sondern auch auf deutlich längeren Zeitskalen besser einzuordnen und zu beurteilen.

Ich erwarte, dass der Bericht eine klare, robuste und für politische Entscheidungen verwertbare Zusammenfassung des aktuellen Wissens liefert. Als Paläoklimatologe ist es mir besonders wichtig, die heutige Entwicklung in einen erdgeschichtlichen Kontext zu stellen. Zwar gab es in der geologischen Vergangenheit natürliche Klimaänderungen, etwa während früherer Warmzeiten oder bei Massenaussterben. Doch die gegenwärtige, von uns Menschen Erwärmung verläuft deutlich schneller und mit bislang ungewohnter Intensität.
Was können wir aus der Vergangenheit denn in diesem Zusammenhang lernen?
Die Erdgeschichte zeigt, dass es im Erdsystem sogenannte Kipppunkte gibt. Ein Beispiel ist die atlantische Umwälzzirkulation, zu der auch der Golfstrom gehört. Dieses Strömungssystem wurde in den letzten Millionen Jahren mehrfach ein- und ausgeschaltet, meist ausgelöst durch große Schmelzwassermengen aus arktischen Eisschilden. Solche Beispiele aus der Vergangenheit verdeutlichen die Fragilität des Klimasystems und machen deutlich, wie einzigartig und dringlich der heutige Wandel ist. Ich hoffe, dass diese Langzeitperspektive die Verantwortlichen dabei unterstützt, Risiken besser einzuschätzen und angemessene politische Entscheidungen zu treffen, die die Folgen mindern.
Wie sieht Ihre konkrete Arbeit im IPCC aus?
Sie ist globale Teamarbeit: Mehrmals im Jahr treffen wir uns online zu fünf jeweils einwöchigen Schreibtreffen. Dazwischen erfolgen zahlreiche Abstimmungen, Textüberarbeitungen sowie die Sichtung und Beantwortung von hunderten bis tausenden Kommentaren in den sogenannten Review-Runden. Das bedeutet für mich in den kommenden Jahren einen erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand neben Forschung und Lehre an der Universität Münster. Zugleich ist es eine wichtige Gelegenheit, paläoklimatologisches Wissen einzubringen und im internationalen Austausch ein möglichst vollständiges Bild des Klimasystems zu erarbeiten.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Politik der Wissenschaft ausreichend zuhört und die Beratung auch annimmt – etwa zu Daten über Klimawandel, Folgen und Minderungsstrategien?
Es gibt nicht ‚die‘ Politik: Die Parteien und Regierungen gehen unterschiedlich mit dem Thema um. Einige setzen den Klimaschutz oben auf die Agenda, andere nicht. Zugleich haben viele Unternehmen und gesellschaftliche Akteure die Folgen anerkannt. Viele Energieversorger investieren in erneuerbare Energien, Versicherer berücksichtigen steigende Schäden durch Extremwetter und Unternehmen entwickeln klimafreundliche Technologien. Angesichts der Tragweite solcher Entscheidungen benötigen diese Akteure eine neutrale, wissenschaftlich fundierte Grundlage. Diese liefert der IPCC, unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Interessen.
Was erwarten Sie von der Politik im Umgang mit dem Klimawandel?
Ich hoffe, dass die Politik zwei Dinge entschlossen angeht: die Vermeidung von Treibhausgasemissionen und die Entfernung des bereits ausgestoßenen Kohlenstoffdioxids durch Negativemissionen. Jede Tonne, die nicht in der Atmosphäre ist, spart die späteren, teuren und unsicheren Entfernungsmaßnahmen. Entscheidend ist das Kohlenstoffdioxid-Budget, also die noch verbleibende Menge an Kohlenstoffdioxid, die wir ausstoßen dürfen, wenn wir die Ziele des 2015 abgeschlossenen ,Übereinkommens von Paris' erreichen wollen. Dieses Budget wird der IPCC genau quantifizieren. Von der Politik erwarte ich deshalb klare Regeln, ehrgeizige Minderungsziele sowie die Förderung und Regulierung von Technologien zur dauerhaften Bindung und Speicherung von CO₂, verbunden mit Transparenz, Monitoring und internationalen Standards. Nur wenn Minderung und sichere Kohlenstoffentnahme zusammengedacht werden, lassen sich die Risiken des Klimawandels wirksam begrenzen.
Infos zum IPCC
Das IPCC ist ein zwischenstaatliches Gremium der Vereinten Nationen, das vom „United Nations Environment Programme“ und der „World Meteorological Organization“ getragen wird und eine zentrale Rolle in der wissenschaftlichen Politikberatung zum globalen Klimawandel einnimmt. Für den siebten Sachstandsbericht hat das IPCC 664 Expertinnen und Experten aus 111 Ländern ernannt, die als koordinierende Hauptautoren, Leitautoren und Lektoren mitwirken sollen. Ihre Arbeit beginnt mit der Berufung und dauert bis zur Annahme der Arbeitsgruppenberichte, die für Mai 2028 vorgesehen ist. Anschließend wird ein Synthesebericht erarbeitet, der den gesamten Stand der Klimaforschung bündelt und Ende 2029 veröffentlicht werden soll. Dieser Bericht bildet die wissenschaftliche Grundlage für internationale Klimaverhandlungen und hat in der Vergangenheit Entscheidungen wie etwa das Pariser Abkommen und das Kyoto‑Protokoll maßgeblich beeinflusst.
