
Unbekanntes Wasser im Erdinneren
Wasser ist nicht nur lebensnotwendig, es ist auch ein faszinierendes und komplexes Molekül, das die Grundlage allen Lebens auf der Erde bildet. Im neuen „Centre for Molecular Water Science“, einem europäischen Forschungsnetzwerk, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den molekularen Eigenschaften des Wassers und seiner Verbindungen auf der Spur. Prof. Dr. Stephan Klemme und Prof. Dr. Carmen Sanchez Valle vom Institut für Mineralogie der Universität Münster sind Teil des Konsortiums. Sie wollen insbesondere Wasser in extremen Umgebungen des Erdinneren verstehen. „Wir kennen Wasser in seiner alltäglichen Form als Flüssigkeit, Gas oder Eis. In der Natur kommt Wasser aber noch in vielen anderen Phasen vor. Unter extremem Druck, wie er im Erdinneren herrscht, kann Wasser zu sogenannten überkritischen Fluiden werden“, erklärt Stephan Klemme. „Diese besonderen Formen von Wasser lösen Metallionen, was sie für die geologische und mineralogische Forschung besonders interessant macht.“
Ein Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es, die Löslichkeit von wertvollen Metallen wie Gold oder Seltenen Erden in überkritischen wässrigen Fluiden unter den hohen Druck- und Temperaturbedingungen des Erdinneren zu untersuchen. Seltene Erden sind für moderne Technologien unverzichtbar, sie finden Anwendung in Smartphones, Batterien für Elektroautos oder Windkraftanlagen. „Wir wollen verstehen, wie und wo diese Lagerstätten im Erdinneren entstehen“, betont Stephan Klemme. Viele dieser Metalle sind laut EU in ihrer Verfügbarkeit „kritisch“, vor allem angesichts der Dominanz Chinas auf dem Weltmarkt, wie eine Studie der Deutschen Rohstoffagentur feststellt.
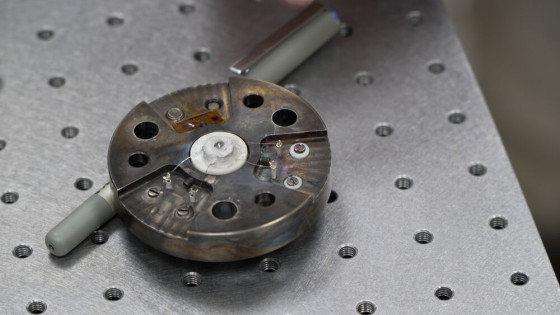
Die Erforschung der molekularen Eigenschaften von Wasser und seiner Rolle in geologischen Prozessen hilft den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht nur, besser zu verstehen, wie Lagerstätten entstehen, sondern auch, Vorhersagemodelle für die Bildung wirtschaftlich relevanter Rohstoffe zu entwickeln. Carmen Sanchez Valle ordnet die Grundlagenforschung in diesem Bereich ein: „Dieses Wissen ist entscheidend, um die Ressourcen kritischer Elemente für die Zukunft zu sichern.“
Das „Centre for Molecular Water Science“:
Das „Center for Molecular Water Science“ (CMWS) ist ein europäisches Forschungsnetzwerk zur molekularen Wasserforschung. Derzeit sind mehr als 60 Forschungseinrichtungen und Universitäten am CMWS beteiligt, davon mehr als 55 aus Europa. Die Forscherinnen und Forscher kommen aus der Physik, den Geowissenschaften, Chemie, Biologie, Medizin, Nanotechnologie und Ingenieurwissenschaften. Zentrum der CMWS-Initiative ist das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg. Mit weltweit führenden Großgeräten, interdisziplinären Zentren und spezialisierten Campuspartnern bietet der Standort ein ideales Umfeld, um das CMWS zu einem internationalen Leuchtturm der molekularen Wasserforschung zu entwickeln. Die Initiative definiert fünf strategische Forschungsbereiche: (1) grundlegende Eigenschaften des Wassers, (2) Klima-, Astro- und Geowissenschaften, (3) Energieforschung und Technologie, (4) chemische Dynamik in Echtzeit und (5) Molekulare Biowissenschaften. Diese fünf Bereiche bilden die Basis für die übergreifende Forschung des CMWS und verzahnen Grundlagenforschung mit anwendungsorientierter Forschung.

Zum Abspielen des Videos wird dieses von einem Webserver der Firma Google™ LLC geladen. Dabei werden Daten an Google™ LLC übertragen.
Autorin: Kathrin Kottke
Dieser Artikel stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 4, 12. Juni 2025.
