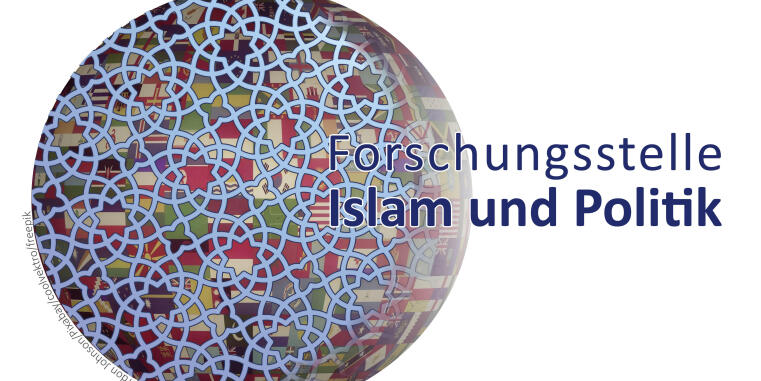
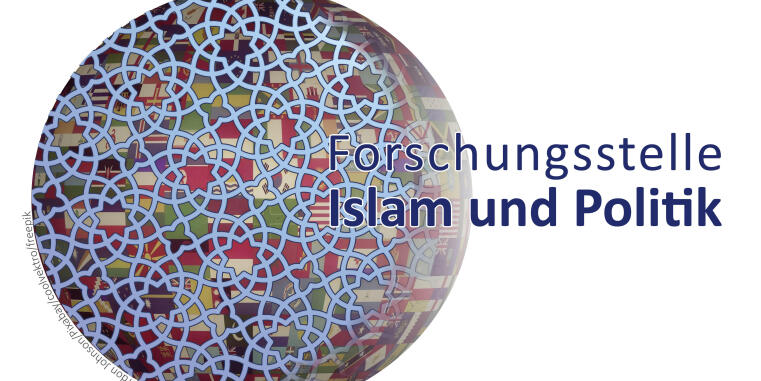
Aktuelles
Kurzzusammenfassung der Publikation „Prospective Islamic Theologians and Islamic Religious Teachers in Germany: Between Fundamentalism and Reform Orientation“
Die Zusammenfassung stellt zentrale Ergebnisse der ersten deutschlandweiten Befragung von Studierenden der Islamischen Theologie und Religionspädagogik vor. Sie beleuchtet Reformorientierung, Wertehaltungen sowie den Zusammenhang zwischen religiösen Einstellungen, sozialer Segregation und der Repräsentation durch islamische Verbände.
Zur Kurzzusammenfassung (PDF)
Zur Originalpublikation (Open Access) - (https://doi.org/10.1080/01416200.2024.2330908)
Die Forschungsstelle „Islam & Politik. Interdisziplinäre Perspektiven auf die Dynamiken des Islams“ ist eine interdisziplinäre Forschungsschnittstelle des Zentrums für Islamische Theologie und kooperiert mit dem Exzellenzcluster „Religion und Politik“.
Die interdisziplinäre Forschungsstelle widmet sich der theoretischen und gleichzeitig empirischen Erforschung von Dynamiken des Islams in der Politik in und außerhalb Europas sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart. Dazu gehört zentral das Verhältnis von Islam und Muslim*innen zur Politik. Der Fokus richtet sich hier auf die aktive Teilnahme an der Gestaltung und Regelung von Gesellschaft, Kultur, Staat und Politik anhand von solchen Werten und Normen, die von den Akteur*innen als islamisch angesehen werden. Diese Teilnahme kann sich sowohl innerhalb (z. B. parteipolitisches oder ehrenamtliches Engagement) als auch außerhalb der Grundsätze des demokratischen Rechtsstaates und den Menschenrechten vollziehen (z. B. Islamismus, Radikalisierung und deren Prävention).
Die Forschungsstelle vereint vier Zugänge zum Thema Islam und Politik:
Einen theologischen, einen historischen, einen sozialwissenschaftlich theoretischen und einen sozialwissenschaftlich empirischen Zugang.
Entsprechend gliedert sich die Forschungsstelle inhaltlich in einen:
- theologischen Bereich (zurzeit verantwortet von Mouhanad Khorchide)
- historischen Bereich (zurzeit verantwortet von Yassine Yahyaoui)
- sozialwissenschaftlich-theoretischen Bereich (zurzeit verantwortet von N.N.)
- sozialwissenschaftlich-empirischen Bereich (zurzeit verantwortet von Sarah Demmrich)
Ziel: Die Verknüpfung von theoretischen sowie empirischen Methoden der Sozialwissenschaften (u.a. Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Kulturanthropologie) mit historischen und theologischen Methoden und Zugängen verfolgt das Ziel, wissenschaftliche und außerwissenschaftliche Diskurse im Themenfeld Islam und Politik mit sowohl theoretischem als auch empirischem Material zu bereichern.
Hier erhalten Sie Informationen zur derzeit im Aufbau befindlichen Forschungsstelle „Islam und Politik“ sowie den dort angesiedelten Projekten, Tätigkeitsfeldern und Veranstaltungen.
Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich an islam.politik@uni-muenster.de.
Bei Fragen zu den einzelnen Projekten finden Sie eine Liste aller Ansprechpartner*innen:
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Mouhanad Khorchide
Stellvertretende wissenschaftliche Leitung für den sozialwissenschaftlich-empirischen Bereich: PD Dr. Sarah Demmrich
Stellvertretende wissenschaftliche Leitung für den sozialwissenschaftlich-theoretischen Bereich: N.N.
Assistenz der Leitung: Abdulkerim Şenel, M. Ed.
Forschungsprojekt „Ressentiment als affektive Grundlage von Radikalisierung“
Das Forschungsvorhaben interessiert sich für den kulturellen Boden, auf dem islamische Radikalisierung gedeihen und Resonanz finden kann. Es geht der Frage nach, welchen Anteil die Ausbildung einer kulturrelevanten Affektlage der Unterlegenheit und des Ressentiments unter Musliminnen und Muslimen an Prozessen ihrer Radikalisierung hat. ‚Ressentiment‘ bezeichnet dabei die Verfestigung eines Gefühls der Kränkung, das negative soziale Erfahrungen hypostasiert und positive Ansätze einer Verbesserung der Lage entwertet. Es drückt sich in Polarisierungen zwischen den Bevölkerungsgruppen entlang ethnischer und religiöser Grenzziehungen aus. Diese beziehen sich auf negative Erfahrungen bzw. Wahrnehmungen der Diskriminierung im Alltag, die im Ressentiment von ihrem pragmatischen Sachzusammenhang abgekoppelt werden und eine Eigendynamik gewinnen, die schließlich gegenüber den möglichen positiven Erfahrungen mehr oder weniger resistent bleiben. Um die Spezifik ressentimentgeladener Affektlagen herauszuarbeiten, sind ressentimentfreie Selbst- und Fremdwahrnehmungen in der Mehrheits-/Minderheitsfiguration für unser Vorhaben ebenfalls von Interesse. Das Projekt ist quantitativ und qualitativ angelegt. Eine repräsentative Befragung soll Ausprägungen und Verbreitung von sozial, religiös und politisch aufgeladenen Ressentiments unter in Deutschland lebenden muslimischen Einwanderern erfassen. Zum anderen ist geplant, Ziele und Organisationsstruktur islamischer Vereine und Assoziationen und dabei insbesondere die in diesen Milieus gepflegten Wahrnehmungsmuster und Einstellungen etwa zur nichtmuslimischen Umwelt zu analysieren. Diese Wahrnehmungsmuster sollen zugleich mit den Wahrnehmungsmustern in anderen muslimischen Milieus, die keinen Bezug zu den ressentimentgeladenen Gruppen haben, kontrastiert werden, um unterschiedliche Formen der Diskriminierungswahrnehmung und Differenzen in ihrer Verarbeitung herauszustellen.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Leitung: Prof. Dr. Mouhanad Khorchide
Wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen: N.N.
NEUERSCHEINUNG
Kränkungserfahrungen, Ressentiment und Radikalisierung in der muslimischen Bevölkerung
In: Islamismus als gesellschaftliche Herausforderung. Ursachen, Wirkungen, Handlungsoptionen.
Verfasst von: Evelyn Bokler, Sarah Demmrich, Özkan Ezli, Mouhanad Khorchide, Olaf Müller, Detlef Pollack, Levent Tezcan
Hrsg. von Shaimaa Abdellah, Thomas Volk u. a.
Springer VS, Wiesbaden 2025 | ISBN: 978-3-658-45955-5
Der Beitrag ist Teil des interdisziplinären Sammelbandes „Islamismus als gesellschaftliche Herausforderung“, der aktuelle Forschungsergebnisse zu Ursachen, Dynamiken und Handlungsoptionen im Umgang mit Islamismus zusammenführt. Die Autor*innen beteiligen sich darin mit einer gemeinsamen Analyse aus theologischer, sozialwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Perspektive.
Forschungsstelle für religiös und politisch motivierten Extremismus (FORPEX)
FORPEX setzt sich zum Ziel, Phänomene des religiös motivierten sowie politischen Extremismus wissenschaftlich zu untersuchen. Dabei stehen die extremistischen Ideologien, die davon abgeleiteten politischen Systeme und Feindbilder im Fokus. Organisationen und Netzwerke aus diesen Bereichen, die innerhalb der Europäischen Union ihre Wirkmacht entfalten, sollen hierbei im Mittelpunkt der Forschung und Dokumentation dieser Forschungsstelle stehen. Die dadurch entfachte Polarisierung und somit den sozialen Zusammenhalt gefährdenden Entwicklungen sollen nicht nur dokumentiert werden. Es gilt auch Lösungsansätze zu entwickeln und zu präsentieren. Die gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen sollen auch in den universitären Lehrbetrieb einfließen und im Rahmen von Lehrveranstaltungen diskutiert werden.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Leitung: Prof. Dr. Mouhanad Khorchide
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen: Abdulkerim Senel

