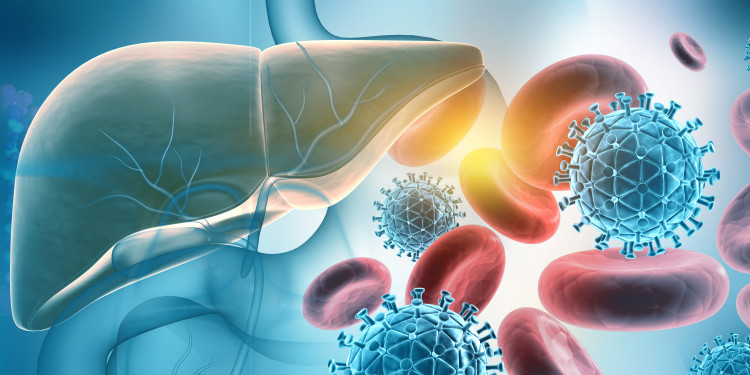
„Systematisches Erkennen von Infizierten ist besonders wichtig“
Der Welt-Hepatitis-Tag am 28. Juli weist auf die Bedeutung der Prävention, Diagnose und Behandlung von Leberentzündungen hin. 2010 erkannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Virushepatitis als eine globale Gesundheitsbedrohung an. Etwa 500 Millionen Menschen sind weltweit von Hepatitis B oder Hepatitis C betroffen – es gibt unterschiedliche Formen von Hepatitisviren, die in alphabetischer Reihenfolge von A bis E benannt sind. Zwar sinkt laut WHO die Zahl der Neuinfektionen, doch parallel dazu steigt die Zahl der Todesfälle, da viele Infizierte nicht diagnostiziert oder behandelt werden. Im Interview mit Kathrin Kottke und André Bednarz schildern die beiden Hepatitisexperten Prof. Dr. Jonel Trebicka und Dr. Kai-Henrik Peiffer den Stand der Forschung sowie die neuesten Entwicklungen in der Behandlung von Hepatitis und anderen Lebererkrankungen.
Die Zahl der Todesfälle steigt. Ist das ein Zeichen dafür, dass es in den vergangenen Jahren keine wesentlichen Fortschritte in der Hepatitisforschung gegeben hat?
Jonel Trebicka: Ganz und gar nicht. Es gab beispielsweise bahnbrechende Erfolge in der Entwicklung und klinischen Einführung von direkt antiviralen Medikamenten zur Behandlung der Hepatitis C: Sie ermöglichen Heilungsraten von über 90 Prozent. Zudem verzeichnen wir deutlich weniger Hepatitis-C-Patienten, die wegen einer verminderten Organfunktion in Folge einer Leberzirrhose ins Krankenhaus müssen.
Kai-Henrik Peiffer: In der Therapie von Hepatitis B und D wird zwar versucht, an diese Erfolge anzuknüpfen; bei diesen Varianten sind wir aber noch nicht so weit. Derzeit ist es bei Hepatitis B in den meisten Fällen nur möglich, die Vermehrung der Viren mit Medikamenten zu ,stören‘, eine wirkliche Heilung wie bei der Hepatitis C gelingt aber nur in wenigen Fällen. Bei der Behandlung der Hepatitis B/D-Koinfektion gab es allerdings einen signifikanten Fortschritt durch das Medikament Bulevirtid, mit dem wir diese aggressive Hepatitis gezielt bekämpfen beziehungsweise therapieren können.
Gehen wir einen Schritt zurück. Wie kommt es überhaupt zu einer Hepatitis?
Kai-Henrik Peiffer: In den meisten Fällen wird die Entzündung der Leber durch unser Immunsystem ausgelöst, während es versucht, Viren zu bekämpfen. Der Grad der Immunantwort hängt unter anderem von dem jeweiligen Virus und der spezifischen viralen Erbinformation ab, die zum Beispiel durch Mutationen verändert ist.
Welche Möglichkeiten gibt es, solche Virusinfektionen zu verhindern?

Kai-Henrik Peiffer: Die zweite wichtige Stellschraube betrifft die Impfung. Gegen Hepatitis B gibt es einen effektiven Impfstoff. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt eine Impfung für alle Kinder sowie für jene Erwachsene, die besonders gefährdet sind. Die Impfung wirkt auch gegen eine Superinfektion mit Hepatitis D, jedenfalls sofern die Person noch keine Hepatitis-B-Infektion hat. Wir sind daran beteiligt, ein therapeutisches und prophylaktisches Präparat gegen die Hepatitis D zu entwickeln. Trotz aller Bemühungen ist es bisher leider noch nicht gelungen, einen Impfstoff gegen Hepatitis C zu entwickeln, um das von der WHO angestrebte Ziel, die Elimination von Hepatitis C bis 2030, zu erreichen – aber die Wissenschaft sollte nicht aufgeben.
Neben den Leberentzündungen, den Hepatitiden, ist die Leberzirrhose eine häufig auftretende Lebererkrankung. Wie kann man das Risiko von Leberversagen bei diesen Patienten minimieren?
Kai-Henrik Peiffer: Bei akuter Verschlechterung der Leberzirrhose gilt es, schnell die Auslöser zu behandeln. Wie bei einer Sepsis zählt jede Stunde, denn eine verzögerte Antibiotikagabe verschlechtert die Überlebenschancen deutlich. Wenn kein Infekt vorliegt, aber eine akute Alkoholhepatitis als Auslöser erkannt wird, können sogenannte Kortikosteroide helfen und die Überlebenschancen verbessern. Bei einer Blutung aus Krampfadern in der Speiseröhre oder im Magen kann eine spezielle Gefäßstütze das Risiko für ein erneutes Bluten und die Überlebensrate verbessern.
Die Hepatitis ist mit ihren vielen Varianten offenkundig ein komplexes Feld. Haben Sie sich auf bestimmte Aspekte spezialisiert?

Jonel Trebicka: Neben den Hepatitiden arbeiten wir schwerpunktmäßig zum ,Akut-auf-chronischen Leberversagen‘ (ACLF). Dabei handelt es sich um multiples Organversagen bei der Leberzirrhose, zum Beispiel der Nieren, des Gehirns oder eben der Leber. Infolge einer chronischen Leberkrankheit, meist einer Leberzirrhose, lösen Infektionen, Alkohol oder eine Hepatitis B eine Überreaktion des Immunsystems aus. ACLF ist äußerst gefährlich und kann schon nach kurzer Zeit lebensbedrohlich werden. Deshalb ist es wichtig, die Auslöser schnell zu erkennen und zu behandeln, etwa durch eine Lebertransplantation.
Die schnelle Erkennung ist offenkundig ein wichtiger Aspekt, den Betroffene oder gefährdete Personen beachten sollten ...
Jonel Trebicka: Im Falle einer Virushepatitis ist es wichtig, dass Betroffene von der Infektion wissen. Deshalb appellieren wir an alle, die Screening-Programme wahrzunehmen. Im Falle einer Infektion gibt es in den allermeisten Fällen die Möglichkeit einer Behandlung. Davon abgesehen wünsche ich mir, dass wir auf unseren Fachkongressen offen und umfassend über wissenschaftlich und klinisch relevante Ergebnisse diskutieren. Und natürlich ist es wünschenswert, dass sich ein möglichst großes Publikum über die Themen informiert und dadurch sensibilisiert wird.
Zu den Personen
Prof. Dr. Jonel Trebicka leitet mehrere Forschungsprojekte an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster. Er ist zudem Direktor der Medizinischen Klinik B für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie, klinische Infektiologie und Endokrinologie des Universitätsklinikums Münster.
Privatdozent Dr. Kai-Henrik Peiffer ist an mehreren klinischen und grundlagenwissenschaftlichen Studien der Universität Münster zu viraler Hepatitis, viraler Inflammation und Organversagen beteiligt. Er arbietet zudem als leitender Oberarzt in der Medizinischen Klinik B mit dem Schwerpunkt Intensivmedizin.
