
Mit mathematischen Modellen gegen Corona, Masern und Co.
Spätestens seit der SARS-CoV-2-Pandemie (Corona) ist klar: Mathematische Modelle liefern zentrale Informationen über das Infektionsgeschehen. Sie sind daher auch für politische Entscheidungen zugunsten der öffentlichen Gesundheit relevant. Das neue „Interdisziplinäre Zentrum für Mathematische Modellierung der Dynamik von Infektionskrankheiten“ (IMMIDD) an der Universität Münster widmet sich infektionsdynamischen Fragen. Anlässlich des Auftaktsymposiums am 10. Juli im Schloss schildern Verbund-Wissenschaftler in ihren Gastbeiträgen, wie ihre Forschung dabei helfen kann, Pandemien zu bekämpfen.

Doch viele dieser Modelle sind kompliziert und ohne Fachwissen kaum nutzbar. Das ist ein Problem. Denn die Personen, die im Ernstfall entscheiden müssen, sind oft keine Wissenschaftler. Genau hier setzt die Wirtschaftsinformatik an: Sie will helfen, die Lücke zwischen Technik und Praxis zu schließen, indem Daten, Technik und Menschen so zusammengebracht werden, dass daraus bessere Entscheidungen entstehen – und zwar für die, die sie treffen müssen.
Klar ist aber auch: Das schafft die Wirtschaftsinformatik nicht allein. Dafür braucht es Teamwork – und zwar mit Fachleuten aus der Medizin, der Virologie und eben genau jenen, die am Ende über Maßnahmen entscheiden. Diese Zusammenarbeit erfolgt im IMMIDD. Ein erstes Ergebnis ist das sogenannte German Epidemic Microsimulation System (GEMS). Dabei handelt es sich um ein ausgeklügeltes Simulationssystem, das die Ausbreitung von Krankheiten in Deutschland realitätsnah abbildet – inklusive Alltag, Verhalten und Bewegung der Menschen. Besonders wichtig: GEMS ist leicht bedienbar und liefert schnelle, verständliche Ergebnisse. Das ist eine ideale Voraussetzung für Verantwortliche in der Politik und Verwaltung. So wird aus komplexer Forschung ein praktisches Werkzeug, das dabei hilft, Epidemien besser vorherzusehen, gezielter zu handeln und die Folgen für uns alle zu verringern.
Prof. Dr. Bernd Hellingrath, Institut für Wirtschaftsinformatik

Aktuell interessieren wir uns besonders für den Effekt von Großveranstaltungen wie Konzerten oder Fußballspielen auf das Kontaktverhalten von Menschen. Hierbei ist interessant, dass auch Menschen, die gar nicht die Großveranstaltung besuchen, ihren normalen Abläufe anpassen müssen. Um den Einfluss des Verhaltens auf Infektionsausbreitungsprozesse verstehen zu können, benötigt man mathematische Modelle, die es unter anderem ermöglichen, eine Bevölkerung im Ganzen zu untersuchen, auch wenn nur Informationen zu einzelnen Personen verfügbar sind. Solche Modelle können auch dazu eingesetzt werden, den weiteren Verlauf von Infektionsausbrüchen wie Epidemien und Pandemien vorherzusagen und die Effektivität möglicher Gegenmaßnahmen abschätzen zu können. Hier legt meine Forschung einen Schwerpunkt auf Gegenmaßnahmen, die auf den Ergebnissen spezifisch eingesetzter diagnostischer Tests basieren.
Ziel meiner Arbeit ist es, über möglichst realistische mathematische Modelle optimale Teststrategien für zukünftige Epidemien und Pandemien zu entwickeln, um die negativen Folgen von Infektionsausbrüchen in der Bevölkerung, aber auch in Risikogruppen wie dem Gesundheitspersonal minimieren zu können. Gegenmaßnahmen, die auf den Ergebnissen diagnostischer Tests basieren, haben dabei den Vorteil, dass sie nur die Personen betreffen, die tatsächlich unter erhöhtem Risiko stehen. Damit können sie sehr zielgerichtet eingesetzt werden.
Prof. Dr. André Karch, Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin
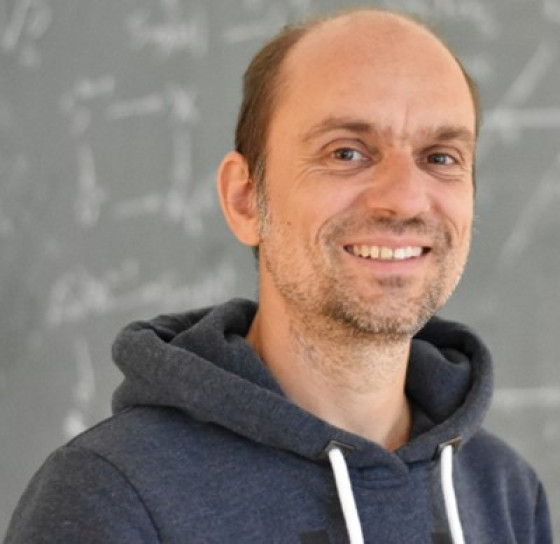
Mathematische Modelle erlauben generellere und weitreichendere Aussagen, als es rein datengetrieben möglich wäre. So ermöglicht deren mathematische Analyse beispielsweise eine Vorhersage, unter welchen Bedingungen Krankheiten ausgerottet werden können, zum Beispiel die Berechnung einer notwendigen Impfquote zur Masernbekämpfung.
Gerade die Vereinfachung der Modelle ermöglicht ein Verständnis davon, welches die zentralen Faktoren der Dynamik sind und wie sich diese beeinflussen lassen. Durch die Nichtlinearität der Modelle gibt es Szenarien, in denen kleine Eingriffe zu einem strukturell anderen Verhalten führen. Sie können beispielsweise darüber entscheiden, ob eine Krankheit ausgerottet wird, zyklisch wiederkehrt oder endemisch wird, also in der Bevölkerung dauerhaft gehäuft vorkommt.
Mittels numerischer Simulationen können wir diese Modelle an reale Daten anpassen und die Struktur von komplexeren Modellvarianten analysieren. Damit helfen Simulationen mathematischer Modelle im Falle einer Epidemie beispielsweise, die Auswirkungen einzelner Maßnahmen abzuschätzen oder Defizite in verfügbaren Daten zu identifizieren. Damit wollen wir zu einer fundierten Abwägung unterschiedlicher Maßnahmen beitragen. Ein Beispiel ist die Frage, ob Schulschließungen oder eine Homeoffice-Pflicht die Ansteckungsquoten stärker reduzieren werden, oder ob diese Maßnahmen womöglich sogar kontraproduktiv wirken, weil sie die Infektion verzögern.
Prof. Dr. Christian Engwer, Institut für Analysis und Numerik

Dabei zeigen neuere Studien den Einfluss von Erhaltungsgesetzen, etwa der Gesamtzahl von anfälligen, infektiösen und genesenen Personen, auf die Dynamik solcher Systeme: Solche Einschränkungen können die Musterbildung stark verändern oder sogar ganz neue kollektive Verhaltensweisen hervorrufen. Auch zeitverzögerte Prozesse, resultierend aus mehrtägigen Inkubationszeiten oder verzögerten Verhaltensänderungen in Reaktion auf neue Fälle führen zu komplexen Effekten, etwa zu Instabilitäten oder zyklischen Ausbrüchen.
Die Wechselwirkungen zwischen Individuen sind dabei nichtlinear – kleine Änderungen im Verhalten oder in der Mobilität können große, teils unerwartete Folgen haben. Die Methoden der nichtlinearen Physik werden am Institut für Theoretische Physik für ein breites Spektrum angewandt und weiterentwickelt. Es reicht von raumzeitlicher Laserdynamik über das Verhalten von Flüssigkeitstropfen auf adaptiven Substraten, aktiven Flüssigkeiten und Kristallen bis zu biophysikalischen Fragen der Gewebedynamik. Die Methoden bieten somit eine Grundlage, um gemeinsam ein tieferes Verständnis für die Dynamik der Ausbreitung von Infektionen zu entwickeln.
Prof. Dr. Svetlana Gurevich und Prof. Dr. Uwe Thiele, Institut für theoretische Physik

Das neue Forschungszentrum IMMIDD bekommt zum Start Verstärkung aus Brasilien. Möglich macht das eine Partnerschaft mit der größten brasilianischen Forschungsförderungseinrichtung CAPES, vermittelt durch das Brasilien-Zentrum der Universität Münster. Für bis zu anderthalb Jahre wird der brasilianische Epidemiologe Prof. Dr. Daniel Villela von der Forschungseinrichtung Fiocruz den „Brazil chair“ an der Universität Münster besetzen und hier forschen – gemeinsam mit einem Postdoc und einem Doktoranden aus seiner Gruppe.
In seiner Forschung beschäftigt sich Daniel Villela mit der Modellierung von Epidemien. Er untersucht insbesondere Krankheiten, die durch Tiere auf den Menschen übertragen werden. Diese internationale Kooperation stärkt nicht nur die Forschung am IMMIDD, sondern zeigt auch, wie globale Zusammenarbeit konkrete Antworten auf globale Gesundheitsfragen liefern kann.
