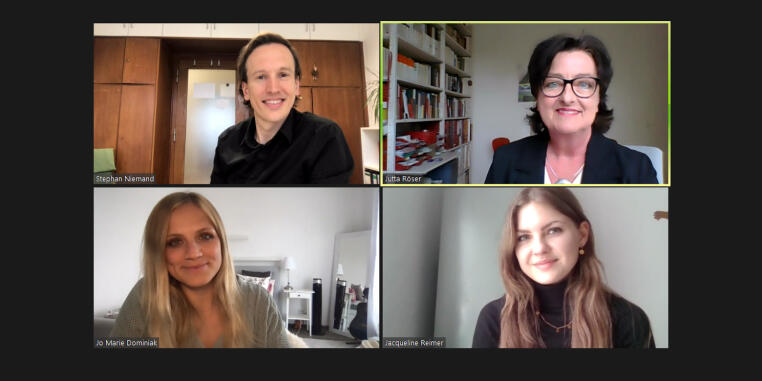

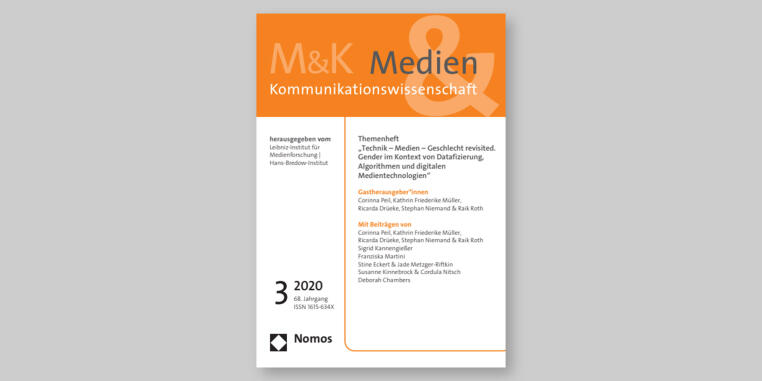

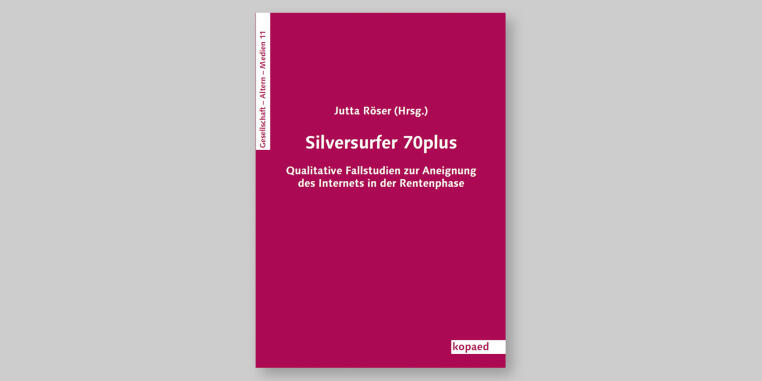
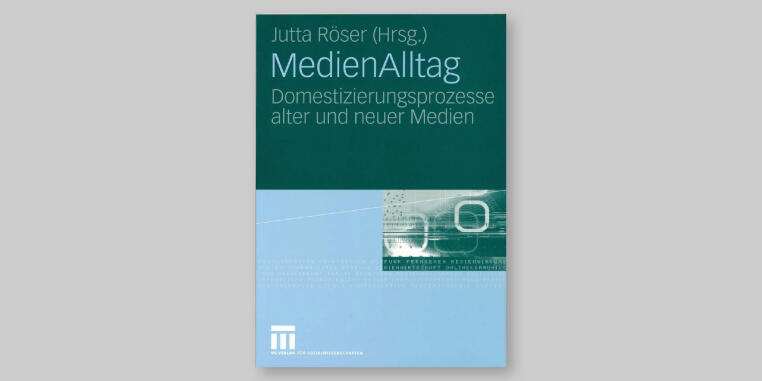
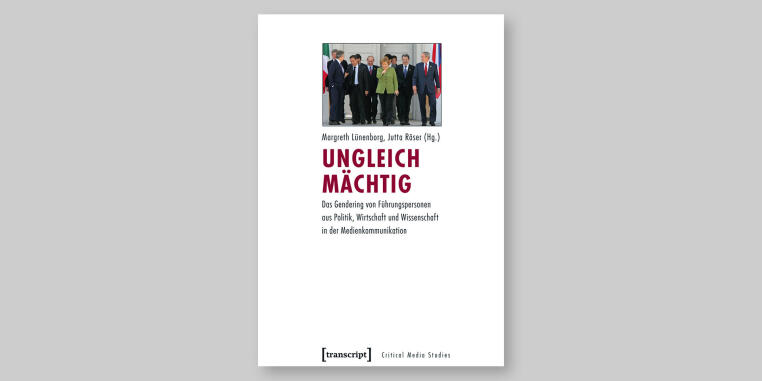
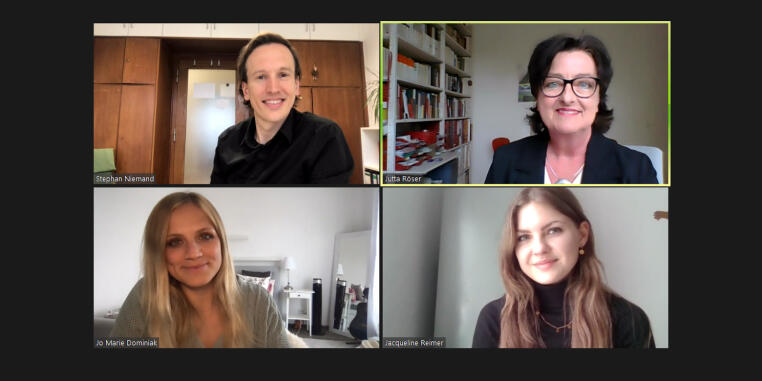

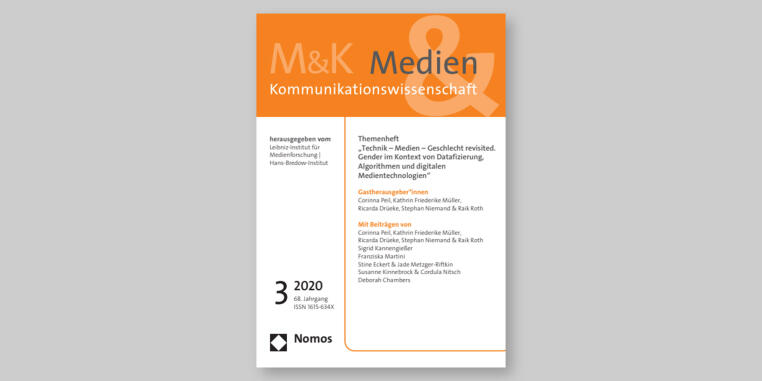

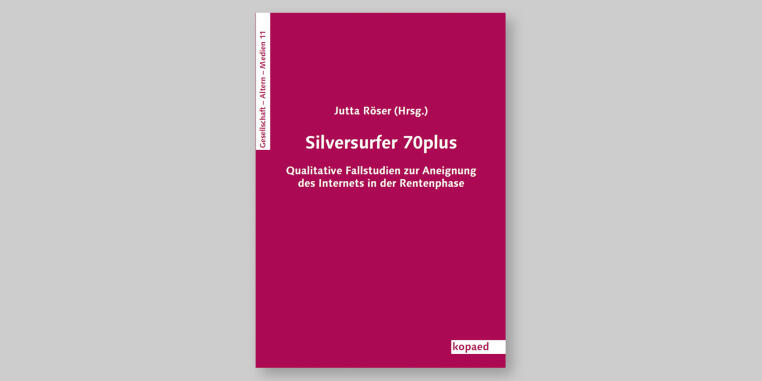
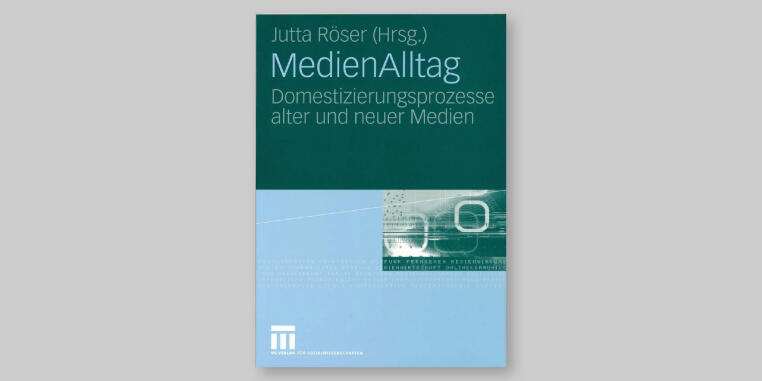
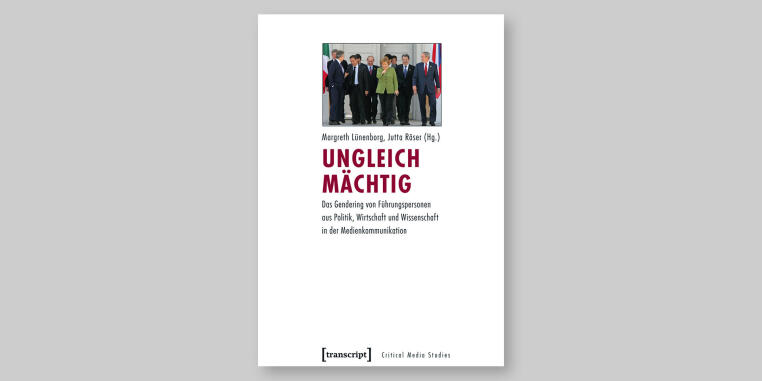
Der von Prof. Dr. Jutta Röser geleitete Arbeitsbereich befasst sich mit Medienaneignung aus soziologischer Perspektive und dem Verhältnis von gesellschaftlichem und medialem Wandel. In der empirischen Forschung stehen qualitative Methoden im Fokus. Kennzeichnend ist zudem eine medienethnografische Herangehensweise, die sich durch einen verstehenden Zugang, alltagsnahe Forschungssituationen und eine Kombination verschiedener Erhebungsmethoden auszeichnet. Thematisch stehen die folgenden fünf Schwerpunkte im Zentrum der Forschung des Arbeitsbereichs:
(1) Rezeptionsforschung, Medienaneignung und qualitative Methoden
(2) Mediatisierung von Alltag und Gesellschaft
(3) Domestizierung von Medientechnologien in Geschichte und Gegenwart
(4) Migration, Religion und soziale Ungleichheit
(5) Cultural Studies und Gender Media Studies
| Röser, Jutta, Prof. Dr. | +49 251 83-24266 | |
| Dominiak, Jo Marie, M.A. | +49 251 83-23013 | |
| Niemand, Stephan Dr. | +49 251 83-24263 | |
| Reimer, Jacqueline, M.A. | +49 251 83-21201 |
Auf Basis qualitativer Interviews gemeinsam mit Großeltern und Enkeln werden Hilfesysteme erforscht, die zwischen den Generationen bei der Aneignung digitaler Medientechnologien praktiziert werden. Einbezogen werden migrantische und nicht-migrantische Familien.
Schlagwörter: Familiale Generationenbeziehungen, Mediengenerationen, migrantische Familien, „Warm Expert“-Konzept, Teilhabe an digitaler Gesellschaft, Digital Divide, Medienkompetenz, Senior*innen
Eigenprojekt – Prof. Dr. Jutta Röser & Jacqueline Reimer
Das Internet hat sich durch seine Verhäuslichung massenhaft verbreitet: Wie verlief der Anschaffungsprozess? Wie haben Paare das Internet in ihren Alltag eingefügt und welche Veränderungen brachten mobile Technologien? Wie haben sich die häuslichen Medienrepertoires und Kommunikationskulturen verändert? Diese und weitere Fragen beantwortet die von der DFG geförderte qualitative Langzeitstudie mit Paarhaushalten. In ethnografisch orientierten Haushaltsstudien wurde ein systematisch zusammengestelltes Sample von 25 Paaren zwischen 2008 und 2016 viermal zu ihrem häuslichen Medienhandeln befragt. Ergänzt werden die Befunde durch eine Untersuchung von 16 Paaren der Online-Avantgarde im Jahr 2016.
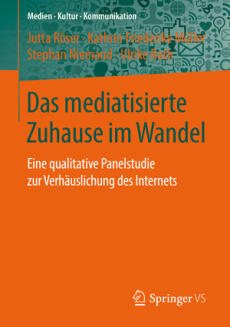
Die Studie wurde im Rahmen von vier DFG-geförderten Projekten durchgeführt. Sie war Teil des DFG-Schwerpunktprogramms „Mediatisierte Welten“. Eine Gesamtauswertung wurde 2019 publiziert:
Röser, Jutta/Müller, Kathrin Friederike/Niemand, Stephan/Roth, Ulrike (2019): Das mediatisierte Zuhause im Wandel. Eine qualitative Panelstudie zur Verhäuslichung des Internets. Wiesbaden: Springer VS.
Rezensionen zum Buch sind in M&K und Publizistik sowie im rkm-journal erschienen.
Erstmalig erfolgt mit der Dissertation von Stephan Niemand eine systematische Analyse über die Auswirkungen von Alltagsumbrüchen wie Elternschaft, Wohnungswechsel oder neue Partnerschaft auf die Nutzung von Medien. Anhand einer ethnografisch-orientierten Panelstudie mit 25 Paarhaushalten wird präzise herausgearbeitet, dass in solchen Übergangsphasen Veränderungen in der Alltagsstruktur einen tiefgreifenden Wandel der häuslichen Mediennutzung anstoßen. Die Studie liefert somit ein tieferes Verständnis zur Verwobenheit zwischen alltäglicher Lebensführung und Medienhandeln sowie zur Frage, warum sich die Mediennutzung im Laufe des Lebens verändert. Gleichzeitig wird mit dem Fokus auf Alltagsumbrüche eine neue und vielversprechende Forschungsperspektive für die Kommunikations- und Medienwissenschaft eröffnet.
Die Dissertation wurde 2020 publiziert und sowohl mit dem Dissertationspreis der WWU Münster für hervorragende Doktorarbeiten als auch mit dem Dissertationspreis der Fachgruppe Soziologie der Medienkommunikation der DGPuK (Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft) ausgezeichnet.
Stephan Niemand (2020): Alltagsumbrüche und Medienhandeln. Eine qualitative Panelstudie zum Wandel der Mediennutzung in Übergangsphasen. Wiesbaden: Springer VS.
Das Projekt erarbeitete qualitative Befunde über Silversurfer im Alter von 70 Jahren und älter, die erst in der Rentenphase mit der Nutzung des Internets begonnen haben. Gezeigt wird, wie die Seniorinnen und Senioren das Internet für sich entdeckt haben, wie sie es aktuell nutzen und erleben. Anschaulich wird insbesondere die Vielfalt innerhalb dieser Gruppe Älterer, die über ganz unterschiedliche Zugänge zum neuen Medium gefunden haben: über ein Ehrenamt, durch Anregungen von weit entfernt lebenden Kindern und Enkeln, aus dem Wunsch heraus, den Anschluss an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen nicht zu verlieren, und anderes mehr. Die Befunde beruhen auf einem gemeinsamen Projekt der beteiligten Autoren und Autorinnen im Rahmen eines einjährigen Masterforschungsseminars an der Universität Münster. In diesem Rahmen wurden 19 ausführliche qualitative Interviews mit Silversurfern über 70 Jahren in deren Zuhause durchgeführt. Außer den übergreifenden Auswertungen enthält das Buch zum Projekt medienethnografische Porträts aller Befragten, um den subjektiven Sichtweisen der Seniorinnen und Senioren Raum zu geben. Die Porträts zeigen, wie eigensinnig und motiviert die Silversurfer das Internet in ihren Alltag integrieren.
Das Buch zum Forschungsprojekt wurde durch Mittel von MedienAlumni gefördert und 2017 publiziert:
Röser, Jutta (Hg.) (2017): Silversurfer 70plus. Qualitative Fallstudien zur Aneignung des Internets in der Rentenphase. München: kopaed.
Rezensionen zum Buch sind in Publizistik und M+K erschienen.
Das Projekt setzte sich erstens mit der medialen Repräsentation von Frauen und Männern in Führungspositionen auseinander. Zwei Inhaltsanalysen zeigen, wie oft Spitzenfrauen und -männer in den Medien vorkommen und über welche Eigenschaften und Merkmale sie dort beschrieben werden. Zweitens stand die Auseinandersetzung der Nutzer*innen mit den Medien im Zentrum: Junge Frauen und Männer wurden zu ihrer Sicht auf Führungskräfte in den Medien befragt. In einem dritten Schritt beschäftigte sich das Projekt mit der Entstehung medialer Bilder und Texte über Interviews mit Journalist*innen. Auf dieser Basis beantwortet das Projekt die Frage, wie mit und durch Medien geschlechtsgebundene Bilder von Macht und Einfluss hergestellt werden. Die Analysen lassen die Fortschreibung tradierter Männlichkeit sichtbar werden und verweisen auf Formen der Modernisierung von Weiblichkeiten im Mediendiskurs.
Das Projekt wurde in Kooperation mit Margreth Lünenborg von der FU Berlin durchgeführt und vom BMBF gefördert. Das Buch zum Forschungsprojekt wurde 2012 in der Reihe Cultural Media Studies publiziert.
Lünenborg, Margreth/Röser, Jutta (Hrsg.) (2012): Ungleich mächtig. Das Gendering von Führungspersonen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der Medienkommunikation. Bielefeld: transcript.