Kontakt
Institut für PolitikwissenschaftT: +49 251 83-25325
zimmean@uni-muenster.de
Sprechstunde: Nach Vereinbarung
Büro
melanie.hoennemann@uni-muenster.de
Bürozeit: Montag und Mittwoch, 10 – 12 Uhr
Aus gegebenem Anlass ist Frau Hönnemann aktuell überwiegend im Homeoffice beschäftigt.
Aktuelles:
EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE SCHULE: Chronisch kranke Kinder und Jugendliche
26.06.2025In Deutschland leben etwa vier Millionen Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, wie z.B. Allergien, Diabetes, Rheuma, Darmentzündung, ADHS oder Depression. Am 26. Juni 2025 findet im Franz Hitze Haus ein Austauch mit Betroffenen, Pädagog:innen und Expert:innen statt.

© krokids Haus
"Theater: Zwischen Krisen" - DFG Abschlusskonferenz
25. & 26.04.2024 in MünchenAm 25. und 26. April fand die DFG-Abschlusskonferenz zum Thema "Institutionelle Transformationsdynamiken in den darstellenden Künsten der Gegenwart" statt.

Symposium "Empowerment durch Recht" der KROKIDS-Stiftung
28.02.2024Am 28.02.2024 wird das zweite Symposium der KROKIDS-Stiftung zum Thema Patienten-, Eltern- und Kinderrechte in der Versorgung chronisch Kranker im Franz Hitze-Haus in Münster stattfinden. Das Symposium ist als hybride Veranstaltung, die auch ins Internet übertragen wird, konzipiert.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der KROKIDS-Stiftung.

Kolloquium für DoktorandInnen
05.02.2024Am 05. Februar 2024 findet das DoktorandInnenkolloquium ab 10 Uhr statt
Die Aufnahmen der interdisziplinären Konferenz "Deutsch-Afrikanischer Dialog" sind ab sofort auf YouTube verfügbar
Die Rolle der Zivilgesellschaft für das Funktionieren von Gesellschaft und Staat ist in Deutschland schon seit langem Gegenstand nicht nur der politikwissenschaftlichen Forschung, sondern auch einer breiteren öffentlichen Debatte. Dass auch die Politik die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Organisationsformen anerkennt, zeigt sich unter anderem in einer finanziellen Förderung dieses Engagements aus staatlichen Mitteln. Dass sich auch in vielen Staaten (Subsahara)Afrikas in den letzten Jahren eine lebendige Zivilgesellschaft entwickelt hat, ist indes in Deutschland nicht allzu bekannt. Dennoch trägt zivilgesellschaftliches Engagement in seinen verschiedensten Erscheinungsformen auch dort maßgeblich zur Bearbeitung und Bewältigung von Konflikten und zur Debatte über gesellschaftliche Konsense bei.
In diesen Beiträgen als Teil der interdisziplinären Tagung "Deutsch-Afrikanischer Dialog" nähern wir uns dem Thema aus verschiedenen Perspektiven (Kunstgeschichte, Ethnologie, Politik und Zivilgesellschaft). Wir blicken an konkreten Beispielen auf die Rolle der darstellenden Kunst im deutsch- afrikanischen Dialog, auf die Frage der Dekolonialisierung europäischer Kunstsammlungen, auf die Rolle der Kunst in der Aufarbeitung von Konflikten sowie auf die künstlerische Renaissance in Afrika. So wollen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede zivilgesellschaftlicher Organisations- und Aktionsformen in Deutschland und Afrika analysieren.
Die gesamte Playliste finden Sie hier.
Neuer Podcast der Graduate School of Politics Münster
Der neue Podcast der GraSP in Zusammenarbeit mit Prof.'in Zimmer ist ab sofort verfügbar. In der ersten Folge kann der Vortrag von Prof. Dr. Christian Lahusen im Rahmen der GraSP Workshop-Reihe "Parole, Parole, Parole? Von der Wirkungsmacht von Dispositiven, Narrativen und Frames in der Politik" zum Thema "Der Claims-Making-Ansatz und die Analyse massenmedial vermittelter Debatten" gehört werden.
In der zweitenFolge kann der Vortrag von Dr. Katja Freistein im Rahmen der GraSP Workshop-Reihe "Parole, Parole, Parole? Von der Wirkungsmacht von Dispositiven, Narrativen und Frames in der Politik" zum Thema "Storytelling in der Politik – das Narrativ als wirkungsmächtiges Instrument von Politikgestaltung" gehört werden.
Der Podcast ist auf Amazon Music und Spotify verfügbar.
Erste IfPol-Promotion 2023
Roman Turczynski verteidigte am 01.02. erfolgreich seine Dissertation „Fundamente liberalen und republikanischen politischen Denkens. Subjektivistische und objektivistische Grundannahmen in Theorien der Civil Society“. Betreut wurde er in der Graduate School of Politics von Prof.‘in Annette Zimmer und Prof. Rolf Puster (Uni Hamburg). Herzlichen Glückwunsch!

Prof. Rolf Puster (Uni Hamburg), Roman Turczynski und Prof.‘in Annette Zimmer (v. l.)© privat
„Zukunft gestalten mit Sozialen Innovationen“ – neue Buchpublikation im Campus Verlag erschienen
Sozialen Innovationen wird heute – noch verstärkt durch die Corona-Pandemie – immer mehr Aufmerksamkeit zuteil. In Deutschland hat es einige Zeit gedauert, bis das Konzept und seine Bedeutung ins politische Bewusstsein gerückt sind. Der im Campus Verlag erschienene Band versammelt die führende Expert*innen in der deutschsprachigen Sozialen Innovationsforschung. Er spiegelt die interdisziplinären Perspektiven auf Soziale Innovationen wider und fragt nach deren Potenzial, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen – etwa soziale Ungleichheit oder Klimawandel – zu bewältigen. Dabei nehmen die Beiträge auch förderpolitische Ansätze auf nationaler und internationaler Ebene sowie Kriterien zur Bewertung und Wirkung von Sozialen Innovationen in den Blick. Herausgegeben wurde der Band von Jürgen Howaldt (TU Dortmund), Miriam Kreibich (VDI/VDE-IT), Jürgen Streicher (Joanneum Research) , Carolin Thiem (VDI/VDE-IT).
Hier ist das Buch im Open Access frei verfügbar.
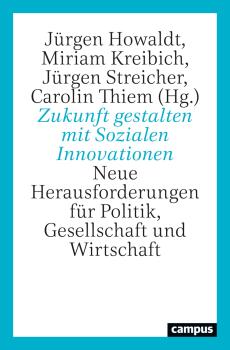
© campus
BMBF-Projekt „Resilient Urban Communities: Social Enterprises and Nonprofits as Service Providers and Vehicles for Participation in African Megacities“
(01.06.2021-31.05.2024)Hier geht es zur Projektwebseite.
Das afrikanisch-deutsche Verbundprojekt RUC (2021-2024) adressiert die Schwerpunkte „nachhaltige Städte und Gemeinden (11)“ und „hochwertige Bildung (4)“ der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen mit dem Zweck, zur Stärkung der Resilienz afrikanischer urbaner Kontexte beizutragen. RUC umfasst eine Forschungs-, Netzwerk- und Bildungskomponente zu den Themenfeldern „Kommunale Verwaltung“, „Good Governance“ und „Förderung von Mitgestaltungs- und Teilhaberechten, insbesondere benachteiligter Gruppen“.
Die Zielsetzung der Forschungskomponente von RUC besteht darin, die lokale Infrastruktur und die Versorgungssysteme für besonders Schutzbedürftige (Frauen, Kinder) in sozial benachteiligten Stadtteilen zu verbessern, die Governance afrikanischer Megastädte zu optimieren und dadurch deren Resilienz zu steigern. Hierzu werden insbesondere die Feldforschungsphasen in Johannesburg genutzt, die in den Arbeitspaketen 5 und 8 angelegt sind. Im Zentrum der Forschung von RUC stehen Soziale Un-ternehmen (SEs) und Nonprofit-Organisationen (NPOs), die als soziale Dienstleister und Promotoren bürgerschaftlichen Engagements nachhaltig zu Integration und Partizipation und damit zur Steigerung der Resilienz benachteiligter Bevölkerungsgruppen in urbanen Kontexten beitragen können. Anhand von Fallstudien in Johannesburg (Südafrika) soll evidenzbasiertes Wissen sowohl über die Öko-Systeme von SEs und NPOs in sozial problematischen Stadtteilen afrikanischer Megastädte, als auch über die Governance und Managementstrukturen von SEs und NPOs generiert werden. Auf dieser Grundlage sollen auf der Makroebene Handlungsempfehlungen für die kommunale Verwaltung im Dienst einer Verbesserung der Öko-Systeme von SEs und NPOs in problematischen Stadtteilen erarbeitet werden; ferner sollen auf Grundlage der Fallstudien ausgewählter SEs und NPOs auf Mikroebene praxisorien-tierte Handlungsanleitungen (Handbuch) für die Leitung und Führung von SEs und NPOs in problema-tischen Kontexten entwickelt werden. Die Kombination der Schritte auf Makro- und Mikroebene soll dazu beitragen, das Potenzial von SEs und NPOs zur Verbesserung der Resilienz der Gemeinden, in denen sie aktiv sind, zu erhöhen.
Die Zielsetzung der Netzwerkkomponente von RUC besteht in der Stärkung des Kompetenz- und Kapazitätsaufbaus vor Ort. Die Netzwerkkomponente besteht aus unterschiedlichen Teilaspekten, die in den einzelnen Arbeitspaketen adressiert werden: A) einer themenspezifischen Konferenz auf der die Forschungsergebnisse von RUC vorgestellt und mit Expert*innen diskutiert werden (Arbeitspaket 9). B) zwei digitaler PhD-Workshops, die, neben der konkreten Unterstützung der Doktorand*innen in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, dem Aufbau und der Konsolidierung eines Netzwerks aus (zukünftigen) Expert*innen (Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen) in den Bereichen Sozialwirtschaft, Nonprofit-Organisationen, Philanthropie und Good Governance in Afrika dient. C) Einem jährlichen RUC Projekttreffen auf dem zum einen die nächsten Forschungsschritte vorbereitet, sowie zum anderen Lehrmaterialien zu den Themen des Projektes konzeptualisiert werden. D) einer Studienreise der afrikanischen Partner*innen nach Deutschland und eines Gesprächsformats im Rahmen der Abschlusskonferenz, an dem auch externe Ak-teure der öffentlichen Verwaltung und lokal tätiger Unternehmen teilnehmen. Die Netzwerkkomponente wird intensiviert durch ein Mentoring Programm speziell für Doktorandinnen, das in Anbindung mit den im Projektzeitraum stattfindenden PhD-Workshops aufgebaut und in enger Zielsetzung der Lehrkomponente von RUC ist die Erarbeitung von Lehrmaterialien mit Handbuchcharakter als praxisbezogene Handlungsanweisungen für die lokale Verwaltung sowie als online-gestützte Module für den Einsatz in der grundständigen universitären Lehre und in Weiterbildungsprogrammen. Hierbei dienen die Arbeiten zum Forschungsstand in Arbeitspaket 3 als Grundlage. Geplant ist die Kon-zeption eines Weiterbildungsprogramms (Workshops und Seminare) für Praktiker*innen – Verwaltungsfachleute sowie Führungskräfte und Mitarbeiter*innen von SEs und NPOs - in Afrika. Die Lehr-materialien werden auf der Grundlage der Forschungsarbeiten und -ergebnisse von RUC konzeptuali-siert und auf den Konferenzen und Projekttreffen diskutiert, ergänzt und praxisbezogen weiterentwickelt, so dass sie mittel- und langfristig unterschiedlichen Akteuren dienen können, um zu einer Stärkung der Resilienz ihres jeweiligen Kontexts beizutragen.

© RUC
DFG-Projekt „Was für ein Theater“
(01.05.2021-30.04.2024)Das auf drei Jahre befristete Projekt „Was für ein Theater?“ hat die komparative Analyse der Cultural und Corporate Governance der öffentlich getragenen Theater in den DACH-Ländern (Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz) unter besonderer Berücksichtigung von Gendergerechtigkeit für die weiblichen Theaterschaffenden zum Ziel. „Was für ein Theater“ knüpft an die erste Projektphase und die Analyse der Folgen des Krisengefüges (kulturelle, finanzielle und legitimatorische Krise) für Stadttheater in der Provinz und insbesondere für die Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse am Theater einschließlich der Leitungsebene an.
Empirisch soll im Nachfolgeprojekt untersucht werden, ob die Delegitimation des Theaters primär Stadttheater betrifft und insofern standort- sowie ressourcenbezogen ist, oder aber Theater generell und damit auch in Landesstädten und Metropolen sowie im europäischen Ausland mit einer legitimatorischen Krise konfrontiert sind. Zudem sollen die Folgen der Verwaltungsreform bzw. die Veränderung der kulturpolitischen Steuerung (Cultural Governance) der Theater in den DACH-Ländern erfasst sowie untersucht werden, wie sich diese auf die Leitung und das Management der Häuser (Corporate Governance) auswirken.
Rekurriert wird auf einen Methodenmix von Policy-Analyse, Befragung und Case Studies. Die kulturpolitischen Legitimationsmuster werden pro Land diskursanalytisch auf Grundlage von Sekundärliteratur, Dokumentanalyse sowie Expert*inneninterviews (Kulturschaffende, kulturpolitische Akteure) ermittelt und analysiert. Aus verwaltungswissenschaftlicher Perspektive werden die Rechts- und Organisationsformen der Theater sowie der Einsatz von New Public Managementinstrumenten mittels einer teil-standardisierten Befragung auf Ebene der Geschäftsführung der Theater erfasst. Case Studies eines Samples von Theatern werden zur Untersuchung der Corporate Governance (Leitungs- und Führungsstrukturen, Profil- und Programmgestaltung, Gendergerechtigkeit) durchgeführt.Neben der Landes- und Kantonszugehörigkeit und der jeweils spezifischen Cultural Governance stehen für das Sampling als weitere Auswahlkriterien die Tradition bzw. historische Entwicklung sowie der Spartenmix des betreffenden Hauses im Fokus. Da die Oper gemäß den Umfragen die stärksten Besucherrückgänge zu verzeichnen hat und gleichzeitig die kostenintensivste Darstellungsform darstellt, wird auf diese Sparte ein besonderes Augenmerk gerichtet. Beim Sampling werden entweder Mehrspartenhäuser oder aber sog. Theaterholdings mit Opernbeteiligung besonders berücksichtigt.
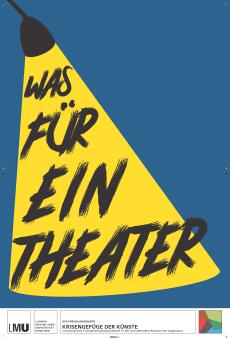
© Krisengefüge der Künste Lehre
WiSe 2023/24
Kolloquium für DoktorandInnen: 05. Februar um 10 Uhr.
SoSe 2023
Kolloquium für DoktorandInnen: 19. Juni um 13 Uhr.
Workshop der GraSP im SoSe 2023: Parole, Parole, Parole? Von der Wirkungsmacht von Dispositiven, Narrativen und Frames in der Politik, Freitag, 05. Mai und Freitag, 23. Juni, jeweils von 11.00 – 15.00 Uhr im Seminarraum SCH100.101. Das Programm sowie die Präsentationen der Vortragenden sind hier zu finden.
WiSe 2022/23
Kolloquium für DoktorandInnen: 6. Februar.
SoSe 2022
Keine Lehrveranstaltungen
WiSe 2021/22
Keine Lehrveranstaltungen
SoSe 2021
Interdisziplinäre Ringvorlesung "Riskante Künstler*innen. Potentiale und Gefährdungen in der Kreativwirtschaft", Mi, 18-19:30 Uhr
Den Flyer zur Ringvorlesung finden Sie hier.
Zoom-Einwahldaten: nach Anmeldung mit Betreff „Ringvorlesung 2021“ unter ringvorlesung.zeugs@uni-muenster.de.Kolloquium für DoktorandInnen und Masterstudierende: 5. und 6. Juli.
WiSe 2020/21
Keine Lehrveranstaltungen
SoSe 2020
Hauptseminar: Civil society and external democracy promotion in times of "shrinking spaces", Do, 12-14 Uhr
Bachelorseminar: Was für ein Theater?!, Di, 14-16 Uhr
Kolloquium für DoktorandInnen, Mi, 14-16 Uhr
Weiterbildungsstudiengang Nonprofit-Management and Governance
Annette Zimmer ist Mitbegründerin und Wissenschaftliche Leiterin des Studiengangs Nonprofit-Management and Governance, welcher von der WWU Weiterbildung gGmbH angeboten wird. Sie ist zudem Modulbeauftragte für die Module 1 (Kontexte des Nonprofit-Managements) und S (Schwerpunktmodul). Annette Zimmer leitet die Lehrveranstaltung "Der Nonprofit-Sektor in Deutschland und international" (Modul 1).
Weitere Informationen zum Studiengang erhalten Sie hier.
Papers
2016
Praktikumsbericht von Patrick Hoemke im Rahmen eines Praktikums bei Maison des Associations Internationales in Brüssel Analysis of Barriers and Facilitators for Third Sector Organizations on the European Level of Governance and Preparation of Supportive Activities for Start-Up Organizations in Advocacy and Lobbying
2014
Hausarbeit von Jurek Milde im Rahmen des Masterkurses Organisationssoziologie und -theorie Organisationsanalyse: Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße (cuba e.V.)
Hausarbeit von Jasper Vierhaus im Rahmen des Standardkurses "Wohnungspolitik: Gentrifizierung, Bezahlbarkeit und ‚Schöner Wohnen‘ – aktuelle Diskurse" (bei Danielle Gluns)
Die Olympischen Spiele von London und ihre Bedeutung für die Wohnraumentwicklung des East-End – Eine Analyse der diskursiven Deutungsproduktion2013
Zimmer, Annette/Gluns, Danielle (Hrsg) (2013): Soziale Innovation, Soziales Investment, Soziales Unternehmertum, annotierte Bibliographie2010
Wolf, André Christian/ Zimmer, Annette (2010): Besetzung ehrenamtlicher Vereinsvorstände – Vorstände verzweifelt gesucht, in: Verbands-Mangement, 36. Jahrgang, Ausgabe 3, S. 28-37.
Hausarbeit von Miriam Schwartz im Rahmen des Weiterbildungsstudiengangs Nonprofit Management and Governance: "Die Internationale Föderation der Arche-Gemeinschaften. Eine Alternative des gesellschaftlichen Zusammenlebens"Projekte
aktuelle Projekte:
- 06/2021-05/2024: BMBF-Projekt „Resilient Urban Communities: Social Enterprises and Nonprofits as Service Providers and Vehicles for Participation in African Megacities“
Das afrikanisch-deutsche Verbundprojekt RUC (2021-2024) adressiert die Schwerpunkte „nachhaltige Städte und Gemeinden (11)“ und „hochwertige Bildung (4)“ der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen mit dem Zweck, zur Stärkung der Resilienz afrikanischer urbaner Kontexte beizutragen. RUC umfasst eine Forschungs-, Netzwerk- und Bildungskomponente zu den Themenfeldern „Kommunale Verwaltung“, „Good Governance“ und „Förderung von Mitgestaltungs- und Teilhaberechten, insbesondere benachteiligter Gruppen“.
Webseite des RUC-Projektes - 05/2021-04/2024: DFG-Projekt „Was für ein Theater“
Das auf drei Jahre befristete Projekt „Was für ein Theater?“ hat die komparative Analyse der Cultural und Corporate Governance der öffentlich getragenen Theater in den DACH-Ländern (Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz) unter besonderer Berücksichtigung von Gendergerechtigkeit für die weiblichen Theaterschaffenden zum Ziel. „Was für ein Theater“ knüpft an die erste Projektphase und die Analyse der Folgen des Krisengefüges (kulturelle, finanzielle und legitimatorische Krise) für Stadttheater in der Provinz und insbesondere für die Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse am Theater einschließlich der Leitungsebene an.
Teilprojekt 7: Was für ein Theater? Vergleichende Untersuchung der Cultural und Corporate Governance öffentlicher Theater in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Krisengefüge der Künste
abgeschlossene Projekte:
- 02/2018-04/2021: Passion als Beruf? Karriere und Arbeitssituation des künstlerischen, technischen und administrativen (Leitungs-)Personals an ausgewählten Mehrspartenbühnen in NRW und den neuen Bundesländern
Das Projekt ist Teil des von der DFG finanzierten Projektverbundes "Krisengefüge der Künste: Institutionelle Transformationsdynamiken in den darstellenden Künsten der Gegenwart" unter Leitung von Prof. Dr. Balme (LMU, München). Im Zentrum von "Passion als Beruf?" steht die aktuelle Situation der Institution Stadttheater. In sechs Kommunen werden die Tradition des jeweiligen Stadttheaters, die Einbindung in die Stadtgesellschaft und der Stellenwert der Häuser in der Kommunalpolitik aus politikwissenschaftlicher Perspektive näher betrachtet. Daran anschließend werden die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse des Personals in Kunst, Verwaltung und Technik näher in den Blick genommen und hierbei insbesondere auf die Arbeitssituation und Karrieremöglichkeiten der weiblichen Beschäftigten an den ausgewählten Stadttheatern eingegangen. LMU München - Passion als Beruf - 09/2016-08/2019: Models of Co-operation between Local Governments and Social Organizations in Germany and China– Migration: Challenges and Solutions (LoGoSO)
- 11/2015-06/2019: Conditions and impacts of welfare mix. Comparative analysis of policy making, public discourse and service quality
- 01/2016-2018: For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the Move (FAB-MOVE) https://www.uni-muenster.de/IfPol/FAB-MOVE/
- 05/2015 - 10/2017: InnoSi - Innovative Social Investment: Strengthening Communities in Europe http://www.uni-muenster.de/IfPol/InnoSI/
- 06/2015-05/2017: BMFSFJ: In der Abseitsfalle? Frauen im Top-Management und im operativen Bereich von Nonprofit Organisationen http://www.uni-muenster.de/FiA/
- 01/2014 - 2016: EU - Commission 7th Research Framework Project: TSI - Third Sector Impact http://thirdsectorimpact.eu/
- 02/2014 - 2016: EU - Commission 7th Research Framework Project: EFESEIIS - Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies http://www.fp7-efeseiis.eu/
- PACT - Cities as laboratories of innovative Governance in Europe and the USA
- ZEUGS - Zentrum für Europäische Geschlechterstudien
- 12/2010 – 2013 EU-Commission 7. Research Framework: "Welfare Innovations at the Local Level in Favour of Cohesion (WILCO)", WILCO auf Facebook
-
2008 – 2010 BMFSFJ: "Lokale Engagementpolitik. Bestandsaufnahme, Weiterentwicklung und Evaluation der Infrastruktur lokaler Engagementpolitik" (Weitere Informationen finden Sie hier.)
-
2006 – 2011 Graduiertenkolleg "Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart - Deutschland und die Niederlande im Vergleich" (gefördert durch die DFG) (Zur Homepage des Graduiertenkollegs.)
Wissenschaftlicher Werdegang
Annette Zimmer, Prof. Dr., studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie an den Universitäten Mannheim und Heidelberg; 1986 Promotion zum Dr. phil., 1986 - 1988 Lehr- und Forschungsaufenthalt am Program on Nonprofit Organizations der Yale University; 1989 - 1995 Hochschulassistentin an der Universität-Gesamthochschule Kassel im Bereich Verwaltungsforschung; seit 1996 Professorin für Vergleichende Politikwissenschaft und Sozialpolitik am Institut für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität; 1998/99 Visiting Professor an der University of Toronto; 2010 Visiting Fellow am American Institute for Contemporary German Studies, Johns Hopkins University, Washington D.C.; zahlreiche Publikationen zu Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches Engagement, Nonprofit-Organisationen, Vereinen, Verbänden, Stiftungen und zwar zu Fragen des Managements und der Governance der Organisationen sowie ihrer politikfeldspezifischen Einbettung. Seit August 2020 ist Prof. Dr. Zimmer Seniorprofessorin am Institut für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität.
Publikationen
Eine vollständige Liste der Publikationen von Frau Prof.'in Dr. Zimmer finden Sie hier.
Neueste Veröffentlichungen sind:
Zimmer, Annette/Priller, Eckhard, 2023: Zur Lage des Nonprofit-Sektors in Deutschland, in: Klein, Ansgar/Sprengel, Rainer/Neuling, Johanna (Hrsg.): Engagementstrategien und Engagementpolitik, Jahrbuch Engagementpolitik 2023, Frankfurt: Wochenschau Verlag, S. 93-100.
Zimmer, Annette, 2022: Lobbyismus aus politikwissenschaftlicher Perspektive, in: Polk, Andreas/Mause, Karsten (Hrsg.): Handbuch Lobbyismus, Wiesbaden: Springer: https://doi.org/10.1007/978-3-658-32324-0_3-1.
Zimmer, Annette/Priller, Eckhard, 2022: Women in the German Nonprofit Sector: Working Conditions and Promotion Opportunities, in: Hoelscher, Michael/List, Regina A./Ruser, Alexander/Toepler, Stefan (Eds.): Civil Society: Concepts, Challenges, Contexts, Cham: Springer Verlag, s. 413-429.
Zimmer, Annette/Obuch, Katharina, 2022: Governance und Soziale Innovationen: Eine Frage der Perspektive?, in: Howaldt, Jürgen/Kreibich, Miriam/Streicher, Jürgen/Thiem (Hrsg.): Zukunft gestalten mit sozialen Innovationen: Neue Herausforderungen für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Frankfurt: Campus Verlag, S. 225-240.
Zimmer, Annette, 2022: Akteure in der Naturschutzpolitik: Interessenverbände und Organisationen, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Naturschutzpolitik, Bonn: https://www.bpb.de/themen/umwelt/naturschutzpolitik/510504/akteure-in-der-naturschutzpolitik-interessenverbaende-und-organisationen/.
Zimmer, Annette/Priller, Eckhard, 2022: Der Nonprofit-Sektor in Deutschland, Bonn: FES: https://library.fes.de/pdf-files/pbud/19815.pdf.
Zimmer, Annette/Toepler, Stefan/Levy, Katja/Fröhlich, Christian, 2022: Beyond the Partnership Paradigm: toward an Extended Typology of Government – Nonprofit Relationship Patterns, in: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (July 2022): https://doi.org/10.1177/089976402211128.
Zimmer, Annette, 2022: Lobbyismus aus politikwissenschaftlicher Perspektive, in: Polk, Andreas/Mause, Karsten (Hrsg.): Handbuch Lobbyismus. Springer VS, Wiesbaden.
Zimmer, Annette/Priller, Eckhard, 2022: Women in the German Nonprofit Sector: Working Conditions and Promotion Opportunities, in: Hoelscher, Michael et al (Hrsg.), Civil Society: Concepts, Challenges, Contexts, S. 413-431. New York: Springer.
Zimmer, Annette, 2022: Verbände – Veränderungen als Managementherausforderung, in: Stumpf, Marcus (Hrg.), Verbandsmanagement. Potenziale, Prozesse und Ergebnisse professionell managen, S. 21-40. Stuttgart: Schäfer-Poeschel.
Zimmer, Annette, 2022: Power of Resilience: Wie gehen Nonprofit-Organisationen mit veränderten Umweltbedingungen um? in: Dorothea Greiling/Réne Andeßer/Markus Gmür (Hrsg.), Kooperation und Konkurrenz von Nonprofit-Organisationen. Theoretische Grundlagen, empirische Ergebnisse und Anwendungsbeispiele, S. 9–21. Linz: JKU Linz.
Zimmer, Annette/Obuch, Katharina, 2022: If Not for Democracy, for What? Civil Society Organisations in Non-Democratic Settings. in: Caroline Y. Robertson-von Trotha (Hrsg.), Realities, challenges, visions? Towards a new foreign cultural and educational policy, S. 77–91. Karlsruhe: KIT Scientific Publishing.
Zimmer, Annette, 2022: Herausforderungen für die Zivilgesellschaft und wie NPOs damit umgehen, in: Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen (npoR), Vol 14 No 2, S. 45–83.
MitarbeiterInnen
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
Obuch, Katharina, Dr. (in Elternzeit)
Baca Duque, Rike-Kristin, M.A. (in Elternzeit)
Christmann, Fabian, M.A.
Büro
Hönnemann, Melanie (in Elternzeit)
Studentische Hilfskräfte
Guthke, Hanna
Schlinkert, Paulina
Wissenschaftlicher Nachwuchs
Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuell von Frau Prof.'in Dr. Zimmer betreuten Doktorarbeiten.
Eine Liste bereits abgeschlossener Dissertationen und Habilitationen finden Sie hier.


