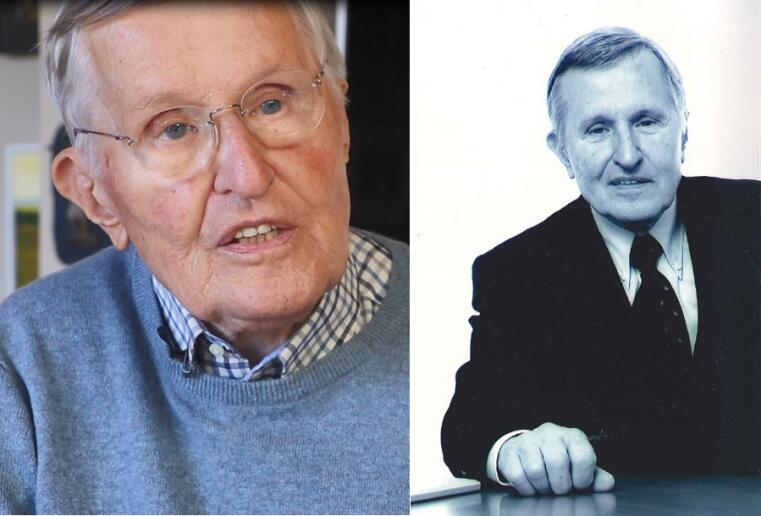Das IfPol ist ein Institut, das seit Langem auf den Ausbau von Forschung, sowohl am Institut selbst als auch vor allem in der Drittmittelforschung setzt. Was waren die ersten großen Projekte, die am Institut betrieben worden sind? Was waren Ihre eigenen?
Unter den Forschungsprojekten war eine wichtige, eher atypische Kooperation mit den Kollegen der Universität in Twente, in der Sonderform eines gemeinnützigen Vereins EZK e.V.(= Europäisches Zentrum für Kriminalpolitik). Diese Kooperation führte zu einem von mir geleiteten Forschungsschwerpunkt Kriminalpolitik, auch verbunden mit enger Zusammenarbeit mit der damaligen Polizeiführungsakademie. Es herrschte ein sehr nettes persönliches Verhältnis auch der studentischen Mitarbeiter zu den Forschungseinheiten des BKA. Ein unvergessliches Erlebnis war, dass uns der Präsident des BKA zum Mittagsimbiss einlud und darauf bestand, dass neben ihm die Studentinnen und Studenten saßen.
Großprojekte mit der späteren Föderativen Universität in Rjasan (SPUR) waren der Aufbau eines politikwissenschaftlichen Studiengangs unter der Mitleitung von Herrn Kollegen Robert und eines Forschungszentrums für Europäisches Recht und Europäische Politik, das von den Kollegen Ehlers und Robert mitgeleitet wurde.
Praktisch haben wir neben diesen Projekten die erfolgreiche Beratung bei der Entwicklung der Föderativen Pädagogischen Hochschule zur Föderativen Universität Rjasan mitgeleistet, und zwar bis zur endgültigen Zertifizierung.
Es gab auch eine Forschungszusammenarbeit mit der sibirischen Tyumener Staatlichen Universität und der Tyumener Staatlichen Landwirtschaftsakademie. Auf der Basis meines Besuchs in Tyumen, zu dem ich vom Rektorat entsandt worden war, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu prüfen und auf Grund eines Gegenbesuchs des Rektorats aus Tyumen kam es im Bereich Landschaftsökologie zu der Bewilligung eines Großforschungsprojekts, gefördert mit mehreren Millionen Mark durch das damalige Bundesministerium für Forschung und Technologie.
Vielleicht darf ich sagen, dass natürlich bei diesen Forschungsprojekten sehr viele studentische und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt wurden.
Darüber hinaus ergaben sich auch viele Möglichkeiten für Praktika, sowie Lehrveranstaltungen durch russische Kollegen die zu Gegenbesuchen kamen bis hin zu der Tatsache, dass mehrere Kolleginnen, die schon in Russland ein fertiges Lehramtsstudium absolviert hatten, dann nach Münster kamen.