Wintervortragsreihe 2025/26
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den bisherigen Vorträgen des Wintersemesters 2025/26.
Eine Programmübersicht zur gesamten Vorlesungsreihe finden Sie hier.
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den bisherigen Vorträgen des Wintersemesters 2025/26.
Eine Programmübersicht zur gesamten Vorlesungsreihe finden Sie hier.
Zum ersten Vortrag der Wintervorlesungsreihe 2025/26 durfte das Institut für Arabistik und Islamwissenschaft Dr. Tobias Mörike vom Weltmuseum in Wien begrüßen. In seinem Vortrag mit dem Titel „Palästina in Dingen erfassen. Sammlungen der deutschen Palästinaforschung zwischen Bibel-Orientalismus und Frühzionismus“ zeigte er auf, wie Palästina ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Raum semi-kolonialer Verflechtungen wurde – geprägt durch das Deutsche Kaiserreich, das Osmanische Reich, Missionare und die freikirchliche Templerbewegung.
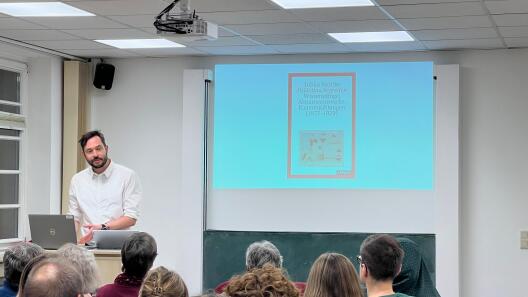
Mörike verdeutlichte, wie sich diese Dynamiken in den Forschungsaktivitäten der Zeit widerspiegelten: Botanische Sammlungen und Karten dienten nicht nur wissenschaftlichen Zwecken, sondern auch der Konstruktion von Raumerzählungen, die zunächst den Bibel-Orientalismus, später aber zunehmend imperiale Interessen reflektierten. Zugleich ging er der Frage nach, wie solche Erzählungen in frühzionistische Diskurse einflossen, die in dieser Zeit in Deutschland entstanden.

Im Bereich der Botanik etwa kursierte die These, Palästina sei zur biblischen Zeit stärker bewaldet gewesen, während die nomadische Bevölkerung für die Entwaldung verantwortlich gemacht wurde. Daran anknüpfende Aufforstungsprojekte zielten nicht nur auf die Wiederherstellung einer vermeintlich biblischen Landschaft, sondern auch auf deren wirtschaftliche Nutzbarmachung. Solche Maßnahmen fanden sich sowohl bei den Templern als auch später bei den Briten und schließlich im Jüdischen Nationalfonds wieder.
Im Bereich der Kartografie zeigte Mörike, dass deutsche Palästinakarten lange Zeit vor allem biblische Ortsbezeichnungen übernahmen und landwirtschaftlich nutzbare Flächen sowie Wasserläufe kartierten. Sie rezipierten dabei nicht die britische Palästinakarte von 1881, die erstmals auf trigonometrischen Daten basierte. Besonders prägend war die Karte Heinrich Kieperts, die ab 1913 zum offiziellen Dokument des Zionistischen Weltkongresses und zur hebräischen Schulkarte avancierte.
Abschließend betonte Mörike jedoch auch, dass sich einerseits auch Palästinenser als Wissensvermittler an diesen Projekten beteiligten und dass zugleich innerhalb zionistischer Kreise auch Kritik an der kolonial geprägten Wissensproduktion geäußert wurde.

Zum zweiten Vortrag der Wintervorlesungsreihe 2025/26 durfte das Institut für Arabistik und Islamwissenschaft Dr. phil. habil. Claire Gallien (Cambridge) begrüßen, die derzeit als Gastwissenschaftlerin am Institut weilt. In ihrem Vortrag bot sie Einblicke in ihre jüngst erschienene Monografie Reconfiguring and Appropriating Arabic, Persian, and Indic Literary Traditions in Seventeenth- and Eighteenth-Century Britain. Orientalism and the Recreation of the Islamicate Canon. Darin untersucht sie, wie arabische, persische und indische Literaturtraditionen in Großbritannien im 17. und 18. Jahrhundert ausgewählt, rekonfiguriert und angeeignet wurden.

Im Mittelpunkt ihres Vortrags standen dabei Prozesse der ‘Reformatierung’, die durch die Überführung solcher Texte in neue Wissenskontexte eintraten, etwa wenn sie als Beispielstellen in Grammatiken und Wörterbüchern, oder aber in Anthologien und Miszellen gesammelt, neu gruppiert und damit in neue Deutungshorizonte eingebettet wurden. Gallien argumentierte, dass die bisherige Forschung mit ihrem Fokus auf monografische Textausgaben dieses historische Zirkulationsgefüge bislang nur unzureichend erfasst habe. Erst durch die Betrachtung jener kleinformatigen, oft fragmentierten Wissensmedien lasse sich angemessen verstehen, in welcher Weise die Literatur der islamischen Welt in Europa präsent war.
Zugleich kritisierte sie ein Verständnis von orientalistischen Wissensformen als bloßer Repräsentation im Sinne Edward Saids. Stattdessen betonte sie, dass britische Orientalisten im 17./18. Jhd. keineswegs einfach einen „orientalischen“ Literaturkanon erfanden, sondern vielmehr durchaus solche Werke rezipierten, die – wie beispielsweise al-Ḥarīrīs Maqāmāt oder die Werke von Saʿdī – im arabischen und persischen Schrifttum bereits von Bedeutung waren. Rekonfigurationen entstanden vor allem durch die Anpassung an lokale kulturelle und ökonomische Bedingungen, etwa durch die Auswahl und Klassifikation von Werken, die an europäische Vorkenntnisse anschlossen und einen gewissen Verkaufswert erwarten ließen.