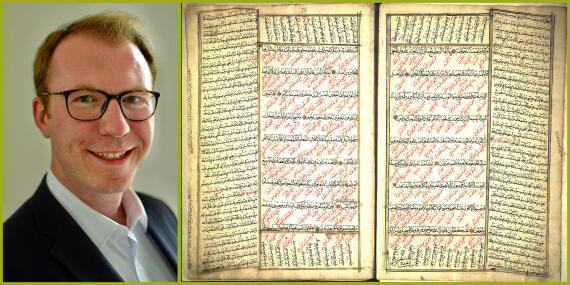Der Exzellenzcluster „Religion und Politik“, der 2007 eingerichtet wurde, untersucht noch bis 2027 das komplexe Verhältnis von Religion und Politik quer durch die Epochen und Kulturen. Im Zentrum des Interesses der rund 150 Forschenden aus 20 geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen stehen Europa und der Mittelmeerraum sowie deren Verflechtungen mit Vorderasien, Afrika, Nord- und Lateinamerika. Der Forschungsverbund ist der bundesweit größte dieser Art und unter den Exzellenzclustern in Deutschland der einzige zum Thema Religion. Seit seiner Gründung bearbeitet der Exzellenzcluster eine Vielzahl an historischen und gegenwartsbezogenen Themen von aktueller Relevanz. weiterlesen