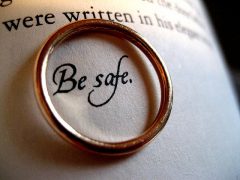Für den Monat Juni 2020 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Dr. Nils Opel aus dem Institut für Translationale Psychiatrie für die Publikation: Brain structural abnormalities in obesity: relation to age, genetic risk, and common psychiatric disorders in der Zeitschrift Molecular Psychiatry, published online: May 28, 2020 [Volltext]
Für den Monat Juni 2020 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Dr. Nils Opel aus dem Institut für Translationale Psychiatrie für die Publikation: Brain structural abnormalities in obesity: relation to age, genetic risk, and common psychiatric disorders in der Zeitschrift Molecular Psychiatry, published online: May 28, 2020 [Volltext]
Adipositas wird primär als kardiovaskulärer Risikofaktor angesehen, wohingegen die Rolle neurobiologischer Veränderungen bei Adipositas unklar bleibt. Ergebnisse erster Studien deuten auf hirnstrukturelle Veränderungen bei Adipositas hin. Welche Bedeutung hierbei Alter und genetisches Risiko spielen könnten blieb bisher unklar, ebenso ein möglicher Zusammenhang mit psychiatrischen Erkrankungen.
In der vorliegenden multizentrischen Studie, welche 6420 Probanden einschloss, konnte ein Zusammenhang zwischen Adipositas und hirnstrukturellen Veränderungen, insbesondere einer Reduktion der fronto-temporalen kortikalen Dicke zeigen. Das Ausmaß dieser hirnstrukturellen Veränderungen war mit denen bei neuropsychiatrischen Erkrankungen beobachteten Veränderungen vergleichbar und zeigte hinsichtlich des regionalen Verteilungsmusters große Ähnlichkeit mit affektiven Erkrankungen. Zudem zeigte sich, dass der Zusammenhang zwischen Adipositas und kortikaler Dicke vom Alter moderiert wurde, wohingegen das genetische Risiko für Adipositas einen regional spezifischen Zusammenhang mit kortikaler Oberflächenstruktur zeigte.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie untermauern die Bedeutung neurobiologischer Veränderungen bei Adipositas, welche weiterhin drastisch unterschätzt werden. Die aktuellen Befunde sollten Ärzte und Wissenschaftler dazu motivieren neurobiologischen Veränderungen bei Adipositas verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen.
Eine Liste aller bisherigen Gewinner der Paper of the Month – Auszeichnung finden Sie hier.
Der Paper of the Month – Aufsteller in der Zweigbibliothek Medizin bietet den Besuchern die Lektüre der Studie vor Ort an.
Foto: MFM/Christian Albiker

 Für den Monat Juni 2019 wurden Dr. Marcel Trautmann aus dem
Für den Monat Juni 2019 wurden Dr. Marcel Trautmann aus dem  Für den Monat März 2019 wurde Prof. Dr. Frank Rosenbauer aus dem
Für den Monat März 2019 wurde Prof. Dr. Frank Rosenbauer aus dem  Im Datenbank-Infosystem (
Im Datenbank-Infosystem (