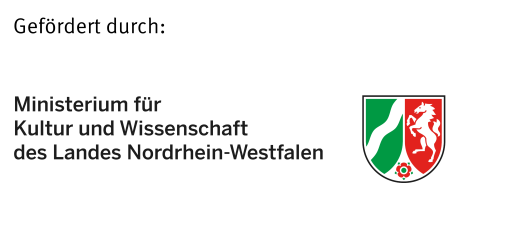Studie an Fischen zeigt verändertes Schlafverhalten durch Infektion

Das Phänomen ist bekannt: Wenn man nicht richtig schläft, wird man schneller krank. Umgekehrt beobachtet man, dass man bei einer Infektion anders schläft. Ein Team um Biologen vom Institut für Evolution und Biodiversität der Universität Münster hat nun untersucht, wie sich eine Infektion mit Parasiten auf das Immunsystem und auf das Schlafverhalten auswirkt – bei Dreistachligen Stichlingen, die mit ihrem natürlichen Parasiten, einem Bandwurm, infiziert waren. Ein Fazit: Infizierte Fische schlafen nach der Infektion länger als nicht infizierte Tiere. Allerdings beobachtete das Team diesen Unterschied erst einen Monat nach der Infektion. In den ersten Tagen gab es kaum Unterschiede. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, das Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Infektionen mit Makroparasiten, Schlaf und Immunantwort zu vertiefen.
Bauhus MB, Mews S, Kurtz J, Brinker A, Peuß R, Anaya-Rojas JM (2024): Tapeworm infection affects sleep-like behavior in three-spined sticklebacks. Scientific Reports 14, 23395. https://doi.org/10.1038/s41598-024-73992-7
Pressemitteilung der Universität Münster
Originalveröffentlichung in Scientific Reports