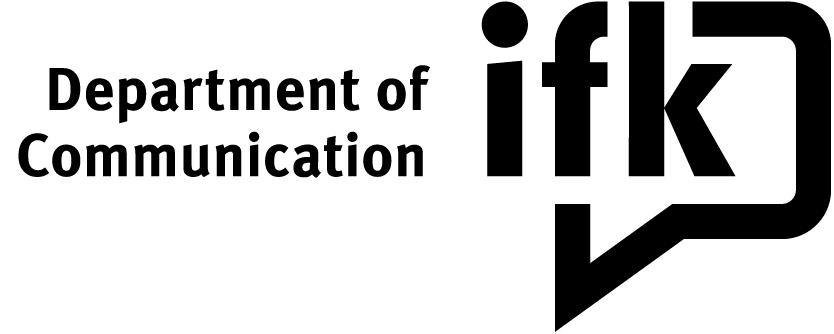Finished Research Projects
Kommunikation ändert sich stetig, besonders im Umfeld digitaler Kommunikation. Als neuster Trend lässt sich beobachten, dass Individuen und Organisation Kommunikation auf geschlossene Plattformen verschieben. Plattformen, die durch Zugangsbeschränkungen die Zahl der Kommunizierenden stark beschränken. Das Projekt „Community Management auf Closed-Media-Plattformen“ beleuchtet, wie Organisationen diese Form der Kommunikation nutzen.
Externe Dienstleister, wie Berater und Kommunikationsagenturen, spielen eine wesentliche Rolle für die Ausgestaltung und den Erfolg der strategischen Kommunikation von Organisationen. Doch wurde die Zusammenarbeit mit Dienstleistern bisher meist nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht erforscht. Daher mangelt es an theoretischen wie auch empirischen kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen um diese Kooperationen zu untersuchen. Um dieses Forschungsfeld zu erschließen, geht das Forschungsprojekt der Frage nach, wie sich die Zusammenarbeit von Kommunikationsabteilungen mit unterschiedlichen externen Dienstleistern aus dem Bereich der strategischen Kommunikation heute und in Zukunft gestaltet. Bedeutsam ist dabei insbesondere die Frage, welche Folgen veränderte organisationsinterne Strukturen der Koordination und Kooperation (Stichwort: Agilität) für die Strukturen und Prozesse der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern haben.
Die kommunale Kommunikation steht angesichts eines umfassenden Medien- und Öffentlichkeitswandels aktuell vor großen Herausforderungen: So ist beispielsweise die Anzahl der zu betreuenden Medienkanäle größer geworden und die zur erreichenden Zielgruppen sind diverser geworden. Auf Seiten der kommunalen Verwaltungen sind daher ein enormer Anstieg und eine zunehmende Ausdifferenzierung der Kommunikationsaktivitäten zu beobachten, so dass die Koordination der Kommunikation von Fachabteilungen und Schnittstellen eine wichtige Herausforderung der Gegenwart und Zukunft darstellt.
Ziel des Projekts ist es, einen umfassenden Überblick über aktuelle gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Trends und deren Einfluss auf die Unternehmenskommunikation zu geben. Im Fokus stehen dabei u.a. die Bedingungen, Formen und Folgen der qualitativ und quantitativ immer bedeutsamer werdenden digitalen Vernetzung. Im Rahmen des Projektes werden unterschiedliche disziplinäre Perspektiven zusammengeführt, um so ein vielschichtiges Bild der Treiber der Kommunikationslandschaft von morgen zu gewinnen.
Auf Basis eigener Vorarbeiten wird ein interdisziplinärer Vertrauensansatz für den Kontext der Sharing Economy abgeleitet und Vertrauen als Prozess aufgeschlüsselt, um folgende Forschungsfrage zu untersuchen: Welche Faktoren beeinflussen die Vertrauensprozesse in kollaborativen Beziehungen innerhalb der Sharing Economy? Von Interesse ist dabei insbesondere, welche Merkmale des Sharing-Economy-Anbieters bzw. des Austauschpartners vertrauenserweckend wirken und welches Bewusstsein die Nutzer für mögliche Risiken in der Sharing Economy haben. Ziel des Forschungsprojekts ist es, grundlegende Erkenntnisse über die Kommunikations- und Vertrauensprozesse in einer Sharing Economy zu gewinnen, da ein besseres Verständnis von Vertrauen der Schlüssel ist, um verbraucherschutzrelevante Erkenntnisse über die digitale Welt des Tauschens und Teilens zu erhalten. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Vertrauensprozesse in einer Sharing Economy können Verbrauchern Informationen liefern, um ihre Entscheidungs- und Handlungskompetenz in dem Bereich stärken und sich für mögliche Täuschungen und Missbrauch sensibilisieren zu können.
Ob Energiewende, Finanzkrise oder Billiglohn – Ausmaß und Ausgestaltung unternehmerischer Verantwortung sind ein Dauerthema öffentlicher Debatten und werden in Deutschland mit großer Skepsis gegenüber Unternehmen verfolgt. Die Glaubwürdigkeitszweifel deuten darauf hin, dass Erwartungsdivergenzen die Etablierung eines übergreifenden Verständnisses unternehmerischer Verantwortung verhindern. Während in der CSR-Forschung vor allem Idealvorstellungen diskutiert werden, bleibt weitgehend offen, wie Verantwortungsurteile im öffentlichen Diskurs faktisch zustande kommen. Dieser Frage widmet sich das Projekt, indem es das Zusammenspiel zentraler AkteurInnen und Anspruchsgruppen – Medien, BürgerInnen und Unternehmen – bei der Reproduktion und Institutionalisierung von Verantwortungsurteilen untersucht.
Erfolgsfaktoren der CR-Kommunikation. Eine qualitative Studie zur Kommunikation der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen in Deutschland
Projektlaufzeit: Juli 2013 – Mai 2014
Die Studie analysiert die strategische Implementierung und Kommunikation von Corporate Responsibility (CR) in Unternehmen und leitet daraus Erfolgsfaktoren der strategischer CR-Kommunikation abgeleitet werden. Grundlage bildet eine Befragung von CR- und Kommunikationsverantwortlichen von 13 Großunternehmen in Deutschland, bei der Anforderungen an und die Implementierung von CR-Kommunikation in Unternehmen untersucht wurden.
Im Mittelpunkt der Studie stehen die Führungspraxis, das Führungsverständnis und die aktuellen sowie zukünftigen Anforderungen an Führungskräfte im Kommunikationsmanagement im deutschsprachigen Raum. Sie ist Teil eines globalen Forschungsprojekts zum Leadership im Kommunikationsmanagement, das in 23 Ländern durchgeführt wird. Initiiert und gefördert wird das Projekt vom Plank Center for Leadership in Public Relations in den USA.
Die Studie besteht aus einer quantitativen Befragung von Führungskräften sowie ergänzenden qualitativen Leitfadeninterviews. Erste Ergebnisse der quantitativen Befragung in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen bereits vor.
Im Mittelpunkt des von der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts steht die PR-Beratung im Kontext der politischen Kommunikation.