„Unsere Forschung soll Patienten nutzen“
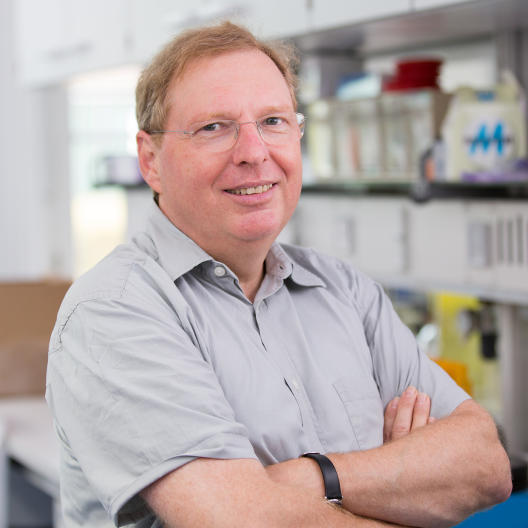
Herr Prof. Roth, mit welcher wissenschaftlichen Frage beschäftigen Sie sich aktuell?
In unserem Institut beschäftigen wir uns mit den Ursachen und Auslösern von Entzündungsreaktionen. Außerdem möchten wir herausfinden, was dazu führt, dass Entzündungen oft chronisch andauern. Unser Fokus liegt auf Zellen des angeborenen Immunsystems, den Phagozyten. Das sind Zellen der ersten Infektabwehr, die zum einen Krankheitserreger erkennen, sie wie eine Hülle umschließen und „auffressen“. Wenn sie unkontrolliert aktiviert werden, sind sie auf der anderen Seite auch für viele Erkrankungen verantwortlich. Wir sehen uns Entzündungsprozesse auf molekularer Ebene an und haben bereits Moleküle identifiziert, die Entzündungsreaktionen auslösen und verstärken. Sie gehören zu der Proteingruppe der sogenannten Alarmine. Wir versuchen außerdem, die klinische Relevanz unserer Daten in verschiedenen Erkrankungen aufzuzeigen. Zu diesen Erkrankungen gehören zum Beispiel die rheumatoide Arthritis genauso wie Infektionen, entzündliche Darmerkrankungen oder Allergien. Darüber hinaus interessieren wir uns auch für sehr selten vorkommende Krankheiten, zum Beispiel sogenannte autoinflammatorische Erkrankungen. Das sind schwere chronische Entzündungen ohne nachweisbare Ursache, die bereits im Kindes- und Jugendalter auftreten können.
Was macht Sie als Wissenschaftler persönlich aus?
Ich denke, meine Arbeitsgruppe und mich macht besonders aus, dass wir unsere Wissenschaft – auch wenn wir uns mit Grundlagenmechanismen beschäftigen – immer sehr patientenorientiert ausrichten. Diese Art von Arbeit hat mich schon immer interessiert. Schon bei der Studienwahl war ich unschlüssig, ob ich in die Naturwissenschaften oder in die Medizin gehen soll. Ich habe erst Chemie studiert, mich dann aber für ein Medizinstudium entschieden und nach meinem Abschluss jahrelang parallel als Kinderarzt und als Grundlagenforscher gearbeitet. Dann habe ich mich komplett auf die Wissenschaft konzentriert.
Was ist Ihr großes Ziel als Wissenschaftler?
Mein Wunsch ist es, Mechanismen zu entdecken und Methoden zu entwickeln, die in der Klinik zu diagnostischen oder therapeutischen Verfahren führen – unsere Forschung soll Patienten nutzen. Und da liegt meine wesentliche Motivation in der Untersuchung seltener entzündlicher Erkrankungen. Zum einen habe ich während meiner Arbeit in der Klinik gesehen, wie sehr diese schwerwiegenden Erkrankungen die Lebensqualität von Patienten einschränken. Zum anderen werden seltene Krankheiten häufig vernachlässigt, und es gibt einen deutlichen Nachholbedarf in der Forschung. Außerdem sind die molekularen Mechanismen, die dahinterstecken, wissenschaftlich sehr interessant und oft auch für häufig vorkommende Erkrankungen relevant.
Erinnern Sie sich an Ihren größten Glücksmoment als Wissenschaftler?
Es gab viele besonders schöne Momente in meiner wissenschaftlichen Karriere. Einer war mit Sicherheit die Zeit, als wir einen Biomarker entwickeln konnten, der es möglich macht, die Systemische juvenile idiopathische Arthritis – eine autoinflammatorische Erkrankung bei Kindern – besser zu diagnostizieren. Das hat letztendlich dazu geführt, dass man bei diesen schwer kranken Kindern mittlerweile eine viel schnellere und gezieltere Therapie anwenden kann. Früher dauerte das oft Wochen oder Monate.
Und wie sah Ihr größter Frustmoment aus?
In der Wissenschaft gibt es häufig Situationen, in denen Dinge nicht klappen. Aber das ist nicht wirklich frustrierend, denn das gehört dazu. Frustrierend ist eher die zunehmende Verwaltungsbürokratie, mit der wir als Wissenschaftler täglich zu tun haben – was sich nicht nur auf unseren Alltag, sondern auch auf unsere Forschung im Gesamten auswirkt. Leider schreckt diese Entwicklung auch zunehmend junge Mitarbeiter ab, in der Wissenschaft zu bleiben.
Welches wissenschaftliche Phänomen begeistert Sie heute noch regelmäßig?
Am meisten fasziniert mich die Fähigkeit unseres Körpers, ganz alleine Entzündungen zu regulieren. Ein normaler entzündlicher Prozess im Körper hört ja von selbst wieder auf. Wenn wir verstehen würden, welche Mechanismen dahinterstecken, könnten zukünftige Therapien viel effizienter und mit weniger Nebenwirkungen gestaltet werden. Aber wir müssen natürlich zuerst die entsprechenden Regulationsmechanismen verstehen, um sie in einem weiteren Schritt therapeutisch umsetzen zu können.
Wie viel Kunst, Kreativität und Handwerk steckt in Ihrer Wissenschaft?
Ich finde, der Begriff „Kunst“ ist in Zusammenhang mit Wissenschaft etwas zu groß. Kreativität und Handwerk dagegen sind sicherlich die entscheidenden Dinge, die Wissenschaft ausmachen und mit denen wir täglich zu tun haben. Kreative Gedanken in das Handwerk, also in experimentelles Handeln, umzusetzen – das ist meiner Meinung nach letztendlich das Schwierige, aber auch das äußerst Reizvolle am wissenschaftlichen Arbeiten.

