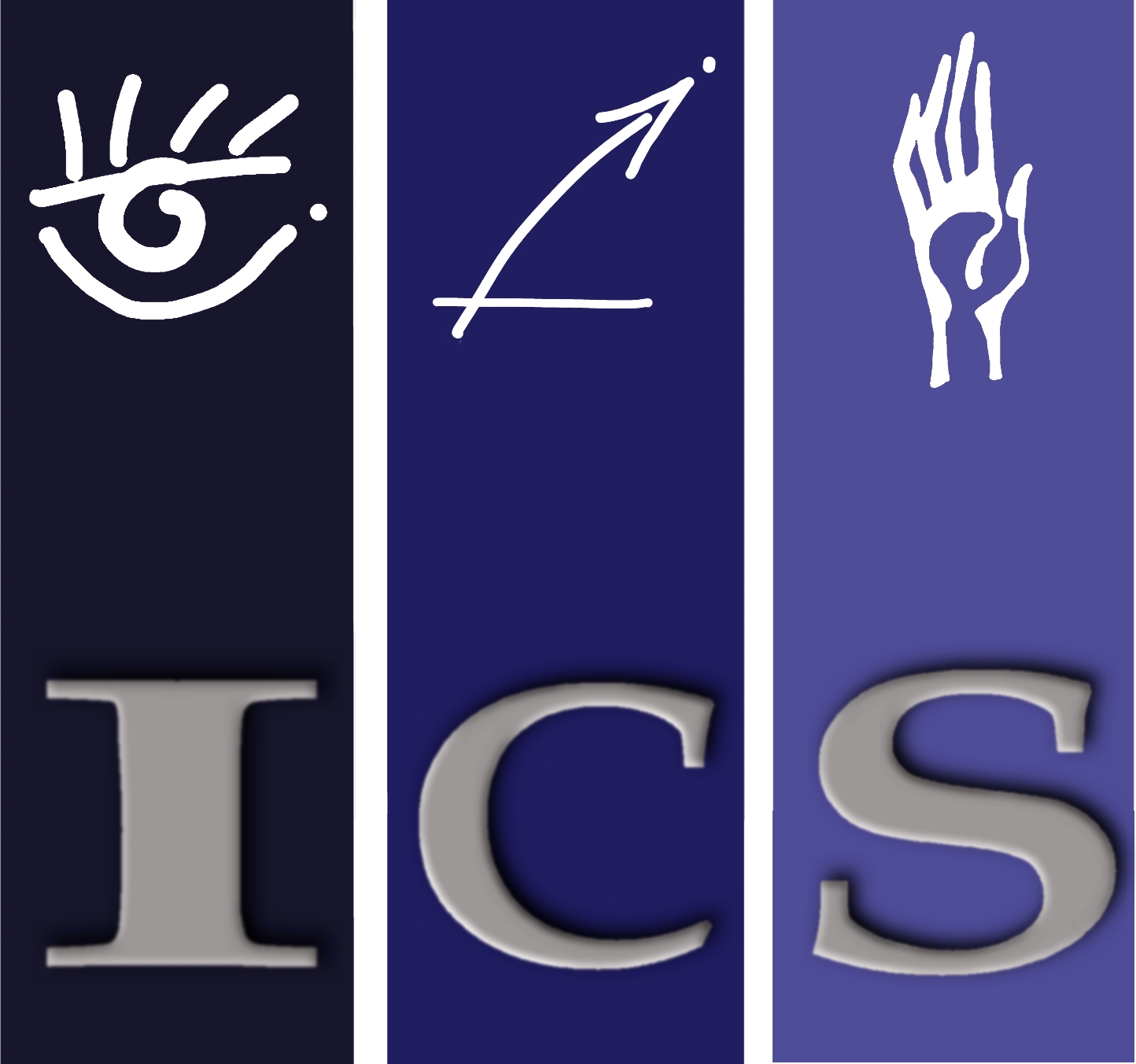Zum Tod von Papst Franziskus – sozialethische Aspekte des Pontifikats
Papst Franziskus wird Vielen zuerst mit seinen einfachen und bewegenden Gesten, mit seiner Nähe zu den Menschen, vor allem zu den Notleidenden, in Erinnerung bleiben. Bereits mit seinem ersten Auftritt als Papst hatte er den für sein Pontifikat charakteristischen neuen Ton gesetzt, als er sich ohne Prunkgewand als "Bischof von Rom" den Gläubigen zeigte, schlicht "Guten Abend" sagte und die Gläubigen bat, für ihn den Segen Gottes zu erbitten, ehe er sie selbst segnete. Bereits in diesem Moment kündigte er an, mit den Gläubigen auf einen "Weg der Geschwisterlichkeit" gehen zu wollen. Die Symbolik des Anfangs weckte Erwartungen an eine Erneuerung der Kirche "von oben" und "von innen" – und an eine andere Theologie als jene, für die sein Vorgänger Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI. gestanden hatte.
Papst Franziskus hat in den zwölf Jahren seines Pontifikats die Aufmerksamkeiten in der Weltkirche verschoben und beachtliche Schritte hin zu einer synodalen Kirche eingeleitet. Kaum erstaunlich, sind Ungleichzeitigkeiten und Kontroversen in der Weltkirche – und auch die Grenzen, an die das Papstamt selbst darin stößt – im Moment von Franziskus‘ Tod sichtbarer und spürbarer als zu Beginn seines Pontifikats: Solange der kirchliche "Apparat" Einheit als Uniformität einfordert und die weltkirchliche Vielfalt inkulturierter Katholizität dem Erwartungsrahmen römischer Ordnungen unterordnet, droht das "Amt der Einheit" überfordert zu werden. Papst Franziskus hat der Kirche mit dem anspruchsvollen Programm der Synodalität eine Therapie verordnet, die gerade erst anfängt zu wirken – und es wird vom nächsten Pontifikat abhängen, ob die Kur nachhaltige Wirkung entfalten kann.
So kann es nicht erstaunen, dass das Franziskus-Pontifikat gerade im Blick auf den Zustand der Kirche ein ambivalentes Bild hinterlässt: Auch wenn pastorale Handlungsräume gegenüber vermeintlich unveränderlichen Lehrpositionen ansatzhaft geöffnet wurden, sind schmerzhafte Konflikte nicht gelöst. Menschen, denen ihre Zugehörigkeit zur Kirche wichtig ist, werden weiterhin marginalisiert und mit kruden Auffassungen eines ideologischen Anti-Genderismus disqualifiziert, weil sie nicht in das heteronormative Gefüge lehramtlicher Beziehungsmoral passen. Zeichen pastoraler Öffnung, die Franziskus immer wieder gegeben hat, konnten angesichts des Zustands der Institution, für die er verantwortlich war, vielfach nur als schwache Gesten, als paternalistische Herablassung wahrgenommen werden. Seine Kritik des Klerikalismus schien im Dickicht des ungebrochenen monarchischen Habitus stecken zu bleiben, den auch er als Papst nicht konsequent abgelegt hat.
In die Weltöffentlichkeit hinein hat Franziskus vor allem mit seinen sozialethischen Interventionen gewirkt. Ein Höhepunkt war ohne Zweifel die Enzyklika Laudato si‘ im Jahr 2015, mit der er gezielt in die klimapolitischen Prozesse der Internationalen Gemeinschaft hineingesprochen hat, den unlösbaren Zusammenhang zwischen der globalen ökologischen und der ebenso globalen sozialen Frage unterstrichen und die unterschiedlichsten Akteure zu koordinierter Verantwortungswahrnehmung ermutigt hat. Der Versuch und die Bereitschaft, möglichst breite Allianzen zu schmieden, um Veränderung möglich zu machen, prägte auch die nachfolgende Sozialenzyklika Fratelli tutti, die vor allem auf einen verantwortlichen Umgang mit den Gütern der Erde im Sinne des globalen Gemeinwohls zielte.
Der Name Franziskus wird sich auf Dauer mit einer entschiedenen Option für die Armen und für den Schutz der geschundenen Erde, mit dem Plädoyer für aktive Gewaltfreiheit und für die Rechte der Menschen auf der Flucht und in der Migration verbinden. Damit hat Franziskus politische, religiöse und mentalitätsbasierte Grenzen überschritten, an deren Befestigung andere Akteure – innerhalb wie außerhalb der Kirche – nach Kräften arbeiten, und gesellschaftsverändernde religiöse Potentiale weltweit gestärkt.
Leitmotiv "Geschwisterlichkeit"
In der Theologischen Literaturzeitung (ThLZ) ist kürzlich ein Beitrag von Marianne Heimbach-Steins zur Theologie und Ethik von Papst Franziskus unter dem Titel "Leitmotiv 'Geschwisterlichkeit'" erschienen. Den Beitrag können Sie sich hier herunterladen.