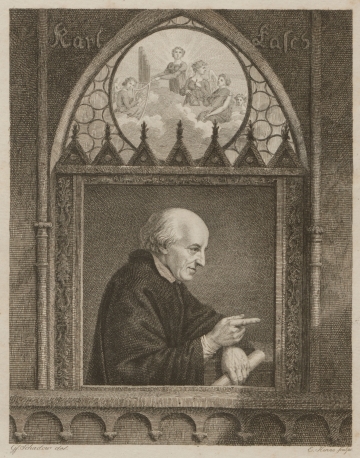Einführung
Karl Friedrich Zelter
Karl Friedrich Christian Fasch
Berlin 1801
Einführung
Unter den frühen Quellen zur Geschichte der Sing-Akademie zu Berlin nimmt Karl Friedrich Zelters Biographie des Vereinsgründers eine hervorragende Stellung ein. Man begegnet mit ihr der frühesten Musikerbiographie im deutschen Sprachraum überhaupt. Als solche war sie das prägende Vorbild der ungleich berühmteren Bach-Biographie Johann Nikolaus Forkels. Der Text ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1801 als Zentraldokument zur Gründungsgeschichte der Sing-Akademie rezipiert und ausgewertet worden. Dennoch erlebte er selbst nur geringe wissenschaftliche Durchdringung und wurde auch nur ein einziges Mal als fotomechanischer Reprint wiederveröffentlicht, allerdings ohne Einleitung und Kommentar. Im Folgenden wird der wissenschaftlichen Öffentlichkeit erstmals eine Transkription mit anhängendem Zeilenkommentar zur Verfügung gestellt.
In der folgenden Einführung wird daher ausführlich auf Zelters Intentionen eingegangen. Sein literarischer Erstling, seinem verehrten Lehrer gewidmet, erschien nämlich zu einem sehr bestimmten Zweck, der die Gesetze der Darstellung wesentlich bestimmt. Lässt man, wie es die bisherige Rezeptionsgeschichte des Textes gezeigt hat, diese Intentionen bei dem Studium dieser singulären Quelle außer Acht, wird es schwierig, die hochgradig stilisierten, zu einem Typus inszenierten Züge, die Fasch in diesem Bild annimmt, von den sichereren Fakten zu scheiden. Damit ist nicht gesagt, dass Zelter bei seiner Darstellung einen sorglosen Umgang mit der Wahrheit gepflegt hätte. Aber, und das mag angesichts der vorwiegend biographisch-wissenschaftlichen Ausdeutung des Textes erstaunen, ist Zelters Schrift eher künstlerischen als frühen musikphilologischen Gesetzen unterworfen. Dies lässt sich am ehesten nachweisen, wenn man eingangs das Publikum dieser Biographie ins Auge fasst.
Zelter verfasste seine Biographie sehr zeitnah. Fasch war am 3. August 1800 gestorben. Schon im April 1801 konnte ein Exemplar an Goethe versandt werden, mit dem Zelter seit August 1799 in einem noch relativ lockeren brieflichen Kontakt stand, der später zu einem der bedeutendsten Briefwechsel der deutschen Literaturgeschichte anwachsen sollte. Auch wenn der Text die Gattungskonventionen eines Nekrologs in keiner Form erfüllt, suggeriert Zelter seinen Lesern, er habe an eine Art "Tombeau" oder "Denkmal" gedacht und baut eine vermutlich erfundene Episode ein, um diese Motivation in Faschs Denken selbst zu verankern. Er schildert einen Spaziergang über einen "Begräbnißplatz" in Potsdam.[1] ) Auf Zelters geringschätzige Bemerkung über die handwerkliche Wertlosigkeit der Grabmäler entgegnete der Ältere:"Ach! [...], so vergänglich und schlecht diese Sachen immer seyn mögen, so haben sie doch einen unschätzbaren Werth in der Verehrung derjenigen, die sich das Andenken an geliebte Personen [...] zu verlängern suchen; [...] allein, wo ist, der mein gedenkt, wenn ich hier bin?"[2]
Schon diese kleine Episode ist kunstvoll-rhetorisch komponiert. Natürlich kann man Zelters Bemerkung über die Wertlosigkeit der Denkmäler als Kunstwerke als eine Art captatio benevolentiae lesen, denn hier ist er es ja, der Fasch ein Denkmal setzt, sei es auch ein Literarisches. Fasch selbst legitimiert sodann seinen Zweck jenseits ästhetischer Ansprüche; auch dies kann man als eine Art Rechtfertigung lesen. Die abschließende Frage nach demjenigen, der ihm ein Denkmal setze, mutet fast schon plump an und belegt den apokryphen Charakter dieser Zeilen nachdrücklich. Allein die Existenz des Büchleins beantwortet die Frage nach dem "Erbauer" des Denkmals hinlänglich. Goethe antwortete am 29. Mai mit dem passenden Terminus auf die Übersendung des Druckes:
"Sie haben durch das Denkmal, das Sie Faschen errichtet, ein sehr verdienstliches Werk vollendet und auch mir dadurch recht viel Vergnügen gemacht."[3]
Dass Goethes Urteil gemessen an der Qualität des Textes, der nun keineswegs "schlecht" geraten war, einigermaßen lau, ja fast abweisend ausfiel, hat seine Gründe, über die noch zu sprechen sein wird.
Weniger als ein Jahr nach dem Tod Faschs kam es zu einer bemerkenswerten Vorlesung vor den Mitgliedern der Sing-Akademie. Zelter berichtete Goethe davon 30 Jahre später, im Kontext einer sehr vielsagenden Reflexion über Dichtung und Wahrheit:"Als ich meinen Fasch geschrieben hatte, den ich freilich von Herzen liebte, las ich das Manuskript gleich nach seinem Tode in der Singakademie, vor mehr als 100 Mitgliedern ab, die den Guten mehr oder weniger im Leben wandeln gesehn."[4]
Zelter bat das Plenum dabei um Kritik und Anregung. Viele der Zuhörenden hatten Fasch seit 1791 gekannt. Eine literarisch allzu freie Gestaltung hätte sich der Verfasser vor diesem Hörerkreis also kaum gestatten können. Es wäre allerdings eigentümlich, hätte er diese Lesung nur anberaumt, um seinen Text einer Wahrheitsprobe zu unterziehen, nach der man ihn, was die biographischen Umrisse und die Grundhaltung Faschs gegenüber musikästhetischen Fragen angeht, als zuverlässig betrachten könnte.
Natürlich gab es eine gleichsam vereinspolitische Intention, die sich aus einer weiteren Briefpassage ableiten lässt:"Als die Schrift gedruckt erschien fand ich die ältesten Freunde die Faschen vor mir gekannt, mit ihm getrunken, geraucht und politisch verkehrt hatten in Verwundrung, ihren muntren Alltagsgesellen als einen ernsthaften tiefen hocherwachsnen Künstler zu schauen."[5]
Um den verborgenen Sinn dieser Sätze zu entschlüsseln, sollte man sich vergegenwärtigen, wie ungefestigt die Position Zelters als Nachfolger Faschs noch war. Es galt, sie zu legitimieren. Das exklusive Wissen um verborgene Wesenszüge des Stifters konnte ihm einen uneinholbaren Vorsprung vor den Weggefährten sicherten. Kannten die gewöhnlichen Mitwirkenden nur die oberflächliche Fassade dieses Lebens, sollten sie empfinden, dass allein Zelter Fasch in seiner geistigen Tiefendimension erkannt habe. Es ist nützlich, schon in dieser Denkfigur die Parallele zur oft umkämpften Nachfolge von Religionsstiftern zu sehen. In der Sing-Akademie hatte sich Zelter damit die Deutungshoheit über die Ursprünge des Vereins gesichert. Aber sie sollte nicht auf diesen engen Kreis begrenzt werden. Hier liegt einer der Publikationsgründe.
Der symbolische Adressat war kein geringerer als Goethe. Dieser dritten Intentionsebene ist der literarisch ambitionierte Charakter des Textes geschuldet. Aber während er, wie bereits angedeutet, bei Goethe nicht auf Gegenliebe stoßen konnte, ist die weitere Rezeptionsgeschichte beachtlich. Ein Forkel musste sich ihm bei der Arbeit an seiner Bach-Biographie stellen, und als Fundament aller späteren Studien über die Sing-Akademie ist der Text, teilweise wortwörtlich, bis in unsere Zeit gewandert. Wer sich mit Fasch befassen wollte, musste es durch Zelters Augen tun.
Es gibt verschiedene erzählerische Strategien und Techniken, derer sich Zelter bedient, um "seinen" Fasch zu erfinden. Jede ist es wert, gesondert betrachtet zu werden, denn jede führte später ein Eigenleben. Die Gattungsfrage ist daher komplizierter, als es eine so knappe Schrift eines Autodidakten erwarten ließe. In formaler Hinsicht changiert dieser Text, der von Anfang an Format und Anspruch eines Nekrologes überschritt, zwischen einem negativen Bildungsroman, der in einem erstaunlichen Maße von pathographischen Zügen durchwoben ist, und einer Hagiographie, die im Erzählerischen deutlich ihren heilsgeschichtlichen Hintergrund durchscheinen lässt.
Als Verknüpfung eines negativen Bildungsromans mit einer Art Pathographie ist Zelters Text überaus avanciert. Das Studium der physisch-psychischen Krankheit als prägender Kraft künstlerisch-intellektueller Entwicklung hat erst mit der Person Nietzsches ihren gültigen Gegenstand gefunden – es ist erstaunlich und kaum zu beantworten, wie Zelter zu dieser in der Biographik seiner Zeit ungewöhnlichen "pathographischen" Perspektive gelangte. Ein pauschaler Verweis auf den Anton Reiser von Carl Philipp Moritz erklärte dieses Phänomen kaum, zu wesentlich sind die Differenzen zwischen Moritz’ autobiographisch inspirierter und in ein exemplarisches, dilettantisches Scheitern getriebener Gestalt und Zelters psychologisch nicht minder komplexen Studie einer realen, respektierten Künstlerpersönlichkeit.
Im Folgenden seien einige markante, die Bereiche von Krankheit und Kunst kontrapunktisch verwebenden Passagen der Zelterschen Darstellung aufgesucht."Von der Wiege an schwächlich [...] neigte sich der erwachende Geist des Kindes unvermerkt zur Spekulation."[6]
Schon diese Einführung verknüpft Aussagen über die physische Verfassung mit ihren geistigen Folgen. Der Begriff der "Spekulation" deutet auf jene durchaus ambivalenten Fähigkeiten Faschs, dessen kontrapunktische Künste bewundert wurden, der sich jedoch ebenso in wunderlichen Zahlenoperationen erging. Zelter führt seine beiden Motive in strengem Kontrapunkt:
"Sein Leben schwankte zwischen körperlicher Schwäche und Seelenkraft einher, wo immer eines das andere lähmte, und in diesem Zustande schränkte er seine einsame Thätigkeit allein auf seinen Erwerb und nebenher auf eine Menge kleiner Beschäftigungen und Abendbesuche ein, die wenigstens seinen Geist munter erhielten."[7]
Diese "kleinen Beschäftigungen" konnten bizarre Züge annehmen. Berühmt ist das Kartenhaus, ein Gegenstand, dessen symbolisches Potential Zelter dankbar ausschöpfte – das überaus treffliche Sinnbild einer instabilen und ephemeren Existenz, die vom Einsturz bedroht ist. Trotz "Blutsturz" war Fasch unaufhörlich mit der "Erfindung" seines Daches beschäftigt.[8] Darüber hinaus reichen seine Beschäftigungen vom Legen komplexer Patiencen bis zur Verbesserung von Atlanten. Hier ist man nicht mehr weit entfernt vom mürben Dilettantismus eines Künstlers ohne Kunst wie Christian Buddenbrook, der sich dem Verbessern von Wörterbüchern widmete. Man begegnet dem Portrait eines Neurotikers, und es ist bezeichnend, dass Zelter Faschs Hauptkunst, die eminente kontrapunktische Tüftelei, exakt in diesem Themenfeld zwischen Rechenexempeln, Patience und Kartenhäusern ausführt und damit zweifellos diskreditiert.[9] Eine musikalische Praxis, die allein in diesem "spekulativen" Umfeld gedeiht, erscheint ihm zutiefst fragwürdig.
Vor allem der hinschwindenden Physis Faschs wegen ist diese kauzige "vita passiva" in völliger Obskurität ein Ort ohne Ausweg:"Sein schwacher Körper fühlte frühe die Vorboten des Alters, und an ein weiteres Fortkommen war deswegen nicht mehr zu denken."[10]
Das Leben der äußeren Welt erlischt um den erst 42-jährigen Protagonisten, erzählerisch öffnet sich an diesem Punkt der Lebensbeschreibung die Bühne für die ungewöhnlich breite Darstellung einer über zwanzigjährigen Agonie. "So war er fast jede Nacht dem Tode nahe",[11] heißt es nun, und das gilt für das ganze weitere Leben und mündet in ein achtseitiges, gleichsam klinisches Protokoll des Sterbens, dessen Gewicht und Dimension die Proportionen dieses knappen Lebensberichtes zu sprengen scheinen. Auch erzählerisch kostet Zelter den Komplex der Todesmotivik weidlich aus. So erfahren die Leser ausführlich von Faschs Maßnahmen gegen das gefürchtete Lebendigbegrabenwerden. Um den Willen seines Lehrers zu erfüllen, ließ Zelter Fasch drei Tage unbestattet, "bis die augenscheinliche Verwesung eintrat."[12] Gelegentlich malt Zelter die Schrecken dieses Verfallsprozesses in regelrecht schauerromantischen Farben, etwa in der Anekdote vom "scheintoten" Fasch. Seine Bedienstete fand ihn eines Nachts "starr und sprachlos":
"Das Mädgen nahm in der Bestürzung ein Glas Wasser, das vor dem Bette stand und goß es dem halb todten Manne ins Bette. Darüber sprang er auf, lachte entsetzlich und das Mädgen entfloh vor Schreck."[13]
Dieses "entsetzliche Lachen" scheint bereits der höllischen Fantasie eines E.T.A. Hoffmann zu entspringen. Es ist diese schwarzhumoristische Zuspitzung, die Goethe zutiefst abgestoßen haben dürfte. Dem Hauptmotiv der Entelechie in seinem Bildungsdenken wird hier ein Negativ gegenübergestellt. Der gesamte Bildungsgang Faschs, wie ihn Zelter nachzeichnet, ist geprägt vom Schwinden der Lebenskräfte und vom Erstarken des Todes. Wenn man bedenkt, dass Zelters Bildbeschreibung der Höllenfahrt Judas Ischariots drei Jahre später, die in deutlich weniger grellen Farben gehalten war, fast den Abbruch des Weimarer Briefwechsels zur Folge gehabt hätte, mag man sich wundern, dass es nicht schon 1801 zu einer ernsten Mahnung Goethes gekommen war.[14] Zelters Fasch trägt die Zeichen eines aus dem Gleichgewicht geratenen, letztlich pathologischen Charakters, wie ihn romantische Autoren zu kultivieren liebten. Das lag nun freilich nicht in Zelters Absicht. Eine besondere Affinität zur Berliner Frühromantik kann man ihm nicht nachweisen. Da sich allerdings seine späteren Ausführungen zu diesem Thema im Goethe-Briefwechsel finden, ist hier kein endgültiges Urteil zu fällen. Zelter hatte später sehr wohl gelernt, seinem erhabenen Briefpartner unbequeme Ansichten zu ersparen. 1801 verfügte er über dieses Differenzierungsvermögen noch nicht.
Zelters Beschreibung eines physisch verkümmernden, psychologisch ins Wunderliche abgleitenden Lebens dient vielmehr einem übergeordneten dramaturgischen Zweck. Die Kräfte physischen Verfalls hatten Zelters Fasch in einem falschen künstlerischen Bewusstsein stagnieren lassen, seine überwiegend abstrakte, kombinatorische Kunstübung war mit eigentümlichen Spekulationen und Wunderlichkeiten kontaminiert. In diese perspektivlose Situation schlägt ein Ereignis ein, das einem Bekehrungserlebnis gleicht:"Im Jahre 1783 kam der Königl. Kapellmeister Reichardt aus Italien zurück und brachte unter andern musikalischen Seltenheiten eine Sechzehnstimmige Messe des Orazio Benevoli mit, die er Faschen sogleich mittheilte. Dieser schrieb sich die Partitur ab; eine Menge der sonderbarsten Schreibfehler, die verbessert werden mußten, lenkten die Aufmerksamkeit nach und nach tief in das Werk hinein."[15]
Hier wird auf sehr subtile Art und Weise der Umschlag vom "falschen" ins "richtige" künstlerische Bewusstsein gestaltet. So entzündete sich Faschs Interesse zunächst an der Verbesserung der "sonderbarsten Schreibfehler" – ein Handeln, das noch der unfruchtbar-technischen Sphäre der Verbesserung von Landkarten angehört. Doch die künstlerische Vorlage, in die er immer tiefer eindrang, erweckte einen erneuerten Schaffenstrieb, wobei das Bewusstsein der Todesnähe eine besondere Dringlichkeit geschaffen habe:
"Er glaubte sein Ende nahe und wollte nebenher, wo möglich, ein Werk hinterlassen, woraus vielleicht einmahl wieder nach 170 Jahren irgend ein Kenner sehen möge, daß es um diese Zeit noch einen deutschen Harmonisten gegeben, der sich an den sechzehnstimmigen Satz gewagt und ihn bestanden habe"[16]
Es wird seine eigene Sechzehnstimmige Messe. Ihre Komposition markiert einen quasi-religiösen Wendepunkt, der Bruch mit dem alten Dasein wird symbolisch vollzogen:
"Ein ganz neues Leben ging demungeachtet für ihn an. Nur sein Leiden konnte ihn noch an den Tod erinnern. Alle seine Spielsachen wurden zerstört und dem Feuer überantwortet."[17]
Diese Lebenszäsur ist ein umwälzendes Ereignis. Verglichen mit der fein gezeichneten Schilderung des bisherigen Lebensweges ist der Umschwung allerdings eigentümlich knapp behandelt. Als quasi-religiöses Geschehen bedurfte sie in Zelters Argumentationslinie indes auch keiner rationalen Erklärung. Dabei ist gerade an diesem Punkt das Geflecht historischer und musikästhetischer Einflüsse besonders dicht. Daher scheint es ratsam, an dieser Stelle den Gang der Zelterschen Argumentation kurz zu verlassen. Sein äußert stringent entfalteter Plan, Faschs Leben zu erzählen, musste, um literarisch quasi zu "funktionieren", mit Auslassungen und Ausblendungen operieren. Zelters Erzählung inszeniert den "Einschlag" der Messe Benevolis in ein Leben obskurer Zurückgezogenheit und vollständigen physischen Zerfalls als eine Art Epiphanie. Damit individualisiert der Autor das Ereignis aufs äußerste und vollzieht eine Art Gattungs-Bruch, um nunmehr in das Genre einer Heiligenvita einzutreten. Die musik- und sozialhistorische Situation, in die Faschs Leben eingebunden war, ist vollkommen ausgeblendet.
Man kann diese Situation tatsächlich als eigenartig bezeichnen, und ihre Rückwirkungen auf das Berufsfeld des Musikers sind evident. In der frühen friderizianischen Epoche konnte das Berliner Musikleben als fortschrittlich gelten. Schon 1749 kam es zur Gründung einer "Musikübenden Gesellschaft", 1763 folgten die "Liebhaberkonzerte" des Cembalisten Ernst Friedrich Benda, halböffentliche Veranstaltungen, in denen sich zeittypisch Gattungen und Genres vom Instrumentalen bis zum Oratorium durchmischt fanden. Zugang hatte man allerdings nur, wenn man durch eine Vertrauensperson eingeführt wurde. Das erste im regelrechten Sinne öffentliche Konzert fand in Berlin erst 1787 statt – folgt man der Definition, eine solche Veranstaltung habe einem anonymen Publikum offen zu stehen, unternehmerisch organisiert zu sein, Eintrittsgeld zu verlangen, ein festgelegtes Programm und gesonderte Platzierung der Ausführenden aufzuweisen. Es war Johann Carl Friedrich Rellstabs Konzert für "Kenner und Liebhaber". In Leipzig dagegen war aus bürgerlichem Gemeinsinn schon 1747 ein kleines Orchester, das "Große Concert" geschaffen worden, dessen Subskriptionskonzerte der interessierten Bürgerschaft unbeschränkt offen standen. Und der Erfolg war beachtlich, man spielte im Winterhalbjahr wöchentlich, im Sommer zweiwöchentlich. In Preußen schein sich die Situation dergestalt potenziert zu haben, dass zu der generellen Agonie höfischer Musikpflege die unmittelbaren Folgen des siebenjährigen Krieges und nicht zuletzt die eigenwillige Gestalt des Monarchen selbst hinzutraten. Kurzum: der wundersame Rückzug eines weiterhin besoldeten Berufsmusikers aus allen öffentlichen Betätigungsfeldern – sieht man vom Unterrichten ab – hätte sich in dieser Form in Leipzig oder Hamburg kaum ereignen können, es sei denn, man spräche von einem ganz und gar psycho-pathologischen Phänomen. In Berlin wären dagegen auch einem völlig gesunden Komponisten alle Auswege versperrt gewesen: bot der spätfriderizianische Hof nicht die geringsten Perspektiven, war ein Übertritt vom höfischen ins kirchliche Berufsfeld im Gegensatz zu Hamburg keine Option – die Verfallenheit und Unterfinanzierung der Kirchenmusik in Preußen ist dokumentiert und sollte in Zelters Denkschriften, 20 Jahre später, ein Schlüsselrolle spielen. Ein Übertritt in eine funktionierende bürgerliche Sphäre, wie sie etwa in Leipzig existierte, war ebenfalls unmöglich – es gab sie nicht. Möglicherweise ging Zelter davon aus, dass den sing-akademischen Zuhörern seines Vortrages und den Lesern diese Verhältnisse durchaus vertraut waren; die der spätfriderizianische Epoche lag noch nicht lange zurück, und die Rezeption von Zeitschriften dürfte dem gebildeten Bürgertum Berlins seine musikkulturelle Verspätung deutlich vor Augen geführt haben.
Die von Zelter ebenfalls ausgeblendeten musikästhetischen Faktoren im Umfeld der "Bekehrung" Faschs dürften dagegen nicht einmal einem Goethe geläufig gewesen sein. Das erwachende Interesse Faschs an einer katholischen Messe italienischer Provenienz fällt just in eine Phase aufkeimender konfessioneller Spannung in Berlin, die unter dem Begriff "Proselytenstreit" bekannt ist. Die teils anonyme, teils offene Agitation aufklärerischer Zirkel gegen eine innerprotestantische Aufweichung des konfessionellen Bewusstseins dem Katholizismus gegenüber steigerte sich bis zu gerichtlichen Auseinandersetzungen.[18] In unserem Zusammenhang ist einzig von Interesse, Faschs Stellung in diesem Konflikt anzusprechen. Er schuf sein auch stilistisch von der Rezeption römisch-katholischer Messpraxis inspiriertes Werk in deutlichem Bewusstsein dieses Spannungsfeldes.[19] Es ist anzunehmen, dass Fasch hier eine nahezu überkonfessionelle Perspektive einnahm. Dass er dem Katholizismus schon in Jugendtagen mit einer den Vater befremdenden emotionalen Neigung begegnet, lässt sich auch aus einer von Zelter ausgemalten Anekdote erfahren. Bei einem Dresden-Besuch hörte Fasch eine Messe Zelenkas. Der Vater bemerkte, "daß der junge Mensch in Thränen schwamm, und vor Rührung kein Wort sprechen konnte", und untersagte weitere Messbesuche:"Der Vater, ein eifriger und religiöser Lutheraner, hatte an seinem Sohne mehr Gefallen am katholischen Gottesdienst bemerkt, als er wünschte."[20]
Eine emotionale Affinität zum Katholizismus scheint, sofern man Zelter hier glauben will, keimhaft angelegt; wie vage sie sich auch in jungen Jahren ausprägen mochte, wird sie die Rezeption der Messe Benevolis beeinflusst haben.
Schließlich sollte man auch die möglichen Intentionen Johann Friedrich Reichardts bedenken. Sein Verhältnis zu Fasch war herzlich und kollegial, was nicht zuletzt die Propagierung der Messe im Kunstmagazin bezeugt, die ihre weitere Rezeption wesentlich lenkte. Dass Reichardt Faschs begeisterte kompositorische Reaktion auf die Komposition Benevolis weitergesteckten musikpolitischen Zielen nutzbar machte, darf als zusätzliche äußere Kraft verstanden werden, die die "Lebenswende" Faschs bestimmte. In Zelters Lebensbild genießt das Erscheinen der Messe Benevolis aber das isolierte Privileg des Wunders. Es öffnete Fasch den kaum glaublichen Ausweg aus einer biographisch-künstlerischen Sackgasse. So wenig Zelter sich also der geistesgeschichtlichen Dimension dieses Vorgangs zuwendet, so wenig er ihn an den eigentlich gängigen Milieuwechseln von Berufsmusikern der vorangegangenen Generationen misst, so eindringlich führt er die quasi-religiöse Bekehrungsgeschichte zu ihrem wirkungsvollen Ende.
Wesentlich für die Erzählung vom "neuen Leben" ist das gewandelte Verhältnis von Körper und Geist, von Krankheit und Kunst. Während die Schwäche und Hinfälligkeit Faschs weiter zunimmt, ist doch – und dies ist für Zelter der Kern aller Dinge – die Macht der Krankheit über die Kunst gebrochen, die sie ins spekulativ-abseitige deformiert hatte. Nun ist es die erwachte Schaffenskraft, die der Krankheit Lebenszeit abtrotzt und sie aus dem Gefilde der Kunst hinausdrängt. Kam das zweckfreie kontrapunktische Spiel des überwundenen Lebens ohne öffentliche Realisierung aus, komponiert Fasch sein geistliches "Weltabschiedswerk" mit der festen Absicht, es zu hören und hören zu lassen. Das ist eine nur scheinbar banale Tatsache – als Komponist war er ja auf klangliche Verwirklichung nicht zwingend angewiesen. Doch gab es weder Interpreten noch ein Publikum. Beides musste aus dem Nichts erschaffen werden. Der Energieschub, mit dem Fasch aus der Obskurität heraustrat und allmählich einen Chor schuf, dessen einzige Aufgabe die künstlerisch angemessene Aufführung seiner Komposition war, wirkt beispiellos. Es ist ein Sieg des Kunstwillens über den Tod, dem Fasch 17 sieche Jahre abtrotzte. Sehr bildmächtig wird Faschs öffentliches Erscheinen im Kreise der Sing-Akademie im Geiste heiligenmäßiger Selbstüberwindung geschildert:"Man sah ihm den Zwang an, sich aufrecht zu erhalten; auf seinem Gesichte kämpfte seine natürliche Anmuth mit dem Gefühl bittrer Leiden."[21]
Später dann:
"Seine Sehnsucht nach höherer Hülfe und sein heißer Wunsch um Auflösung seines quaalvollen Lebens, hatten über sein schönes Antlitz eine Art der Verklärung ausgegossen, die schmerzlich rührend war."[22]
Das Sterben Faschs wird tatsächlich zu einer Heiligenverklärung erhoben, die sehr wohl aus der Feder eines Wackenroder oder Tieck stammen könnte:
"Diese Scene war wirklich heilig. In seinem Gesichte war etwas unbeschreiblich Erhabenes und Überirdisches; seine schön gewölbte hohe, heitere Stirn schien Stralen zu werfen, sein weniges graues Haar sich in besondere Locken zu legen und alles an ihm hatte eine neue Gestalt."[23]
In einem letzten Schritt trocknet Zelter dem Sterbenden den Schweiß. "Das hat mir noch keiner gethan!", so die Antwort.[24] Zelter hätte dieses winzige Detail kaum erwähnt, klänge hier nicht die neutestamentliche Schweißtuch-Analogie der Passionsberichte an.
Diese höchste Stilisierung des Kunst-Märtyrers findet ihre bildliche Entsprechung in einer Tuschezeichnung Johann Gottfried Schadows, die später von Eberhard Siegfried Henne gestochen auf das Frontispiz der Biographie gelangte.[25] Dieses Bild liefert den letzten Schlüssel zu den Intentionen der Zelterschen Arbeit am Fasch-Mythos. Dazu sind in jüngerer Zeit zwei ikonologische Deutungsversuche unternommen worden, die unserer Ansicht nach allzu sehr in der Vorstellung haften, es hier mit einem Künstlerbildnis zu tun zu haben. So sieht Wolfgang Ruf einen Gegensatz von realer (Fasch) und irrealer (Engelskonzert) Welt und folgert darüber hinaus, in diesem Spannungsfeld seien die ästhetischen Modi Inspiration, Kreation und Rezeption dargestellt.[26] Christian Filips sieht gar in der Haltung der Hände eine symbolische Mittlerschaft zwischen Vergangenheit und Zukunft. Der Zeigefinder weise voraus, während die Schriftrolle kein anders Werk bedeuten könne als Faschs Messe, der damit eine allerdings ganz und gar historische Funktion beigemessen wäre.[27]
Indes steht Zelters Text nicht in der Formtradition der Künstlerviten, die seit Vasari eine eigene Linie ausprägten. Wenn man sich der hagiographischen Züge der Zelterschen Darstellung erinnert, kommt man zu einer anderen Deutungsperspektive. Der Gründer der Sing-Akademie ist hier, und das wurde bislang übersehen, auf einem "Bild im Bilde" dargestellt, das seinerseits Teil einer scheinarchitektonischen Konstruktion ist. Im Gegensatz zur ovalen Tuschevorlage werden Hand und Schriftrolle in einer Weise beschnitten, wie sie bei späteren Rahmenfassungen älterer Gemälde häufig zu beobachten sind. Diese Rahmung wird damit gleichsam fingiert, als sei ein älteres Bild in eine Art Altarkonstruktion eingepasst worden, die auf einem Gesims ruht und in einem gotischem Scheingiebel eine weitere religiöse Szene zeigt, ein Engelskonzert mit der heiligen Cäcilia im Mittelpunkt. Doch ist diese Szene nicht, wie Ruf oder Filips vermuten, der religiöse Widerpart eines "realen" Portraits, vielmehr ein typisches Beiwerk eines Heiligenbildnisses. Genauer gesagt handelt es sich um einen Bildtypus, der sowohl für Kirchenväter- als auch Ordensgründer-Darstellungen geläufig ist. Sowohl das "Buch" respektive die Schriftrolle als auch die Unterweisungsgeste zählen zu den typischen Merkmalen dieses Bildtyps. Die gesamte Konstruktion zeigt die Scheinarchitektur eines Altars mit einem Bildnis Faschs als Altarblatt.
Damit ist Zelters Strategie eindrucksvoll verbildlicht, Faschs Leben als die Heiligenvita eines Ordensgründers zu schildern. Diese Vita enthält alle Zutaten, das falsche und verirrte Vorleben, den Wendepunkt des religiösen Erlebnisses und die Verbreitung der Regel. Doch das religiös gewandete Geschehen ist auf der säkularen Ebene angesiedelt. Fasch begründet keinen Orden, sondern einen der bürgerlichen Kunstübung verhafteten Verein, nämlich die spätere Sing-Akademie.
Zelters Schrift monumentalisiert eine Denkform, die wie keine andere für das Eindringen frühromantischer Kunstanschauungen in die Kultur des sich formierenden Bildungsbürgertums steht. Prägend für diese Formierung ist eine grundlegende gedankliche Überkreuzungsbewegung im Verhältnis von Religion und Kunst, bei der einer völligen Säkularisierung des Heilsgeschehens die Sakralisierung der Kunst entgegenwirkt. Zelter dekliniert diesen Prozess, ganz auf das Leben des Gründers begrenzt, regelrecht durch. Die Sinnleere von Faschs höfisch-weltlichem Vorleben füllt sich durch ein quasi-religiöses Erlebnis nicht mit Glauben, sondern mit Kunst. Das Bürgertum konnte hier, übertragen auf die ästhetische Sphäre, eben jenes Vakuum wieder erkennen, das die Aufklärung in Glaubensfragen hinterlassen hatte. Das religiös erneuerte Kunsterlebnis aber hat seinen Bezugspunkt in der Vergangenheit.
Nimmt man die Fasch-Messe aus, entwickelt sich in der Sing-Akademie nämlich sehr bald ein historistisches Kunstideal, das seine ästhetische Legitimation erst mit den Schriften E.T.A. Hoffmanns erlangen sollte. Die Kanonisierung eines Bestandes altitalienischer Sakralmusik geschieht dabei in den zehn Amtsjahren Faschs nicht unter dem Vorzeichen einer Diskussion um "wahre Kirchenmusik", sondern der Transformation geistlichen Repertoires in den bürgerlichen Konzertsaal, der damit zu einer ersatz- oder kunstreligiösen Andachtsstätte wird, ein Prozess, der in der Sakralisierung bestimmter Gattungen oder Werkkomplexe – beispielhaft seien Beethovens späte Streichquartette genannt – im Verlauf des 19. Jahrhunderts kulminiert. Dass das Haus der Sing-Akademie zu den zentralen Schauplätzen dieses Prozesses zählt, ist wohl kaum ein Zufall. Dass aber ausgerechnet Zelter imstande war, in der obskuren Lebensgeschichte seines verehrten Lehrers mehr zu erkennen als einen Milieuwechsel, nämlich einen Lebensumschwung, der einen regelrechten Epochenwandel repräsentiert, und dass er diese Vita in eine vieldeutige Form gießen konnte, die dem jungen Bildungsbürgertum und der frühromantischen Generation gleichermaßen als Deutungsmuster kunstreligiöser Erweckung dienen konnte, erhebt Zelters Faschbuch über seinen biographischen Wert hinaus zu einer kulturgeschichtlichen Quelle ersten Ranges.Axel Fischer / Matthias Kornemann
________________________________________
[1] Vgl. Zelter: Fasch, S. 54–55.
[2] Ebd. S. 54
[3] Zelter an Goethe, 25. April 1801, in: Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens (Münchner Ausgabe), hrsg. von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller, Gerhard Sauder und Edith Zehm, Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832, Bd. 20.1, hrsg. von Hans-Günter Ottenberg und Edith Zehm, München und Wien 1991, Nr. 5, S. 16.
[4] Zelter an Goethe, 21. Bis 23. Februar 1830, in: Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832, Bd. 20.2, hrsg. von Edith Zehm und Sabine Schäfer, München und Wien 1998, Nr. 724, S. 1322–1324, hier S. 1323.
[5] Ebd.
[6] Zelter: Fasch, S. 8.
[7] Ebd., S. 16.
[8] Ebd., S. 17.
[9] Ebd., S. 18.
[10] Ebd., S. 21.
[11] Ebd., S. 55.
[12] Ebd., S. 40.
[13] Ebd., S. 55.
[14] Vgl. zu dieser Episode Thomas Richter: Die Dialoge über Literatur im Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, Stuttgart 2000, S. 239–241.
[15] Zelter: Fasch, S. 25.
[16] Ebd., S. 26.
[17] Ebd., S. 28.
[18] Vgl. hierzu ausführlich Jürgen Heidrich: Protestantische Kirchenmusikanschauung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Studien zur Ideengeschichte "wahrer" Kirchenmusik, Göttingen 2001 (= Abhandlungen zur Musikgeschichte, Bd. 7), S. 126ff.
[19] Vgl. ebd., S. 139.
[20] Zelter: Fasch, S. 12.
[21] Ebd., S. 36.
[22] Ebd., S. 37.
[23] Ebd., S. 41–42.
[24] Ebd., S. 42.
[25] "Mein Freund Schadow hatte das Bild an einem schönen Morgen beim Kaffee unter grünen Bäumen im Schlafrocke mit schwarzer Kreide gezeichnet. Aus dem Schlafrocke, worin ich es nicht gern vor der Welt ausstellen wollte, ist eine Art von Toga geworden." Zelter an Goethe, 25. April 1801, in: Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, Bd. 20.1, Nr. 5, S. 16.
[26] Vgl. Wolfgang Ruf: Der Blick nach oben: Cäcilia, die Schutzpatronin der Sing-Akademie, in: Bericht über die Internationale Wissenschaftliche Konferenz am 8. und 9. April 2011 im Rahmen der 7. Internationalen Fasch-Tage, hrsg. von der Internationalen Fasch-Gesellschaft Zerbst, Beeskow 2011 (= Fasch-Studien, Bd. 11), S. 225–250.
[27] Vgl. Christian Filips: "Die Sprache der Engel" – Die Kunstreligion der Sing-Akademie zu Berlin um 1800 und ihre Wirkung auf Wackenroder und E. T. A. Hoffmann, in: Kennen Sie Preußen – wirklich? Das Zentrum "Preußen – Berlin" stellt sich vor, im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von Bärbel Holtz und Wolfgang Neugebauer, Berlin 2009, S. 91–110.An den mit ► markierten Stellen können entsprechende Kommentare aufgerufen werden. Bewegen Sie dazu einfach die Maus über das jeweilige Symbol.
Karl Friedrich Christian Fasch (1801)
Karl Friedrich Christian Fasch.
______________
VonKarl Friedrich Zelter.
______________________________
Mit einem Bildnisse.
_________________________________________________________
Berlin, 1801.In Commission und gedruckt bei Johann Friedrich Unger.
[S. 2]
[S. 3]
Fasch
[S. 4]
Seiner Excellenz
Herrn
Friedrich Anton Freiherrn v. Heinitz,wirklichen Geheimen Stats- und Krieges-Rath, Vice-Präsidenten und dirigirenden Minister bei dem General Ober-Finanz-Krieges- und Domainen-Direktorio, Ritter des schwarzen und rothen Adler-Ordens, auch Amtshauptmann zu Ravensberg, Erbherrn auf Dröschkau; Chef des Departements von Cleve, Meurs, Ostfriesland, Geldern, Mark, Minden, Ravensberg, Teklenburg, Lingen und Neuschatel; desgleichen des Bergwerks- und Hütten-, wie auch des Münz-Departements und der Porzellan-Manufaktur-Kommission, Kurator der Akademie der Künste und der Bau-Akademie.
[S. 5]
Das Leben eines merkwürdigen Künstlers und tugendhaften Mannes, der die Ehre seiner Zeit gewesen, kann der nähern Betrachtung Ew. Excellenz an sich selbst nicht unwürdig seyn.
Wenn aber die Kühnheit, mit welcher ein Freund und Verehrer des verewigten Meisters Ew. Excellenz diese Lebensbeschreibung weihet, noch einer Rechtfertigung bedarf; so liegt diese unmittelbar in dem schönen Schutz, womit Dieselben einer Muse, die lange ohne Tempel und Altar umherirrte, das Heiligthum ihrer andern Schwestern geöfnet haben.
[S. 6]
Mit aufrichtigem Gefühl der Verehrung und des Dankes verharre ich
Ew. Excellenzgehorsamster Diener
Karl Friedrich Zelter.
[S. 7] Karl Friedrich Christian Fasch ward im Jahre 1736 den 18ten November zu Zerbst im Fürstenthum Anhalt geboren. Sein Vater, Johann Friedrich Fasch, war zuletzt fürstlicher Kapellmeister daselbst und ein Schüler von Kuhnau und Graupner. Der alte Fasch unterrichtete seinen einzigen, im 48sten Jahre erzeugten Sohn zuerst in den Anfangskenntnissen der Musik, und im Klavierspielen. Er war ein überaus fleißiger, und für seine Zeit ungemeiner und geschmackvoller Kirchen-Komponist. In der Anwendung der Blasinstrumente, welche damals im nördlichen Deutschlande noch wenig im Gebrauch waren, wurde er von Kennern besonders geschätzt, und seine kontrapunktischen Arbeiten, von denen ich eine große zweichörige Messe von der eigenen Hand des Komponisten besitze, geben einen gelehrten, und im vielstimmigen Satze sehr gewiegten Meister zu erkennen. Seine meisten Arbeiten bestanden übrigens in Jahrgängen für die Zerbster Hofkirche, in deren Ausarbeitung er unermüdet war, denn er lieferte wöchentlich, besonders in den ersten Dienstjahren, zwei und manchmal vier Kirchenstücke, ohne die Gelegenheitsmusiken, welche der Hof noch zu besondern Festen bestellte. Außerdem giebt es viele Ouverturen, Messen, Serenaten, Tafelmusiken, Sonaten und Trio’s von ihm, die ihr Verdienst haben[1]).
[S. 8] ►Die Erziehung seines Sohnes machte dem alten Fasch, der den sechziger Jahren entgegen ging, viele Sorge. Der junge Fasch war von der Wiege an schwächlich gewesen, und kränkelte unaufhörlich fort, so daß der Vater auf alle Weise vermied, seinen Geist anzustrengen, und ihn zu Schularbeiten anzuhalten.
Dem zufolge wurde eine eingezogene Lebensart und strenge Diät für das beste gehalten. Das Kind mußte seine Tage und Jahre einsam, auf dem Stuhl, am warmen Ofen, oder doch in eingeschlossener Luft, ohne Beschäftigung und Bewegung zubringen. Dies mattete seinen Körper zuletzt so ab, daß er die freie Luft gar nicht mehr ertragen konnte, und bei dem geringsten Angriff einer veränderten Witterung oder sonst eines Anfalls, auf lange Zeit das Bette hüten mußte. In dieser einsamen Kindheit, beständig in der Gegenwart eines arbeitsamen, zärtlichen und religiösen Vaters, den die geringste Unruhe in seiner frommen Thätigkeit störte, neigte sich der erwachende Geist des Kindes unvermerkt zur Spekulation. Sein einziger erlaubter Genuß, der in kraftlosen Suppen, Überdruß erregenden Kinderspielen, und ►stillen geistlichen Übungen bestand, konnte das Erwachen verborgener Kräfte in ihm nicht verhindern.
Der Vater, der des Morgens gleich nach seiner Andacht und seinem Frühstück an seine Arbeit ging, den ganzen Tag schrieb, und mit der letzten Note wieder in sein Bette stieg, konnte die Thätigkeit seines Sohnes nicht bemerken, als nach bedeutenden Fortschritten. Der ►Konzertmeister Höckh, ein vertrauter aber muntrer Hausfreund des alten Fasch, ließ sich von Zeit zu Zeit mit dem Kinde in unbedeutende Gespräche ein, bekam aber niemals eine Antwort. Höckh, der unweit Wien geboren war, hatte einen österreichischen Dialekt, dem zufolge er den jungen Fasch, der Karl hieß, immer Monsieur Koorl nannte[2]); dieß verdroß [S. 9] ihn, und deswegen gab er keine Antwort. Einst fragte Höckh das Kind: ob er denn gar keine Lust zur Musik habe? er wolle ihn auf der Violine unterrichten, und erhielt zu seinem Erstaunen ein freundliches und lebhaftes Ja! Nach vielem Fragen und Forschen fand sich endlich, daß der junge Fasch mehrere ganz neue Stücke, ohne Wissen des Vaters, in seinem Kopfe zusammengesetzt, und zu solcher Zeit, wann der Vater am Hofe oder in der Kirche gewesen, auf dem Klaviere geübt hatte. Diese mußten nun vorgespielt werden, und eine allgemeine Freude des Hauses, vorzüglich aber die volle Gunst des Concertmeister Höckh, der schon ein natürliches Gefallen am Kinde hatte, waren die glücklichen Folgen dieses Vorfalls. Was dem guten Höckh dabei eine besondere Freude machte, war die Bemerkung, daß der junge Mensch nicht etwa aus gehörten Gedanken etwas zusammen geschürt hatte, sondern was er spielte, kam leicht und natürlich heraus, und der Unterricht auf der Violine wurde angefangen. Das Kind wurde mit einer guten Violine beschenkt, die ich noch besitze, und alles wäre den besten Weg gegangen, wenn nicht die Schwäche des Kindes und die Zärtlichkeit des Vaters überall hinderlich gewesen wären. Der Knabe war nun eilf Jahre alt. Um diese Zeit bekam der alte Fasch den Besuch eines Freundes aus Köthen, unweit Zerbst. Dieser war ein geselliger, heiterer Mann, der mehrere Kinder hatte, und da er sich öfter in Zerbst aufhielt und beim alten Fasch wohnte, gewann er sich durch sein offenes frohes Wesen die Zuneigung des Knaben, der in seiner Gegenwart eine ganz neue Natur annahm, munter, fröhlich und geistreich wurde. Dieser bat den Vater, ihm auf eine Zeit lang den Sohn mit nach Köthen zu geben, wo ein guter Arzt sey, und der Vater willigte ein. Nach sechs Monaten kam der junge Fasch zurück, gesund, und hatte ein leichtes, leichtfertiges Wesen angenommen. Der Arzt hatte gerathen, dem Knaben die ►freie Luft und körperliche Bewegung zu gönnen; die Gesellschaft der andern Kinder hatte ihn zu seiner Natur zurückgebracht, und das Ende davon war, daß in kurzer Zeit aus einem schwächlichen, verzärtelten Mittelgeschöpf ein frischer Knabe entstand, den man kaum wieder erkannte.
[S. 10] Von nun an durfte der junge Fasch den Musiken am Hofe und in der Kirche beiwohnen. Besonders hatten die Kirchenmusiken viel Anziehendes für ihn. Es war aber nicht blos die Musik, was ihn anzog, es war die ganze Handlung, welche einen Anstrich von Würde und Heiligkeit hatte, und wovon er noch in seinen letzten Jahren mit Wohlgefallen und Rührung sprach. Das Orchester erschien bei den Kirchenmusiken immer schwarz gekleidet, und bei der Communion lag der ganze Hof, während der Musik, vor dem Altar auf den Knien. Diese Feierlichkeit war es nun auch, wohin er jeden Ton der Musik und jedes Wort des Textes haben wollte, und wo ihn öfters das Hergebrachte in der Anordnung der Kirchenstücke und die Geschmacklosigkeit so mancher deutschen Texte störte. Er fing nun an, selbst Kirchenmusiken zu verfertigen, mit denen er sich Lob erwarb, und änderte sich darinnen öfter die Worte nach seinem Sinne. Er zerstörte aber diese Arbeiten immer wieder, so wie er neue Musiken komponirte, worin die vorigen Fehler vermieden waren. Im Jahre 1750 hatte der Jüngling besonders im Violinspielen so zugenommen, daß sein Vater, auf den Rath seines Freundes Höckh, beschloß, gegen ein Jahrgeld von 100 Rthlr. seinen Sohn nach Meklenburg-Strelitz zum ►Concertmeister Hertel in Unterricht zu geben. Dieser Hertel war um seine Zeit einer der modernsten und berühmtesten Violinisten in Deutschland. Seine Concerte und Solo für die Violine, worin ein warmes und leidenschaftliches Wesen sich mit einem dankbaren Traktament des Instruments vereinigte, wurden überall mit Beifall aufgenommen. Hier beschäftigte sich nun der Lehrling außer seinem Unterricht am liebsten mit der Harmonie und dem Orgelspiel. Er arbeitete fleißig Fugen, und ging jeden Sonntag in die Kirche, den Organisten von seinem Dienste abzulösen. Was ihm hier besonders gelang, war der Gebrauch des Pedals, worin er viele Fertigkeit erlangte. Seinem Meister Hertel war unter allen Talenten des Jünglings keines so willkommen, als der eigenthümliche Fleiß und der Verstand, womit er auf dem Flügel accompagnirte. Fasch wußte sich so genau an jeden Solospieler anzufügen und ihm in seiner Art [S. 11] und in seinem Ausdruck beizukommen, daß sich jeder gern von ihm accompagniren ließ, und Fasch hatte dabei den doppelten Vortheil, schön spielen zu hören, und immer besser accompagniren zu lernen.
Im Jahre 1751 kam der Königl. Preuß. Concertmeister Franz Benda, zum Besuch nach Strelitz, und ward aufgefordert, vor dem Hofe zu spielen. Benda ließ sich mit einem Solo hören. Der alte brave ►Linike war damals Hofklavirist am Strelitzschen Hofe, und obwohl er ein geschickter Mann war, so trauete er sich doch nicht an den damals neuen Bendaschen Styl. Benda spielte am liebsten seine eigene Violin-Solo, wozu er sich lebhafte und oft schwere Bässe setzte, die eine sehr fertige linke Hand und ein gewandtes Accompagnement erfordern. Der junge Fasch war der Einzige in Strelitz, der dem Meister seine Solo vollkommen gut accompagniren konnte, und fand dabei ein so eigenes Vergnügen an der Schwierigkeit der Bendaschen Bässe und an der Zufriedenheit des großen Violinisten, daß er sich eine Zeit lang ausschließlich mit dem Accompagnement beschäftigte und dabei eine sehr fertige linke Hand gewann, die man noch in seinen letzten Jahren bemerkte, denn er konnte ohne Ausnahme alle Manieren, Rouladen und Sprünge, mit einer Hand wie mit der andern, deutlich und natürlich herausbringen. Nach dem Aufenthalt eines Jahres reisete er zu seinem Vater nach Zerbst zurück. Von hier ward er nach dem ►Kloster Bergen bei Magdeburg auf die Schule geschickt, um in Sprachen und andern Schulkenntnissen das Erforderliche zu lernen, und im Jahre 1753 kam er von da zurück. Er fuhr nun fort, sich in den Kontrapunkten zu üben, komponirte Kirchenmusiken, Klavier- und Violinstücke, Sinfonien und Motetten, mit so gutem Erfolg, daß er in seinem neunzehnten Jahre ein brauchbarer und fertiger Tonkünstler heißen konnte.
Der alte Fasch, der die Fortschritte seines Sohnes mit Vergnügen bemerkte, entschloß sich nun mit demselben eine Reise nach Dresden zu machen. Der Wunderruf der Dresdner Kapelle und die Schönheit der Musiken, die daselbst aufgeführt wurden, erfüllten dazumal ganz Deutschland.
[S. 12] Der Vater führte seinen Sohn in die katholische Kirche, woselbst eine große Messe von Zelenka gegeben wurde. Der Vater, der die Leichtfertigkeit seines Sohnes kannte, warnte ihn väterlich: es würden in einer katholischen Kirche, die er noch niemals gesehen, fremde und ihm auffallende Handlungen und Gebräuche vorkommen, und er solle sich ja nicht beikommen lassen, darüber zu lachen, oder irgend einen Spott blicken zu lassen, weil dies das größte Unglück für ihn nach sich ziehen könnte. Als die Messe geendigt war, fragte der Vater: wie ihm die Musik und der Gottesdienst gefallen habe? und bemerkte, da er keine Antwort erhielt, ► daß der junge Mensch in Thränen schwamm, und vor Rührung kein Wort sprechen konnte. Er bat den Vater, ihm zu erlauben, alle Tage in die Messe gehen zu dürfen, aber es wurde nicht gestattet. Der Vater, ein eifriger und religiöser Lutheraner, hatte an seinem Sohne mehr Gefallen am katholischen Gottesdienst bemerkt, als er wünschte. Hasse, der um seiner Frau, der berühmten Faustina willen, ► zur katholischen Religion übergetreten war, hatte ein Beispiel gegeben, welches der alte Fasch verabscheute; er befürchtete, daß solches den Sohn zur Nachahmung reitzen möchte. Ein Freund wollte den Sohn ein Jahr lang in Dresden behalten, allein es ward nicht bewilligt. Im Jahre 1756 wurde im Dienste Friedrich des Zweiten, Königs von Preußen, ein Klavirist erfordert, indem der bekannte Nichelmann seinen Abschied gefordert und erhalten hatte. Da nicht gleich ein Subjekt in der Nähe war, so erinnerte sich Fr. Benda des jungen Fasch, der ihm in Strelitz vor 5 Jahren so gut accompagnirt hatte und jetzt 20 Jahre alt war, und schlug diesen dem Könige vor.
Der König genehmigte Benda’s Wahl; es wurde nach Zerbst geschrieben und ein Jahrgehalt von 300 Thalern geboten, das mit zunehmenden Jahren erhöht werden sollte. Der Ruf Friedrich des Zweiten als Virtuose, als Kriegsmann, als Schriftsteller und überhaupt als ein Mann von Geschmack, erfüllte schon ganz Europa, und der junge Fasch fand sich nicht wenig geschmeichelt, den Dienst des größten Fürsten der bekannten Welt, als eine Ehrenstelle offen vor sich zu sehen, [S. 13] ] wo er in Gemeinschaft der größten Meister jener Zeit, neben Männern wie Bach, die beiden Graun, Franz Benda, Quanz, ► Romani und der berühmten ► Astroa, für seine Kunst und sein Talent ein unabsehbares Feld vor sich hatte. Wer indessen diese Ehre nicht so mit den Augen der jugendlichen Bewundrung sah, war der Vater unsers jungen Fasch. Dieser war beinahe siebenzig Jahre alt, und hegte die Hofnung, seinem einzigen geliebten Sohne seine für Zerbst sehr einträgliche Stelle nach seinem Tode zu hinterlassen. Dazu kam noch, daß der Preußische Hof zu der Zeit nicht eben im Rufe einer ausgemachten Heiligkeit stand, und es war ein empörender Gedanke für den alten frommen Mann, seinen Sohn an einem Hofe zu wissen, wo die Voltaire und Maupertuis mit irreligiösen Irrthümern das Land baueten; kurz, er wollte nicht einwilligen, und war schon im Begriff die Sache abzuschreiben, als ein Brief des Berliner Bach, der ein guter Freund des alten Fasch war, der Sache den Ausschlag zur Freude des Sohnes gab. Der Brief enthielt: daß man hier im Lande glauben könne, woran man wolle; daß der König selbst zwar nicht religiös sei, aber auch deswegen niemand mehr oder weniger achte, u. s. w.; was den alten Mann zuletzt völlig beruhigte, war die Versicherung des Zerbster Hofes, daß die Kapellmeisterstelle nach seinem Tode unbesetzt bleiben sollte, und Bach bot sich selbst an, den jungen Künstler zu sich in Kost und Wohnung zu nehmen, und ihn so viel wie möglich vor Verführung zu bewahren.
Der junge Fasch reisete also nach Potsdam ab und trat im Frühling des Jahres 1756 seinen Dienst an, der darin bestand: wechselweis mit Bach von vier zu vier Wochen dem Könige täglich seine Konzerte und Flötensolo auf dem Fortepiano zu accompagniren.
Der König führte bekanntlich ein einfaches und nach strenger Zeitordnung eingerichtetes häusliches Leben. Seine Stunden waren für jeden Tag, seine Tage für jeden Monat, und seine Monate für jedes Jahr eingetheilt. Die Musikstunden waren bestimmt immer die nemlichen; er verlangte demnach pünktliche Aufwartung von jedem seiner Diener.
[S. 14] Fasch mußte in Potsdam die ersten vier Wochen bei der Kammermusik des Königs blos gegenwärtig seyn und Bachs Accompagnement hören: dann verließ Bach Potsdam; und der Dienst ward nun dem jungen Fasch nach der eingerichteten Ordnung übertragen.
Der König bemerkte bald, daß er seinen Mann gefunden hatte. Bach war ein großer Klavierspieler und hatte den König an sein feines Accompagnement gewöhnt; aber das immerwährende Wiederholen der nemlichen Stücke hatte ihm längst Überdruß gemacht, denn der König blies ohne Ausnahme keine andere Konzerte und Solo, als die Quanz für ihn gemacht hatte, und öfter Flöten-Solo von seiner eigenen Arbeit.
Die Aufmerksamkeit, mit der Fasch einmal wie das andere seinen Dienst versah, konnte dem Könige nicht entgehen, und er schätzte und liebte ihn deswegen. Der König blies das Adagio sehr schön, und überließ sich dabei oft seiner dermaligen Stimmung so sehr, daß es nicht leicht seyn mochte, ihm nach seinem Sinne zu folgen; dagegen war sein Allegro etwas matt, wenn schwere und lange Passagen einen fertigen und langen Athem verlangten. Diesen Mangel suchte er mit einem willkürlichen Ausdruck zu bedecken, und wenn ihm das Accompagnement gehörig nachging, war es kaum zu bemerken. Bach, der die Anforderungen des Königs und sein dreistes Urtheil nicht liebte, war hierin weniger nachgiebig, welches der König empfinden mußte, und deswegen nicht so viel auf ihn hielt, als es seine große Kunst verdiente.
Der Preußische Hof war in dieser glücklichen Zeit, vor dem siebenjährigen Kriege, in seiner Art sehr glänzend. Der König war nicht geizig, und liebte die Pracht. Übrigens war er reich und bei seiner wohleingerichteten Staatswirthschaft konnte es an nichts fehlen, was den Geschmack befördert und das Leben angenehm macht.
Im Monat May 1756, kurz vor Faschens Ankunft, war noch eine italienische Truppe für die Opera Buffa angenommen worden, und alles wäre auf [S. 15] diese Art fortgeschritten, wenn der unglückliche siebenjährige Krieg nicht dazwischen gekommen wäre. Der Tempel der Musen ward mit Grauns letzter Oper Merope, die schon im März 1757 aufgeführt war, geschlossen. Die Opera Buffa erhielt im Jahre 1757 wieder ihren Abschied, und an die Stelle von Heiterkeit und Freude trat Ahndung und Erwartung blutiger Auftritte, durch welche der König beinahe sieben Jahre von seinem Hofe entfernt wurde.
Durch diese Fügung des Schicksals waren zugleich alle die schönen Erwartungen, mit denen sich unser Fasch geschmeichelt hatte, gänzlich vernichtet. In Potsdam gab es fast keine Musik mehr, und an Schauspiele und Opern war gar nicht zu denken. Das halbe Deutschland, Frankreich, Schweden und Rußland waren nach und nach gegen den König im Kriege begriffen, und was nur Künste heißt, mußte entweder im Stillen gedeihen, oder unbemerkt in Kummer ersticken. Mit 300 Rthlr. Gehalt in Kriegszeiten war schon nicht auszukommen, und durch die Einführung der ► Besoldungsscheine statt baaren Geldes, die gar keinen Cours hatten, stieg das Unglück für unsern Freund aufs höchste, denn diese 300 Thaler wurden nun in solchen Besoldungsscheinen ausgezahlt, welche vier Fünftel Verlust gegen gutes Geld brachten und gar nicht angenommen wurden, wenn man damit bezahlen wollte.
Fasch würde hier billig seinen Abschied haben nehmen können, allein wo sollte er hin? Sein Vater, von dem er noch einigen Zuschuß gehabt, war im Jahre 1758 gestorben. Hauptsächlich hielt ihn aber seine Anhänglichkeit an den König davon ab, den er im Unglück nicht verlassen wollte; und je größer die Noth wurde, worin der König immer mehr versank, desto fester wurde Faschens Anhänglichkeit an diesen großen Mann.
Diese unglückliche Zeit des siebenjährigen Krieges, welche der Welt wohl mehr als ein Talent entrissen hat, war auch für unsern Fasch und seinen Genius von dem allernachtheiligsten Einflusse. Es war jetzt auf weiter nichts zu denken [S. 16] als ein kümmerliches Brod mit Musikunterricht zu erwerben, wobei jeder freie Schwung eines eigenen Geistes sein eigenes Hinderniß findet.
Wenn sich die Thätigkeit des Genies auf Nebenzeiten und Feierstunden anweisen ließe, so wäre unserm Freunde manche Stunde übrig gewesen, Werke der Kunst ans Licht zu bringen. Zwar hat es nie an seiner Thätigkeit gefehlt. Er hat in dieser Zeit sehr viele Sachen geschrieben, sie aber alle wieder zerstört, weil es keine Werke freier Kraft waren. Bach, der um diese Zeit schon einen großen Ruf in Deutschland hatte, war hierin glücklicher. Seine Arbeiten, und besonders seine Lektionen, wurden ihm so gut bezahlt, daß er dabei ein gutes Auskommen fand. Dies war aber bei unserm Fasch nicht der Fall, und der Krieg ist ohnehin keine Zeit für einen Komponisten, um sich einen Namen zu machen. Dazu kam sein Stand neben dem großen Bach, dessen Genie er überaus hoch achtete und Superiorität mit großer Liebe anerkannte. Was er sich demnach nicht selber zu Dank gemacht hatte, konnte er sich auf keine Weise bezahlen lassen, und darüber verging ihm seine schönste Zeit und der Muth. Sein Leben schwankte zwischen körperlicher Schwäche und Seelenkraft einher, wo immer eines das andere lähmte, und in diesem Zustande schränkte er seine einsame Thätigkeit allein auf seinen Erwerb und nebenher auf eine Menge kleiner Beschäftigungen und Abendbesuche ein, die wenigstens seinen Geist munter erhielten. Diese kleinen Beschäftigungen waren bei einem Manne von so ernsthaften Gaben, von sonderbarer Art. Bei seiner natürlichen Beständigkeit für alles, was er einmal ergriff, konnte er in seinen Nebenstunden Jahre lang an einem Kartenhause von drei Etagen arbeiten, welches in seiner Art ungeheuer groß und aus vielen hundert Spielen Karten zusammengesetzt war, worin alle Stuben, Kammern, Küchen, Thüren, Fenster, Schornsteine, Feuerheerd, Rauchfänge und Röhren, kurz jeglicher Theil eines großen Wohnhauses, aus unzerschnittenen Karten zusammengesetzt, aber nicht geleimt oder mit Nägeln oder sonst befestigt waren. Die Karten waren blos gekniffen, und konnten eben so leicht von ihm auseinander genommen [S. 17] als wieder zusammengesetzt werden. Noch als ich ihn im Jahre 1780 einmahl besuchte, war er trotz einem Blutsturz, woran er krank war, unaufhörlich mit der Erfindung eines möglichen Daches von unzerschnittenen Karten auf diesem Hause beschäftigt, welches er heraus zu bringen wirklich nach zwei Jahren glücklich genug war, und es ist wohl möglich, daß einige Rathschläge, die ich ihm dabei gab, mir zuerst sein Vertrauen gewonnen haben mögen. Des Morgens, wenn er aufgestanden war, sich frisirt, rasirt und eine Tasse Kaffe getrunken hatte, versuchte er, ob sein Geist Stärke zum Arbeiten hätte; dies geschah so: er multiplizierte acht, zehn, zwölf und mehrere Zahlen mit sich selbst, und machte dann die Probe darauf; er hatte sich aber neue Regeln ausgedacht, diese mühsame Rechnung zu vereinfachen. Verrechnete er sich öfter, oder die Probe wollte nicht stimmen, so war er den ganzen Tag unruhig und dachte über alles, was ihn von der Musik entfernen konnte. Ferner führte er ein genaues Register aller europäischen Kriegsmächte zu Land und See. Er kannte die Regimenter und ihre Generale, bemerkte genau die Versetzungen und Veränderungen mit denselben im Kriege und im Frieden. Alle englische, amerikanische, russische und andere Schiffe nannte er, wußte ihre Anzahl, kannte ihren Gehalt, ihre Bestimmung, ihre Admirale, und folgte ihnen auf der Karte nach, wohin sie gingen; dazu hielt er einen Atlas von auserlesenen Land- und Seekarten, die er durch dabei geschriebene Noten vollkommner machte, und des Abends, wenn er übeln Wetters oder Unpäßlichkeit halber nicht ausgehen konnte, beschäftigte er sich ganz allein mit einem Kartenspiel: ► Patience. Dieses machte er sich aber reichhaltiger, spielte es mit vier Spielen Karten und nannte es Grande-Patience. Seine heitersten Stunden füllte er damit aus, sich auf seine Lektionen vorzubereiten, und eine Sammlung von mehrern tausend Beispielen für die Generalbaßspieler unter seinen Schülern zu erfinden, die überaus sinnreich und zweckmäßig zusammengesetzt waren. Er komponirte ferner viele Kanons, mit welchen er sich bei Kirnbergern sehr beliebt machte, und worin er zuletzt alle seine Vorgänger übertraf; denn unter diesen Arbeiten befindet sich ein [S. 18] fünffacher Kanon für fünf und zwanzig Realstimmen, der eine ganze Welt künstlichen Fleißes in sich vereinigt[3]).
Außerdem gab er sich mit Chirurgie, Medicin, Chymie, Architectur, Mathematik und Zeichenkunst ab, doch so eigen und beständig für jedes Fach, daß er immer auf das stieß, was in diesen Wissenschaften und Künsten noch nicht erfunden und deshalb den vorhandenen Kennern oft ein Anstoß war, wenn er sie darüber zu Rathe zog. Denn diesen kam es meistens sehr sonderbar vor, daß ein Mann, dem die ersten Gründe der Geometrie zu fehlen schienen, weil er sie nicht systematisch wußte, sich in Rechnungen und Spekulationen vertiefte, wo ohne Systematik nicht wieder heraus zu finden ist. Als ich ihn kennen lernte, ►schrieb er noch sehr unvollkommen deutsch, welches er aber noch sehr gut lernte. Er sprach vollkommen gut italienisch und wußte in dieser Sprache am besten etwas zu erzählen, besonders komische Geschichten. Französisch und Engländisch lernte er [S. 19] von sich selber, und das erstere sprach er vernehmlich und für einen Deutschen geläufig genug. Er bekam in seinen letzten Jahren das ► spanische Gedicht des Yriarte über die Musik, geliehen, und in wenigen Wochen lernte er so viel Spanisch, blos mit Hülfe der Grammatik und des Wörterbuchs, daß er das ganze Gedicht vollkommen lesen konnte.
Nach der Schlacht bei Torgau 1761, ließ ihn der König, der in Leipzig Winterquartier gemacht hatte, dahin kommen. Fasch fand einen gealterten, in sich gekehrten Herrn wieder, dem fünf Jahre des Kriegsgetümmels, der Sorge, des Kummers und harter Arbeit einen Anstrich von Melancholie und trüben Ernst gegeben hatten, der gegen sein voriges Wesen merklich abstechend und seinen Jahren noch nicht natürlich war, woraus sich für die Musik nicht viel Günstiges wahrsagen ließ. Der König hatte zwar täglich Musik, aber das Blasen ward ihm sauer, und hier faßte Fasch den ersten Entschluß, nach dem Frieden seinen Abschied zu nehmen und einen andern Wirkungskreis zu suchen.
Gegen den neuen Feldzug des Jahres 1762 ging Fasch wieder nach Berlin. Er hatte sein Geld, was er vorher mit Unterrichten verdient gehabt, verreiset und aufgezehrt, und so mußte er also sein Stundengeben wieder von vorn anfangen. Den folgenden Winter lebte der König zum Theil in Dresden und ließ Faschen wieder rufen; allein dieser kam nicht, weil der König kein Geld zur Reise angewiesen hatte. Im Jahre 1763 wurde endlich der Friede in Berlin verkündigt. Der König kam am 30. März nach Potsdam und fing sein voriges Leben wieder an, wie er es gelassen hatte, doch keiner von seinen Leuten konnte sich der geringsten Entschädigung rühmen. Bach war sehr aufgebracht darüber und ließ sichs auch merken. Fasch ertrug’s mit Geduld und hatte den Vorsatz, jetzt seinen Abschied zu fordern. Seit dem vorigen Winter hatte er sich damit beschäftiget, eine Anzahl Sonaten, Konzerte und Sinfonien zu setzen, um damit seine Brauchbarkeit im Auslande zu bewähren. Er war jetzt 30 Jahr alt. Sein Freund Bach war der einzige, dem er seinen Vorsatz, tiefer in die Welt zu ge-[S. 20] hen, eröfnete; dieser rieth ihn aber mit vielen überwiegenden Gründen davon ab. Darüber kam das Jahr 1767 heran, und nun war er fest entschlossen, wegzugehen. Bach rieth ihm abermals ab, und als er ihn nicht bewegen konnte, bat er, ihm zu Gefallen nur 14 Tage zu warten, ehe er an den König schriebe. Das geschah, und in dieser Zeit ► forderte Bach seinen Abschied, den er auch erhielt, weil er in Hamburg seine Einkünfte verbessern konnte. Bach hatte diese Sache sehr geheim gehalten, und der König war darüber empfindlich geworden. Fasch ließ sich nun dadurch nicht abhalten, auch seinen Abschied zu fordern, bekam aber, als ein sicheres Zeichen von dem Unwillen des Königs, gar keine Antwort. Darauf schrieb er zum zweiten Mahle; statt aller Antwort ließ der König nun fragen: warum Fasch auf seinen Befehl nicht nach Dresden gekommen wäre? Die Antwort war, wie billig, weil der König kein Reisegeld bewilligen wollen; weil Fasch sich bis jetzt selbst ernähren müssen; weil er sich daher für nicht besser als dienstlos gehalten; weil er durch seine erste Reise nach Leipzig und den langen Aufenthalt daselbst, sein geringes Vermögen erschöpft gehabt; ja daß er jetzt aus keiner andern Ursache seinen Abschied fordere, als weil er auf Gehaltsvermehrung in Dienst genommen, die noch nicht erfolgt sey; vielmehr habe ihm der König nicht einmal das Versprochene geleistet. Es unterstand sich aber niemand, dem Könige mehr zu sagen, als daß Fasch Zulage verlange. Der König hielt die Sache für abgeredet unter seinen Leuten, die nun alle Zulage verlangen würden; er glaubte, daß Hasse, der vor dem Kriege in Potsdam gewesen war und Bachen kennen gelernt hatte, dessen Talent er bewundert und gegen den König sehr gerühmt hatte, ihm seine besten Leute abwendig machen wolle, um solche nach Dresden zu ziehen[4]). Er ließ also Faschen sagen: er wisse alles, es sey ein geschmiedeter Plan gegen ihn; Fasch solle sagen, wer ihn aufgeredet hätte, dann [S. 21] wolle er ihm auch Zulage geben. Fasch ließ dem Könige dreist sagen: er sey nicht aufgeredet; er unterwerfe sich einer Untersuchung und verlange seine Entlassung. Der König ließ die Sache nicht weiter gehen und gab Faschen eine Gehaltszulage von hundert Thalern, mit dem Beyfügen, daß solche noch vermehrt werden sollte. Fasch, der den König wirklich liebte, ließ sich von Bachen und seinen andern Freunden zureden und blieb.
Im Jahr 1774 starb Agricola, der seit Grauns Tode die Oper am Flügel dirigirt hatte. Der König übertrug diese Direction nunmehr Faschen, aber ohne Gehaltszulage, der sie bis nach Endigung des Karnavals 1776 bekleidete und dann auf Befehl des Königs dem bereits angenommenen Kapellmeister Reichardt abtrat.
Nach dem bekannten Bayrischen Kriege 1778, legte der König die Musik fast gänzlich bei Seite und sahe nunmehr selten einen von seinen Musikern. Fasch hatte nun 400 Thaler Gehalt und bekam keine Zulage. Sein schwacher Körper fühlte frühe die Vorboten des Alters, und an ein weiteres Fortkommen war deswegen nicht mehr zu denken. Hätte er jetzt Zulage verlangt, so hätte er auch wahrscheinlich seinen Abschied erhalten und wäre dann völlig im Bloßen gewesen. Dessen ungeachtet mußte er bis an den Tod des Königs alle vier Wochen nach Potsdam reisen und seine Zeit da bleiben, obgleich nichts daselbst für ihn zu thun war, besonders in den letzten Jahren.
Diese gänzliche Muße erschuf indessen einen neuen Geist in seinem kranken Körper, und seine alte Neigung zur Kirchenmusik erwachte aufs lebhafteste wieder in ihm. Im Jahr 1783 lernte ich ihn näher kennen, indem ich einigen Unterricht von ihm erhielt. In seinem Unterricht war er treu, ausführlich und wortreich; doch außer demselben war es sehr schwer, ein ordentliches Geständniß die Musik betreffend, von ihm heraus zu bringen, besonders in so fern es dem Geschmack der Zeit entgegen war; was er nicht aus vollem Herzen loben konnte, überging er gern mit Stillschweigen; aber sein Lob war genau und gemessen.[S. 22] Aus dieser Art seines Lobes gegen den Tadel gehalten, womit er meine Versuche belegte, erfand ich mir selbst den Geist seiner Kritik. Seine öftere Kränklichkeit, die zuerst meine Anhänglichkeit an ihn erregte, gab mir Gelegenheit, ihn außer seinen Geschäften zu besuchen, selbst wann er in Potsdam war, wo er die meiste Muße hatte. Ich las ihm aus Büchern vor, die ich selbst wählen durfte, und außerdem wurde das Gespräch von mir immer auf die Musik gelenkt; allein immer wußte er geschickt auszuweichen, so daß Jahre darüber hingingen, bis ich endlich so glücklich war, sein Vertrauen in hohem Grade zu gewinnen.
Nach einem Bekenntniß, das er mir, als er meine Neigung zu dramatischen Arbeiten wahrnahm, eröfnete, hatte die ganze Einrichtung der damaligen Opern wenig Reiz für ihn. Die Architektur des Ganzen war ihm überall fehlerhaft, und das ewige Einerlei der Recitative und Arien war für ihn nichts weiter als ein Präsentiren und Exerciren. Nichts schien ihm daran nothwendig zu seyn und einzugreifen. Grauns beste Werke wurden von ihm sehr hoch geschätzt, aber seine Art, die Opern zu componiren, hatte nicht seinen Beifall. Wenn Graun eine Oper in Musik setzte, so geschah es nicht gar lange vor dem Karnaval. Jeden Tag machte er dann eine Arie, die des Morgens aufgesetzt und nach Tische ausgefüllt wurde. Die Worte der Recitative ließ er sich vom Copisten zwischen zwei Notensysteme schreiben und er selbst setzte nachher die Noten hinein[5] ). Man kann freilich nicht behaupten, daß Graun alle seine Opern so geschrieben habe, aber vielen kann man es ansehen, daß sie auf diese Art gemacht sind. Unter seinen Opern kenne ich eine, wenn ich nicht irre: Cato in Utica, worin auch nicht ein Recitativ mit Accompagnement ist. Man hatte den König beschuldigt: daß er Graun bei der Ausarbeitung der Opern Fesseln anlege. Dieß war so: der König wählte allemahl die Gedichte zu den Opern, und öfter arbeitete er sie [S. 23] selbst in französischer Sprache aus und ließ sie dann von ► seinem Hofpoeten in italienische Verse bringen. Wenn er Graun also die Gedichte gab, so mochte er auch wohl hier oder dort gesagt haben, wie er es haben wollte; ja er ließ Graunen öfter Arien zweimahl machen, wenn ihm die ersten nicht gefielen. Es kann seyn, daß Graun wenig Lust zu dieser Art Arbeit überhaupt gehabt, sich nicht frei genug gefühlt und deswegen lieber Kirchensachen geschrieben habe; denn aus seinen Kirchenstücken leuchtet eine Liebe und ein Fleiß hervor, der in vielen seiner Opern nicht angetroffen wird. Auch war ihm Hassens Rivalität beschwerlich. Der König sprach immer mit dem größten Lobe von Hassen, und in Grauns besten Opern tadelte er nur, was ihm nicht gefiel. Das alles konnte Graunen wenig Muth machen, und das kann die Ursache seyn, warum manche von Grauns Arien mit sichtbarer Nachläßigkeit gemacht zu seyn scheinen, die aber dennoch unter seinen persönlichen Freunden ihre Verehrer und Beschützer gefunden haben.
Fasch verlangte von einem Werke der Kunst, daß es wirklich ein solches seyn, d. h. nicht bloß gefallen, sondern auch für Kenner einen bestimmbaren Werth haben und behalten müsse. So wie er überzeugt war, daß die angewandte Kunst, wie die angewandte Mathematik, nicht mit dem Leben da ist, sondern aus dem Leben entsteht; so glaubte er auch, daß es kein Fehler sey, die Kunst an der Kunst gewahr zu werden, und daß vielmehr der Fleiß, mit dem ein Genie ringet, schätzbarer sey, als der wilde Geist mit dem ein großes Talent im Freien umhertreibt, und doch am Ende auf den Weg alles Fleisches wie ein müder Adler zurücksinkt. Ein Werk, dessen Bekanntschaft und einstweiliger Gebrauch hinlänglich ist, um ganz damit aufs Reine zu kommen, war ihm kein Kunstwerk im eigentlichen Sinne, obgleich er dessen Nützlichkeit nicht leugnete, auch nicht verlangte, daß alles für eine Sache einen Sinn haben solle. Den Fleiß aber hielt er an einem Kunstwerke für das Rührendste, indem er das Genie zur Bedingung machte, und aus diesem Grunde zog er diejenigen Arbeiten, die sein Freund Bach in Berlin und Potsdam gleichsam für sich selbst gemacht hatte, allen seinen übrigen Arbeiten [S. 24] vor; ja er hielt sie für das Größte in seiner Art, das hervorgebracht sey. Unter den Operncomponisten hielt er Hassen, seines großen Styls wegen, für denjenigen der am sichersten auf gebildete Zuhörer wirken könne. Auch der König, der sich im Jahr 1745, als er Dresden eingenommen hatte, die Oper Arminio dort aufführen ließ, war von Hassens großem Styl ergriffen worden, und daher kam seine öftere Unzufriedenheit mit Graun. Fasch unterschied sehr genau Ausdruck und Styl. Beide zusammen machten, nach seiner Theorie, den Geschmack. Hassens Ausdruck war ihm oft falsch; dieß und eine gewisse Manier, die man sehr uneigentlich bald neuen bald alten Geschmack nennt, glaubte er, würden Hassen bei der Nachkommenschaft sehr nachtheilig seyn; doch würden seine besten Stücke für rechte Kenner, die in großen Werken am Gemeinen nicht leicht Anstoß nehmen, unsterblich bleiben. Hassens Opern waren ihm demnach, ihrer Kühnheit und Kraft wegen, im Ganzen, lieber als die Graunschen und in einem von Faschens Hand geschriebenen Verzeichniß von allen zwei und neunzig Opern, die unter der Regierung Friedrichs des Zweiten aufgefuhrt [sic!] worden, findet sich ein einzigesmahl bei der Oper Arminio von Hasse, bemerkt: daß dieses eine vortrefliche Oper sey.
Einen jungen Mann, der um Faschens Unterricht bat, fragte er: was er schon componirt hätte? Die Antwort war: daß er Sinfonieen, Sonaten und eine Kirchenmusik gemacht hätte, wobei es ihm an jeder Regel gefehlt haben würde, wenn er nicht durch die Partituren des Bach und Hasse, nach welchen er sich gern bilden wollte, einiges Licht bekommen hätte. Da haben Sie sich ein paar gefährliche Männer zu Mustern gewählt, sagte er, die Sie schwer übertreffen werden; Sie werden aber weit sicherer Ihren eignen Weg gehen, wenn Sie einen Eingang finden können, denn auf jenem Wege ist für uns nichts mehr zu suchen, man kann höchstens nachfolgen und sie stehen einem überall im Wege.
Gegen das Ende der Regierung Friedrichs II. nahm Faschens Schwäche so sehr zu, daß seine ganze Geschäftigkeit dadurch erschüttert wurde. Die Abnahme aller Kräfte ward immer sichtbarer und ließ ihn nichts, als ein baldiges [S. 25] Ende hoffen. Starke, oft wiederkehrende Blutausleerungen, ein unaufhörlicher Husten von erstickender Engbrüstigkeit begleitet; Krämpfe, die Stunden lang anhielten, Gicht und ein doppelter Bruchschaden quälten seinen Körper wechselweise, so daß selten eine Stunde ohne irgend ein Leiden verging. Unter allen diesen Quaalen, besonders wenn er dem Tode nahe zu seyn glaubte, verließ ihn nie sein guter Humor und er selbst heiterte seine Freunde auf über ihre Besorgniß um ihn. Ich habe oben gesagt, daß er sich mit Medicin abgab. Das einzige, was ihn in Krankheiten unmuthig machen konnte, war, wenn in seinem Gefühl der Besserung, das er sehr genau beobachtete, er die Ahnung des Mittels zu seiner Genesung nicht enträthseln konnte. Kam er aber auf ein Mittel, so suchte er dessen mit der größten Begierde habhaft zu werden, wenn es auch das kostbarste war. Half das Mittel nicht, so sann er ganz geruhig auf ein anders; brachten ihm aber seine Leute etwas anders, als er haben wollte, so konnte er sehr böse werden und es lange bleiben. Gegen nichts war er so hart, als wenn seine Leute nachlässig gegen ihn waren; allein er selbst ließ es auch seinen Leuten, die er zwar nach seinem Vermögen, aber honett und ordentlich bezahlte, an nichts fehlen, besonders wenn sie krank waren.
Im Jahre ► 1783 kam der Königl. Kapellmeister Reichardt aus Italien zurück und brachte unter andern musikalischen Seltenheiten eine Sechszehnstimmige Messe des Orazio Benevoli mit, die er Faschen sogleich mittheilte. Dieser schrieb sich die Partitur ab; eine Menge der sonderbarsten Schreibfehler, die verbessert werden mußten, lenkten die Aufmerksamkeit nach und nach tief in das Werk hinein, und bei dieser Gelegenheit kam Fasch auf seine alte Neigung zum vielstimmigen Satze zurück. In der Partitur des italienischen Meisters fanden sich Freiheiten, deren man bei aller Schwierigkeit dieses Satzes nicht bedurfte, und das Ganze war, wenn der Satz über das Vierstimmige hinaus ging, ein, zwar in seiner Einrichtung ziemlich regelrechtes und kunstreiches, aber höchst monotonisches Spiel versetzter Intervalle, ohne Modulation.[S. 26] Fasch behauptete, daß der vielstimmige Satz eine eigne Kraft habe, und daß es kein eitles Unternehmen sey, für die Kirche und sonst unter Umständen, sechzehnstimmig zu setzen, besonders wenn der Satz vierchörig sey. Diesen vierchörigen Satz hielt er für das nehmliche im Großen, was der vierstimmige Satz im Kleinen sey und deshalb legte er sich selbst die Regel auf: daß jeder Chor in sich selbst reinstimmig seyn müsse. Mit diesem Vornehmen ging er nun selbst daran, die Messe sechszehnstimmig in Musik zu setzen. Das ganze Stück ward in wenigen Wochen geendigt und ich erinnere mich genau, daß er die letzte sechszehnstimmige Fuge in zwei Tagen vollkommen fertig gemacht, zweimal rein abgeschrieben und ein Exemplar der Prinzessin Amalia überbracht hatte und darauf nach Potsdam reisete. Was er in seiner Arbeit besonders besser gemacht hatte, als der italienische Meister, betraf die Modulation und den edeln ausdrucksvollen Gesang; denn Benevoli hatte seine Messe vor 170 Jahren geschrieben. Diese Arbeit aber zog Faschen einen so anhaltenden Bluthusten zu, daß er lange nicht wieder daran denken durfte. Seine Absicht dabei war damals keine andere, als bloß sich zu beschäftigen. Er glaubte sein Ende nahe und wollte nebenher, wo möglich, ein Werk hinterlassen, woraus vielleicht einmahl wieder nach 170 Jahren irgend ein Kenner sehen möge, daß es um diese Zeit noch einen deutschen Harmonisten gegeben, der sich an den sechszehnstimmigen Satz gewagt und ihn bestanden habe. Kirnberger war eben gestorben, und was die Prinzessin Amalia von dieser Arbeit hielt, habe ich nie erfahren; das Exemplar von der Fuge aber, wie sie damals war, besitze ich noch. Die Messe war also fertig, aber nun wollte er auch Genugthuung für seine Arbeit haben und hören was er gemacht hatte. Alle königliche und andre Sänger in Potsdam, die ihn herzlich liebten, waren ihm dazu sehr gern behülflich. Die Messe ward mit einigen zwanzig Sängern, die in vier Chöre vertheilt waren, an einem Privatorte aufgeführt; allein der Effect war gänzlich dazu gemacht, unsern edeln Meister von seiner ganzen beabsichteten Kunst zu kuriren. Die Ursache war natürlich: die Sänger waren brave Leute, aber [S. 27] seit lange nicht daran gewöhnt, Kirchensachen, deren Wirkung auf Haltung und Tragung der Stimme beruht, vorzutragen. Fasch ließ sich dadurch nicht abschrecken. Er nahm die Schuld des wenigen Effekts auf sich und versicherte jene, daß, wenn er nur dies und das an seiner Arbeit werde vrrbessert [sic!] haben, die ganze Sache besser gehen werde. Noch ein Versuch ward angestellet und dann noch einer, doch nun durften die gefälligen Leute nicht zu oft incommodirt werden; die Sache gerieth ins Stecken und kurz, hier war weiter nichts zu machen. Die Berliner Singchöre wurden nun aufgefordert und die Proben in der Kirche gemacht, wo man noch den Vortheil haben kann, solche nach der Absicht dieses vierchörigen Satzes, auf bestimmte Weiten auseinander zu bringen. Allein alle diese Proben liefen so gut als unglücklich ab. Der beste Wille, den die Choristen zeigten, war viel werth; man hatte aber zu bedenken, daß billigerweise gar nichts von ihnen zu fordern war; daß guter Wille und Stimme zwar viel, aber nicht genug seien, um ein so vielfach großes Werk mit einigem Erfolg vor das Ohr zu bringen. Und so war die Sache nach jedem mühvollen Versuch immer wieder auf dem alten Fleck und alles, was herauszubringen war, gab die Weisung, daß die ganze Intention falsch speculirt sey und an der Erfahrung scheitere[6]). Noch fühle ich den Jammer, mit welchem mich diese mißlungene Versuche erfüllten, wenn ich den edeln Mann nach Hause eilen sah, in sich gekehrt, gescheucht, beschämt, mit zerißnem Herzen; sein großes Ideal, das er so warm gehegt und gepflegt, reducirt auf Vision und Hypothese. Was ihn vor allem ängstigte, war die Furcht, die Leute zu ermüden, deren er so nothwendig bedurfte. Er mußte sich stellen, als wenn er noch so zufrieden mit allem wäre, sonst wäre vielleicht keiner wieder gekommen.
[S. 28] So mangelhaft und wenig entsprechend im Ganzen diese Versuche waren, so ließ doch hin und wieder eine Messe, die wie von ungefähr gerieth, einige Hofnung blicken, von dem was seyn könnte, und wenn man ganz billig seyn wollte, so war der Effekt von einer bloßen einstweiligen Speculation nicht gleich so rein und unvermischt zu verlangen als er in dem Gemüth eines tiefdenkenden Künstlers entstanden war.
Im Jahr 1786 starb der König. Der Kapellmeister Reichardt kam von Paris und componirte die Trauermusik zur Bestattung dieses Monarchen. Fasch componirte dazu eine neue Orgelfuge, die er selbst spielte; er glaubte, jetzt auf Pension gesetzt zu werden und nun hielt er seinen Dienst für vollendet. Da der Kronprinz auch eine Kapelle unterhalten hatte; so ward eine neue Einrichtung nöthig. Der neue Monarch befahl, beide Kapellen zu vereinigen. Mehrere Gehalte wurden verbessert; doch Fasch behielt seine vierhundert Thaler, ohne pensionirt zu seyn. Ein ganz neues Leben ging demungeachtet für ihn an. Nur sein Leiden konnte ihn noch an den Tod erinnern. Alle seine Spielsachen wurden zerstört und dem Feuer überantwortet. Seine Listen der Regimenter und Linienschiffe, Kartenhäuser und alles, was ihn nur an sein voriges Leben erinnern konnte, ward zerschnitten und er fing damit an, die Theorie der Tonkunst aufs neue zu bearbeiten, worin ihm große Lücken zu seyn schienen. Er las mit Emsigkeit alles, was darüber geschrieben war, versahe es mit Bemerkungen und behielt die wenigen Lektionen bei, die ihm in seinen langen Krankheiten übrig geblieben waren. Unter diesen Spekulationen kam er auch an ► die Eulersche Erfindung des Tons J oder 1/7, dessen praktischen Gebrauch er erst nach fünf Jahren fand und sehr viel auf diese Erfindung hielt. Darüber kam das Jahr 1789 heran.
Fasch unterrichtete eine junge vortrefliche Dame[7]) und accompagnirte ihr [S. 29] oft ihre Arien. In dem Hause dieser edeln Musikliebhaberin fanden sich öfter noch zwei oder drei Musiklustige ein; daraus entstand sehr bald ein kleines Vocal-Concert. Fasch componirte für diese kleine Gesellschaft nach und nach mehrere vier- fünf- und sechsstimmige Stücke, so daß nach und nach sich immer mehr Theilnehmer fanden, die eine Art von Chor bildeten, der aus lauter Lehrbegierigen bestand, die die Kunst ihres weisen Meisters mit allen Sinnen zu fassen suchten. Diese Gesellschaft, welche sich bisher nur wie von ohngefähr zusammen gefunden hatte, bestimmte nun einen gewissen Tag jeder Woche zu ihren ordentlichen Singübungen, und wuchs durch den Zutritt neuer Mitglieder bald so an, daß der bisherige Raum nicht mehr hinreichend war, alle Personen zu fassen und also die ganze Sache in ihr voriges Nichts zurückgesunken seyn würde, wenn nicht eine andere würdige Freundinn des Schönen[8]), die ehemals eine vortrefliche Sängerin war, von treuer Liebe zur Musik beseelt, ihren größern Saal zu den Singübungen hergegeben hätte. Es war das Jahr 1791. Die Gesellschaft bestand hier aus zwanzig Personen, unter denen auch Sänger von Profession waren. Es wurden nun immer neue Singstücke nothwendig, die Fasch componirte und auf diese Art entstand gleichsam nebenher ein achtstimmiges Miserere, das den Namen seines Meisters unsterblich erhalten wird, so lange die Musik eine Kunst ist. Die Gesellschaft wuchs nun an Zahl und Qualität von Zeit zu Zeit dergestalt an, daß im Jahr 1792 die Anzahl der bestimmten Mitglieder 30 war, zu denen sich noch immer Virtuosen der ersten Klasse gesellten und ihr Vergnügen dabei fanden.
Am Ende des Jahres 1792 erhielt die Gesellschaft von den beiden Curatorien der Königlichen Akademieen der Wissenschaften und der schönen Künste, die Erlaubniß, sich eines der Sale im Akademie-Gebäude zu ihren Singübungen bedienen zu dürfen. Nun wurde aber eine bestimmte Einrichtung der Öconomie nothwendig. Fasch wählte aus den Mitgliedern der Gesellschaft drei weibliche [S. 30] und drei männliche Personen, die bisher das meiste Interesse für die Sache gezeigt und von verehrtem Ruf und Charakter waren[9]). Diesen sechs Personen übertrug er das Vorsteheramt der ganzen Gesellschaft und die Öconomie derselben. Es wurde eine Kasse errichtet, von welcher der erste Vorsteher die Rendantur über nahm. Zu dieser Kasse zahlte jedes Mitglied monatlich einen halben Thaler, und aus derselben wurden die Kosten für Erleuchtung, Heitzung, Stimmung des dirigirenden Flügels, Aufwartung und Reinigung der Zimmer bezahlt. Die übrigen Functionen der Vorsteher und Vorsteherinnen bestanden darinne: die neuen Mitglieder unter sich vorzuschlagen, vorzustellen, sie mit der bisher beobachteten Ordnung der Dinge bekannt zu machen und gegen alles zu beschützen, was diese Ordnung stören könne, besonders da sich voraus sehen ließ, daß an dieser Anstalt junge Töchter und Söhne der angesehensten Familien aus Berlin, Antheil nehmen mögten. Für die Musik selbst und den Unterricht ward nichts bezahlt. Fasch componirte für das Institut, schrieb alle Stimmen eigenhändig und so vielfach, daß jede Person eine eigne Stimme haben konnte, unentgeldlich, und bezahlte auch, ehe die Gesellschaft zahlreich genug war, seinen Beitrag. Übrigens waren von diesen Geldbeiträgen alle andere Musiker ausgenommen, da diese schon genug für die Sache thun, wenn sie ihre Zeit dem Institute widmen. Das Directorium der Musik bestand allein aus Fasch, der den ganzen Chor, vor einem Flügel, mit dem bloßen Accompagnement, ohne Taktschlagen oder andere störende Merkzeichen dirigirte, welches sehr gut von Statten ging. Von nun an dankte Fasch alle seine übrige Lectionen ab, um sich ganz der Gesellschaft zu überlassen. Er componirte unablässig Psalmen und Motetten; kopirte mit der größten An-[S. 31] strengung seiner Kräfte viele Stücke mehrerer Meister und vervielfältigte die Stimmen. Fast für jede allgemeine Landesbegebenheit lieferte er etwas Neues. Er componirte ein Requiem und mehrere Trauermusiken auf den ► Tod der Wittwe Königs Friedrich II, des Prinzen Ludwig und des Königs Friedrich Wilhelm II. Das Interesse, welches mehrere Componisten der ersten Klasse, um Faschens willen, an diesem Institute nahmen, trug sehr viel zur Dauer und Befestigung der Anstalt bei. Hr Kapellmeister Naumann lieferte den meisterhaften hundert und eilften Psalm; Hr Kapellmeister Reichardt lieferte den treflichen Morgengesang am Schöpfungsfeste von Milton; Hr Kapellmeister Himmel componirte eine italienische Motette auf die Genesung des Königs und außerdem wurde von Fasch dafür gesorgt, dnß [sic!] es nie an Stücken fehle, die Gesellschaft zu unterhalten. Die Anstalt besaß durch den Eifer ihres Stifters binnen wenigen Jahren einen Schatz von ausgeschriebenen Musiken, unter denen außer den eignen Compositionen des Stifters und den für diesen Endzweck verfertigten Produkten neuerer Meister, viele Werke der Sebastian Bach, Durante, Leo, Händel, Cannicciani, Benevoli, Graun, Hasse, Pränestini, Marcello, Mozart, Schulz, Kirnberger, Allegri und anderer, wechselweise die Singstunden ausfüllten.
Im Jahre 1793, bei einem mehr ausgedehnten Locale, war die Gesellschaft schon bis zu 55 ordentlichen Mitgliedern angewachsen, zu denen sich immer mehrere Sänger von Profession gesellten. Der Königliche Bassist Fischer und seine würdige Gattinn, welche letztere einen schönen Contraalt und einen treflichen Triller in ihrer Gewalt hat, erhöheten das Interesse durch ihren Beitritt. Nun konnten schon vierchörige Compositionen eingeübt werden. Die vier Chöre wurden vertheilt und in verschiedenen Weiten dergestalt auseinander gestellt, daß der Flügel das Centrum war. Bei jedem Chor war anfänglich ein Subrektor mit einer kleinen Partitur, jedoch als mitsingende Person angestellt, bis das Stück so weit eingelernt war, daß der Flügel allein das Ganze dirigiren konnte. Im Jahr 1794 waren 64 Mitglieder, und nun durfte es schon gewagt werden, [S. 32] an den Singübungen auch Zuhörer Antheil nehmen zu lassen. Im Jahre 1796 waren 83 Mitglieder und es wurden mehrere sechszehnstimmige Messen von Cannicciani und Benevoli gesungen.
In diesem Jahre ward es durch das ordnungsmäßige und eifrige Bestreben der Rendantur so weit gebracht, daß vom Herbst an, den ganzen Winter hindurch und alle folgende Jahre, die Frauenzimmer der Gesellschaft bei einem mäßigen Zuschuß zur Kasse, in Wagen abgeholet und wieder zu Hause gefahren werden konnten, so daß keine Veränderung der Witterung mehr hinderlich war, einen vollständigen Chor beisammen zu sehn. Ein runder hoher und heller Saal von etwa 10 Quadratruthen Inhalt, war für den beständigen Gebrauch der Gesellschaft jede Woche zweimahl offen. Die Montagsstunden von 5 bis 7 Uhr Abends machten die Vorübung aus, welche besonders dazu diente, die neuen Glieder der Gesellschaft den Geübtern näher zu bringen und solchen Lehrbegierigen, die besondere Lust bezeugten, so weit zu helfen als möglich. Der Dienstag darauf war für das Vollständige bestimmt, wobei sich dann fast immer, mehr oder weniger, tüchtige Sänger von Profession einfanden, ihr eigenes Vergnügen an schönen Musikwerken hatten und ihren Vortrag zum Muster der Nachahmung aufstellten.
Im Jahre 1797 war das Personale hundert Mitglieder stark und vermehrte sich gegen das Ende des Jahrhunderts auf hundert und acht und vierzig Personen, welche einen Chor von 70 Sopranen, 28 Altstimmen, 24 Tenören und 26 Bässen ausmachten, der zwar selten ganz beisammen, aber auch selten unter 80 Personen stark ist. Mancher erfahrne Musikdirektor mag sich wundern, wie ein solcher Singechor ohne irgend ein äußeres Mittel als einen einzigen guten Flügel könne im Takt erhalten werden[10]), auch ist dazu außer den bekannten Eigenschaften eines [S. 33] Musikdirektors, eine gewisse körperliche Kraft; eine innre Sicherheit und ein ruhiger Muth unentbehrlich. Das Hauptsächlichste besteht aber darinne: daß der Chor an diese Direction und an eine gewisse Schwingung der Flügelsaiten so gewöhnt ist, daß jeder Director, der seiner Sache gewiß ist, seine Bewegung nehmen und ändern kann wie er will, und zuversichtlich jedesmahl auf die Nachfolge des sämmtlichen Chors hoffen kann. Der Kapellmeister Reichardt, der Abt Vogler und mehrere jetzt lebende Meister, die ihre eigene Compositionen in dieser Gesellschaft dirigirt haben, müssen diese Direction immer so leicht gefunden haben, wie jede andere, die aus geübten Artisten bestand.
Eine höchst wichtige Sache bei einer solchen Gesellschaft ist die moralische Tendenz derselben. Die vollkommenste Achtung und Neigung und ein festes Vertrauen der Gesellschaft zu ihrem Director, in jeder Hinsicht, die die Kunst und das Leben betrift, sind unerläßliche Erfordernisse. Wenn dieser Director, in Vertheilung und Anordnung der ganzen Musik, nicht die vollkommenste Freiheit hat, und sich derselben nicht auf das Würdigste bedient, ist nichts davon zu hoffen. In einer Gesellschaft, die sich als Gesellschaft bildet, fühlen alle zusammen, wie jeder einzeln fühlt, und wenn der Director seine besondere Neigung zu dieser oder jener Person mit seiner Function vermengt, so setzt er dadurch das ihm gebührende Vertrauen aufs Spiel.
Faschens Absicht war keinesweges, eine Singschule zu stiften oder Sänger zu bilden. Da er selbst kein Sänger war, so wollte er dieß gern denen überlassen, die ihm hierin an Talent und Kräften überlegen waren. Er wollte sich weder dem Strom der Zeit, noch der herrschenden Liebhaberey entgegen legen; er wollte den Neid auch nicht eines Kunstgenossen erregen; er wollte nur helfen! Am allerentferntesten aber war er von dem, was ihm so mancher rieth: einen Erwerbszweig für sich aus dieser Anstalt zu machen; denn er hielt sich für fest überzeugt, daß die Singakademie, ohne die einfache unverrückte Hinsicht auf den einzigen allgemeinen Zweck der Kunstbeförderung nicht bestehen könne. Seine Absicht war [S. 34] und blieb keine andere, als: eine Art von Kunst-Corps, das man allenfalls Akademie nennen könnte, für die heilige Musik zu stiften, wo sich jeder ernsthafte Freund dieser Kunst anschließen und durch eigne Mitwirkung so viel Genugthuung verschaffen könnte, als möglich ist. Hierauf sann und arbeitete er früh und spät, obgleich unbemerkt, und der Erfolg krönte seine schöne Absicht. Die Wiege der Gesellschaft war das Haus eines der edelsten und rechtschaffensten Männer von Berlin gewesen. Der anständige, freie, freundliche deutsche Ton dieses Hauses, war der Ton der Gesellschaft geworden und ist es geblieben. Jeder Fremde und jedes hinzutretende Mitglied fand darin etwas, wo die Tugend gern verweilt: Aufmerksamkeit ohne sichtbare Anstrengung, Schönheit ohne Vorzug, Mannigfaltigkeit aller Stände, Alter und Gewerbe, ohne affektirte Wahl; Ergötzung an einer schönen Kunst, ohne Ermüdung; ein freundliches, wohlverziertes, geräumiges Zimmer; die Blüthe des schönen Berlin; die Jugend und das Alter, den Adel und den Mittelstand; die Freude und die Zucht; den Vater und die Tochter; die Mutter mit dem Sohn und jede Vermischung von Geschlechten und Ständen, die, gleich einem Blumengarten im Frühling, den feinsten Sinn bildsamer und gebildeter Menschen nur ergötzen kann.
Diese Gesellschaft erschuf und erzog sich selber; regierte, ernährte, richtete und beschützte sich selber; ohne weite Plane, ohne Förmlichkeit und strenge Justiz – und in dieser Verfassung hat sie ihr Stifter hinterlassen.
Er starb, nach einem vier und sechszigjährigen Leben voll Quaal, Mühe und Sorge für seine Erhaltung, am dritten August des Jahres 1800, und hinterließ diese Gesellschaft als seine Familie, von der jedes Glied seinen Tod schmerzlich beweint, und die unsterblichen Werke, die er für diese Gesellschaft geschrieben hat. Am siebenten August des Morgens wurde er bestattet. Es war ein herbes unfreundliches Wetter und ein dichter feiner Regen machte die Luft zum Körper. ► Am Grabe fand sich eine seiner ehemaligen Schülerinnen, eine Mutter von vielen Kindern, von Thränen und Regen fast aufgelöst und begleitete den Rest seines [S. 35] körperlichen Daseyns mit ihren nassen Blicken bis in die Thür des Todes. Zu seinem Andenken führte die Gesellschaft am achten October darauf, Mozarts Requiem in der hiesigen Garnison-Kirche auf. Das Auditorium war zahlreich und die Einnahme, welche über zwölfhundert Thaler betrug, wurde zu einem ► eisernen Fond bestimmt, von dessen Zinsen alle Jahre wenigstens Eine arme Bürgerfamilie unterstützt werden und den Urheber segnen kann, und dieses Kapital wurde mit dem Namen Fasch belegt.
Zwei Jahre vor Faschens Tode wurde sein zwei und sechszigster Geburtstag von der ganzen Singakademie gefeiert. Der Kapellmeister Reichardt war die Veranlassung zu dieser Feier. Fasch wußte von nichts, und ich hatte ihn an diesem Tage zu einem freundschaftlichen Mittagsmahle in meinem Hause eingeladen. Reichardt sollte ihn im Wagen abholen und zu mir bringen. Die Gesellschaft, welche an diesem Tage durch die Gegenwart mehrerer Freunde über zweihundert Personen stark war, hatte sich gegen Mittag in einem geräumigen Hause versammelt, um ihren Stifter zu empfangen und zu bewirthen. Alles dazu war in Bereitschaft. Reichardt hatte ein Gedicht von Tieck und ich eins von Bürde in Musik gesetzt, womit der ganze Chor seinen Freund begrüßen wollte. Eine allgemeine heitere Stimmung verkündigte einen Tag der Freude. Es währte sehr lange, endlich kam – Reichardt allein. Dieser trat in den Saal, aufs höchste bewegt und brachte der Gesellschaft die traurige Nachricht: daß Fasch sehr krank und unvermögend sey zu erscheinen; er habe alles angewandt, ihn zu bewegen, zuletzt habe er ihn von allem unterrichten müssen, um ihn auf etwas mehr als ein stilles Mahl vorzubereiten; aber seine Schwäche sey so groß, daß man ihn ohne Gefahr nicht herbringen könne. Der Generalchirurgus ► Görcke, sein letzter Arzt, eilte zu ihm, seinen Zustand zu untersuchen; auch dieser kam allein zurück, und so war dieser Tag ein Fest der Trauer geworden. Die Gesellschaft setzte sich an den Tisch. Nach zwei Stunden kam Fasch von selber und allein. Auf sein Bitten hielt sich alles ruhig und er setzte sich an seinen offen gelaßnen Platz. ErZwei Jahre vor Faschens Tode wurde sein zwei und sechszigster Geburtstag von der ganzen Singakademie gefeiert. Der Kapellmeister Reichardt war die Veranlassung zu dieser Feier. Fasch wußte von nichts, und ich hatte ihn an diesem Tage zu einem freundschaftlichen Mittagsmahle in meinem Hause eingeladen. Reichardt sollte ihn im Wagen abholen und zu mir bringen. Die Gesellschaft, welche an diesem Tage durch die Gegenwart mehrerer Freunde über zweihundert Personen stark war, hatte sich gegen Mittag in einem geräumigen Hause versammelt, um ihren Stifter zu empfangen und zu bewirthen. Alles dazu war in Bereitschaft. Reichardt hatte ein Gedicht von Tieck und ich eins von Bürde in Musik gesetzt, womit der ganze Chor seinen Freund begrüßen wollte. Eine allgemeine heitere Stimmung verkündigte einen Tag der Freude. Es währte sehr lange, endlich kam – Reichardt allein. Dieser trat in den Saal, aufs höchste bewegt und brachte der Gesellschaft die traurige Nachricht: daß Fasch sehr krank und unvermögend sey zu erscheinen; er habe alles angewandt, ihn zu bewegen, zuletzt habe er ihn von allem unterrichten müssen, um ihn auf etwas mehr als ein stilles Mahl vorzubereiten; aber seine Schwäche sey so groß, daß man ihn ohne Gefahr nicht herbringen könne. Der Generalchirurgus ► Görcke, sein letzter Arzt, eilte zu ihm, seinen Zustand zu untersuchen; auch dieser kam allein zurück, und so war dieser Tag ein Fest der Trauer geworden. Die Gesellschaft setzte sich an den Tisch. Nach zwei Stunden kam Fasch von selber und allein. Auf sein Bitten hielt sich alles ruhig und er setzte sich an seinen offen gelaßnen Platz. Er [S. 36] ] hatte alle seine Kraft zusammen gefaßt, sich anzukleiden und sich seinen Freunden wenigstens zu zeigen; allein es war kein Anblick der Freude. Man sah ihm den Zwang an, sich aufrecht zu erhalten; auf seinem Gesichte kämpfte seine natürliche Anmuth mit dem Gefühl bittrer Leiden. Ich will nicht sagen, was ich gelitten habe; ein jeder war erschüttert. Fasch war schon seit mehrern Wochen sehr krank und ich fürchtete heimlich, daß diese starke Rührung ihm den Tod geben könnte, doch er hielt sich. Ein Glas des besten Weines stärkte ihn. Das Fest mit seinen Anstalten war ihm bis auf die letzte Stunde geheim geblieben. Es wurden bei Tische vom ganzen Chor, der aus hundert und funfzehn [sic!] singenden Personen bestand, mehrere neue fröhliche Lieder gesungen, die er mit Wohlgefallen und Heiterkeit anhörte. Als ihm die Gedichte gereicht wurden, war er sehr bewegt. Nach Tische ward Reichards Musik noch gesungen, womit das Fest hatte anfangen sollen, und vor dieser Musik hielt der zweite Vorsteher der Gesellschaft, Professor Hartung, eine kurze Rede. Nun war es Zeit aufzuhören. Fasch mußte wieder nach Hause und diese Anstrengung war von keinen gefährlichen Folgen. Das Fest aber war noch eines eignen Umstandes wegen merkwürdig. Unter der eilfjährigen Regierung Friedrich Wilhelm II, ward, wie schon bemerkt, die königliche Kapelle erweitert, ihre Gehalte vermehrt und durch die Herbeirufung und wirklich königliche Bezahlung vorzüglicher fremder Meister, zu einer der besten in Europa erhoben. Fasch ward nicht, wie er gehofft hatte, auf Pension gesetzt und verrichtete noch seinen Dienst. Er war vergessen worden und lebte wirklich jetzt, da er durch Unterricht nichts mehr verdiente, bei seinen vierhundert Thalern nicht ohne Sorge. Der folgende Monarch, Friedrich Wilhelm III, von dem man für die Musik gar nichts hoffte, richtete einen seiner ersten königlichen Blicke auf einen alten treuen Diener seines großen Vorfahren und verherrlichte dieses Fest zur grenzenlosen Freude der Gesellschaft, dadurch: daß er dem würdigsten Meister der Kunst in seinem Lande, unerwartet und ohne seine Bitte, eine jährliche Zulage von hundert Thalern anwieß. Diese Begebenheit machte einen eignen Eindruck auf unsern Freund.
[S. 37] Er war in dieser Zeit sehr krank und dem Tode nahe. Seine Sehnsucht nach höherer Hülfe und sein heißer Wunsch um Auflösung seines quaalvollen Lebens, hatten über sein schönes Antlitz eine Art der Verklärung ausgegossen, die schmerzlich rührend war. Gerade um diese Zeit und durch die schwere und kostbare Krankheit, wollte sein sehr weislich vertheiltes Geldeinkommen nirgends mehr zureichen, und er mußte sogar aufhören, gewisse einmahl in seinen Ausgaben aufgenommene Wohlthaten einzuziehen. Er hatte ein kleines Kapital zurück gelegt, das er nicht angreifen wollte, weil er schon darüber verfügt hatte. Er wollte jetzt eins seiner Werke herausgeben, aber es wollte sich kein Verleger finden, der etwas dafür bezahlte. In dieser Noth war er eines Abends auf seinem Stuhl eingeschlummert; er glaubte seinen König Friedrich den Großen vor sich zu sehn und machte ihm bittere Vorwürfe, sein Versprechen nicht gehalten zu haben, weshalb er jetzt dem Kummer um seine Erhaltung ausgesetzt sey. Am andern Morgen kam der Brief des jungen Königes, der die Zulage nebst der Anweisung auf die königliche Kasse enthielt.
Ich hatte dreihundert Thaler von ihm in Verwahrung, die ich ihm bis an seinen Tod mit fünf Prozent verzinsen mußte; von diesem Gelde sollte ich nach seinem Tode die sechszehnstimmige Messe stechen lassen. Ich bot ihm dieses Geld oft genug wieder zurück und versprach ihm: die Messe solle doch gestochen werden; allein er wollte niemals einwilligen und das Geld wieder nehmen.
Er bekam öfter Geldbeiträge von unbekannter Hand zugeschickt, mit der Bitte, solche zu seiner Pflege zu verwenden, von denen er aber für sich keinen Gebrauch machte, sondern solche, da sie nicht zurück zu geben waren, an arme Künstler und solche Leute, die noch ärmer waren als er, vertheilte. Das letztemahl hatte ihm ein Wohlthäter drei Friedrichsd’or geschickt, die er mir sogleich nebst dem angenehmen Briefe zeigte; er bat den gütigen Geber durch die Zeitung, dieß Geld zurückfordern zu lassen, und da dieß nicht geschah, kaufte er davon den braven ► Organisten Stöckel einen Taktmesser ab, den er zur Ansicht auf der Akademie ausstellte, das übrige vertheilte er anderweitig.
[S. 38] Diese Handlungsweise war bei ihm ohne alle Affectation, und lag in einem zarten innern Takt, dem er beständig gemäß handelte. Es kränkte sein Ehrgefühl, sich Wohlthaten erzeigen zu lassen und nichts würde ihn bewogen haben, selbst den König seinen Herrn, um etwas für sich zu bitten. Er konnte nur fordern und eine abschlägige Antwort hätte vielleicht seinen Tod nach sich gezogen. Er wußte sich im Dienst keines Versehens schuldig; er war alt und außer der Mode, so beurtheilte er sich. Sein König, dem er treu gedient hatte, war nach seinem Gefühl verbunden, ihn anständig zu erhalten; dieser lebte nicht mehr und das war eigentlich das größte seiner Leiden, daß ein so großer und guter Mann, den zu lieben er sich durchaus gedrungen fühlte, nicht besser für ihn gesorgt hatte. Übrigens war er weit entfernt, seinem Könige dieß als einen Fehler anzurechnen; er fing niemals an davon zu reden und hielt dieß für sein Schicksal; ja, er entschuldigte den König, wenn die Rede davon war: wie zu einem Prinzen und zu einem Dichter, so würde man, meinte er, auch zu einem Jahrgehalte gebohren, das man nicht verzehren könne.
Am dritten Junius 1800 war er zum letztenmahle auf der Singakademie und konnte sich kaum stehend erhalten. Den folgenden Tag sagte er mir schon: er befände sich so übel, daß dieß wohl seine letzte Akademie gewesen seyn würde. Bei diesem Vorgefühl seines Todes blieb er auch. Ein unaufhörlicher Schlucken kurz hintereinander, peinigte ihn Tag und Nacht beinahe zwei Monathe lang. Demungeachtet schrieb er für die Akademie beständig Singstimmen doppelt und in den Stunden einiger Ruhe setzte er seine theoretischen Blätter fort, woran er mit vieler Lust arbeitete. So wie sich die Gewißheit seines Todes immer mehr bestätigte, fing er an, seine Schränke auszuleeren, alle seine Briefe und solche Compositionen, die er bis zur sechszehnstimmigen Messe gemacht hatte, sorgfältig verbrennen zu lassen. Er hatte mir die Heraussuchung dieser Sachen aufgetragen, weil ich sie fast alle kannte. Auf mein vieles Bitten ließ er ein einziges Concert am Leben, das er mir schenkte. Er hatte das Oratorium: Guiseppe riconosciuto [S. 39] von Metastasio componirt, das ich von Kirnbergern ungemein hatte erheben hören. Ich bat ihn, mir dieses Oratorium zu hinterlassen; er schlug es ab. Ich wollte wissen, warum er so grausam gegen ein eignes gutes Werk verführe? Solcher Sachen giebts genug in der Welt, sagte er. Ich war sehr bewegt. Nach einigem Sinnen ging er still an den Schrank, und zog aus dem Oratorium ein Heft heraus, das er mir gab. Ich nahm es und legte es still auf sein Klavier, ohne es anzusehn. Eine Menge Klavier- und Singsachen schenkte er an seine Freunde und Schüler. Alle übrigen Werke von Seb. Bach, C. P. E. Bach, Leo, Hasse; ingleichen seine eigne Arbeiten, die er alle eigenhändig für die Singakademie geschrieben hatte, ohne Ausnahme; seine musikalischen Bücher und die wenigen übrig gebliebenen Manuscripte, wovon mehrere kurz vor seinem Tode geschrieben sind. Sein Klavier sein Pedal, seine Violine und Flöte hatte er schon in seinem Testamente mir vermacht, doch fragte er mich vorher: ob ich sie auch als ein Andenken von ihm annehmen wolle? Eines Morgens sagte er mir, mit einer Art von Triumph: daß nun alles glücklich verbrannt sey! Er hatte alles von einem sichern und ganz antheillosen alten Manne verbrennen lassen, den er überreichlich dafür bezahlte. Mir trauete er hierin nicht, denn er fürchtete, daß ich nicht alles verbrennen möchte.
Als er mit der Vertheilung seiner Sachen, worunter sich auch Mobilien, Wäsche, Bücher und vielerlei kleine Andenken befanden, so weit fertig war, daß er nur noch die wenigen Sachen zum nothdürftigen Gebrauch übrig hatte, fragte er seinen Arzt: wie lange er noch würde leiden müssen? Der Arzt versprach ihm eine baldige Auflösung, die in wenigen Tagen erfolgen müsse. Von dieser Zeit an ward sein Gesicht, das bisher finster und sorgsam gewesen, heiterer und er sprach oft lebhaft: wie er jetzt so viele Dinge (die die Harmonie und Fortpflanzung des Schalles betreffen) so klar und deutlich sehe, daß er sein Unvermögen bedaure, solche aufschreiben zu können. Er fing von Zeit zu Zeit an, mir darüber mündliche Aufschlüsse geben zu wollen, aber seine Rede starb ihm auf den Lip-[S. 40] pen. Ich fragte ihn: ob er mir nichts mehr für die Singakademie aufzutragen hätte? Bringen Sie ihr meinen Tod, sagte er, und mein Lebewohl! Wenn es möglich ist, werde ich immer bei Ihnen seyn; Sie sind mündig; gedenken Sie meiner so wie ich Sie kenne!
Den Tag vor seinem Tode setzte er sich des Morgens an sein Klavier, nahm das Heft, welches er mir aus seinem Oratorium geschenkt hatte und legte es vor. Es war das Recitativ aus dem Oratorio Guiseppe, wo Juda den Joseph durch heißes Bitten zu bewegen sucht den Bruder Benjamin loszugeben um zum Vater zurückkehren zu können. Ich stellte mich neben ihn und sang, er accompagnirte und helle Thränen bedeckten sein Gesicht.
Für sein Begräbnis hatte er alles verordnet. Besonders hatte er befohlen, daß vor seiner Leiche alle Chöre von Berlin singen sollten und zur Bezahlung dieser Chöre eine Summe in seinem Testament festgesetzt. Ich fragte ihn: ob die Chöre etwas von seiner Arbeit singen sollten? Nein! sagte er, die Arie von Graun und ► Klopstock lassen Sie singen: Auferstehn wirst du. Das andere können Sie wählen. Ich wählte dazu aus dem ► Porstischen Gesangbuche die Nummern: 880 Vers 1 bis 5, und 882 Vers 1, 8 und 9. Er hatte in frühern Tagen, wo er am Schlage zu sterben fürchtete, befohlen, seine Leiche zu öfnen, oder ihm die Adern zu schlagen, denn er fürchtete lebendig begraben zu werden und sprach davon mit dem größten Abscheu. Nach seinem Tode fand der Arzt diese Vorkehrungen nicht nöthig; darüber ließ ich den Körper drei Tage und vier Nächte unbestattet, bis die augenscheinliche Verwesung eintrat.
Zwölf Wochen vor seinem Tode malte der ► berühmte Graf aus Dresden noch sein Bild, wovon der Kopf ausnehmend schön gerathen ist, das Übrige am Bilde ist nicht fertig worden. Ich besitze nun zwei sehr ähnliche Gemälde, von welchen das eine von der würdigen ► Madame Henry, Tochter des berühmten Daniel Chodowiecky gemalt ist und eine ► trefliche Zeichnung von meinem Freunde dem Bildhauer Schadow.
[S. 41] Nach seinem Tode wurde sein Gesicht abgeformt, um darnach ein Brustbild in weißem Marmor in der Akademie aufzustellen. Für jetzo ist bereits ein Gipsausguß nach dem Modell in der Akademie aufgestellt, bis der Marmor fertig ist.
Am Tage seines Todes kam ich gegen Mittag zu ihm. Sein ehemaliger sechs und achtzigjähriger Arzt, den er sehr liebte, war bei ihm gewesen; es hatte eine Abschiedsscene gegeben, die ihn sehr erschüttert hatte. Doch war er heiter und sagte mir: er habe heute die erste Hofnung, daß er an dieser Krankheit noch nicht sterben werde. Was soll ich denn hier machen? setzte er hinzu; ich habe alles weggegeben, ich muß ja sterben! Der Schlucken hatte nachgelassen und seit langer Zeit hatte er nicht so viel Ruhe gehabt, als an diesem Tage. Er saß an seinem Klaviere und hatte einen seiner Choräle vor sich liegen, woran er etwas verbesserte. Um eins fragte ich ihn: ob er nicht essen wolle? er bejahete es und ließ auftragen. Er aß wenige Bissen von einem Hünerfricassé mit Begierde. Ein Freund hatte köstlichen Steinwein geschickt, dessen Kraft und Milde er rühmte. Er ließ ein zweites Glas bringen und schenkte mir ein. Ich sagte ihm, es sey heute der Geburtstag des Königes. O, ich weiß es! sagte er, Sie sollen mit trinken; noch habe ich keinen vergessen, der mir Gutes erzeigt hat. Wir stießen zusammen und niemals ist wohl ein Andenken mit mehr Dank und Feierlichkeit im Stillen begangen worden, als heut. Der Wein schmeckte ihm und erhob ihn. Er goß mir wieder ein; ich verbat es, weil ich ihm den schönen Wein nicht rauben wollte und nichts gegessen hatte. Für die Freundschaft, sagte er, ist nichts zu gut; Sie haben treu bei mir ausgehalten! die Freundschaft soll leben! – Ewig leben, setzte ich hinzu, und stieß an. Er trank noch die Gesundheit des Freundes, der den Wein geschickt hatte und fühlte sich gestärkt.
Diese Scene war wirklich heilig. In seinem Gesichte war etwas unbeschreiblich Erhabenes und Überirdisches; seine schön gewölbte hohe, heitere Stirn schien Stralen zu werfen, sein weniges graues Haar sich in besondere Locken zu [S. 42] legen und alles an ihm hatte eine neue Gestalt. Ich ward aufs heftigste bewegt, die ganze Mahlzeit hindurch, und meine Thränen brachen unwillkürlich hervor. Woran ich aber heute keinen Gedanken hatte, war der Tod. Ich rieth ihm, zu versuchen, ob er schlafen könne. Ich werde schon schlafen, sagte er, lassen Sie mir nur Zeit! Er klagte mir, daß ihn eine Bandage um den Leib wund gerieben habe und ihm viele Schmerzen verursache. Ich wollte ihm den Ort mit kühlem Wasser waschen und er nahm das Anerbieten an. Mit diesem Geschäft war ich kaum fertig, als ich ihn ganz kalt fühlte. Er konnte sich nicht aufrichten. Ich brachte ihn mit Mühe auf seinen Stuhl; denn das Mädgen hatte ich fortgeschickt. Sein Puls arbeitete stark und ein klebriger, kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Ich saß neben ihm und trocknete ihm den Schweiß. Das hat mir noch keiner gethan! sagte er, und drückte mir aufs heftigste die Hand. Es war nach zwei Uhr. Er hieß mich zum Essen gehen und ihm das Mädgen herauf zu schicken. Ich glaubte er wolle schlafen und ging.
Nach einer Stunde ward ich gerufen, ich fand ihn nicht mehr. In der Stellung, worin ich ihn verlassen, sitzend, war er gestorben.____________________
Ich habe ganz unwillkührlich das Leben meines Freundes hier schließen müssen. Eine Anzahl Nachrichten und Charakterzüge, die seine Person, seinen bildsamen Geist und sein Verhältniß gegen den König betreffen, hätte ich gern in die Geschichte verwebt, allein dieß wollte sich von mir nicht thun lassen und so will ich das Wichtigste von diesen Dingen hier nachtragen.
Fasch war ein Mann von mittler Größe, seinem Knochenbau und wohlgestaltem Körper. In seinem Wesen war nichts Imposantes, das er auch an andern nicht liebte. Seiner schwachen Brust wegen trug er seinen Kopf etwas vorwärts, welches ihm eine verbindliche und zuvorkommende Stellung gab. Die Züge seines Gesichts waren regelmäßig und geistreich, und seine Heiterkeit und [S. 43] Freundlichkeit war einnehmend. Er war gleichsam zum Dienst eines großen Herrn erzogen, schon in seinen ersten Jünglingsjahren am Hofe, mit Hofleuten umgegangen und blieb bis an das Ende seines Lebens im Dienst des Preußischen Hofes. Dadurch hatte er eine Persönlichkeit und Zierlichkeit in seinen Bewegungen, worin man bald einen feinen Mann erkannte. Dieses Äußere, so entfernt es auch von aller vornehmen Anmaßung war, gab wohl Gelegenheit, daß ihn mehrere für einen schlauen Höfling hielten; die Besten unter diesen kamen aber bald von ihrer Meinung zurück, wenn sie ihn näher und länger beobachteten. Er gab ungefragt kein lautes Urtheil, mischte sich in keine Streitigkeit und schmiegte sich an keine Meinung. Er bewies ohne allen Zwang jedem die äußere Achtung, worauf dieser Anspruch machte, und wenn der König den jüngsten von Faschens Schülern zum Kapellmeister gemacht hätte, so würde Fasch der erste gewesen seyn, der sich untergeordnet hätte. Seine Gutmüthigkeit und seine Liebe zu einsamer Thätigkeit waren eigentlich das ganze Fundament seiner übrigen Neigungen. Sein Vertrauen war nicht leicht zu gewinnen, und selbst gewisse Geheimnisse hatte er nur für gewisse Freunde. Er war von Natur heftig und hitzig, wußte sich aber sehr geschickt zu mäßigen. Obschon er in seinem Umgange einen Schein von Ängstlichkeit nicht verbarg; so war er doch ohne alle Menschenfurcht und über diesen Punkt niemals in Verlegenheit. Zu seiner Vertheidigung schritt er langsam und mit einer Art von Gravität, wie ohngefähr ein Fechter seine Stellung nimmt. Wenn ihm der Angriff sehr mißfiel, bediente er sich wohl gar keiner Gegenwehr. Streiten war überhaupt, besonders öffentlich, nicht seine Sache: die Wahrheit, meinte er, streite nicht; in den meisten Kriegen streite nur die Ungewißheit mit der Ungewißheit und selten sey die gemeinschaftliche Überzeugung das Resultat eines Streites. Das meiste Gute bei Streitigkeiten war für ihn die Historie derselben, aber es kam ihm sonderbar vor, der Historie wegen Thaten zu thun. Es war ihm demnach unmöglich zu beleidigen oder anzugreifen; eben so unmöglich war es ihm, gegen seine Erkenntniß und Neigung zu schmeicheln; sein öffentliches Lob war also [S. 44] etwas Seltenes, wozu er sich nicht bestimmen ließ, und deswegen ward er zwar geachtet und geliebt, aber niemals öffentlich vorgezogen.
Das Letztere gehörte indessen auch nicht zu seinen Wünschen. Er wollte, was den Dienst betraf, für nichts weiter als einen Diener seines Herrn gelten und ließ sich auch nicht gebrauchen, als wozu er bestellt war. Was er außerdem werth war, berechnete er sich selbst und schlug es hoch an. Was ich im Dienst brauche, sagte er, mußte ich besitzen, ehe ich gebraucht wurde, sonst würden sie mir bald den Laufpaß unterschrieben haben; was ich aber für die Kunst thue, das wird entweder vergessen oder unaufhörlich kritisirt, und deshalb war er so unverdrossen in der Verbesserung seiner wohlgerathenen Werke, an welchen er bis an seinen Tod feilte. Er mochte gern Meinungen über seine Arbeit hören, besonders gründlichen Tadel. Da er immer mit großem Ernst und am liebsten Kirchenmusik schrieb, so that es ihm sehr wehe, wenn er die Satyre erregt hatte. In dem Miserere mei hatte er einen Chor auf die Worte componirt: Ut justificeris in sermonibus tuis. Ich sagte ihm, daß die Bewegung und der Rhythmus dieses Chors eine komische Ähnlichkeit hätte, mit dem Wetzen eines Barbiermessers. Darüber ward er so empfindlich, daß er mir sagte: ich möchte es versuchen, diesen Chor besser zu machen! Ich sagte: das würde ich bleiben lassen! Nun so werde ichs selber thun, sagte er, indem auf einmahl alle seine Empfindlichkeit in rührende Gutmüthigkeit überging, die etwas Erhabenes hatte. Den folgenden Tag hatte er zu diesen Worten eine neue sehr schöne Musik gemacht und die vorige zerschnitten. Sehen Sie, was Sie mir für Arbeit gemacht haben, sagte er; nun muß ich alle Stimmen aufs neue ausschreiben und dies that er auch sogleich.
Den Witz konnte er sehr wohl leiden; auch war er selbst auf eine gutmüthige Art witzig; aber er hütete sich sehr, ihn recht spielen zu lassen, weil er oft mit dem Herzen durchgeht. Wenn der Witz nicht beißt, sagte er, kitzelt er nicht und manchmal kann er nützlich seyn; aber er ist wie ein Schelm von Bedienten, der seinen Herrn bestiehlt.
[S. 45] Unter seine Eigenheiten gehörte, daß er den Eingangs-Billetten zur Singakademie, die er eigenhändig machte, eine solche Gestalt und Farbe zu geben suchte, daß sie nicht nachzumachen wären und dieß kostete ihm viel Zeit, denn er bemalte sie mit Farben und siegelte sie auf eigene Art mit Goldplättchen, wodurch sie ein wunderliches Ansehn bekamen. Ich fand ihn oft mit dieser Arbeit beschäftigt, rieth ihm auch, solche andern Händen zu überlassen; er ließ sich aber darin nicht stören, obgleich das Verbrennen des vielen Siegellacks seiner Gesundheit sehr nachtheilig war. Einst sagte ich ihm, daß eine Dame gefragt hätte: was das Ohr auf den Zetteln bedeute? (das goldene Siegel und einige bunte Striche darum hatten eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Ohre) und von der Zeit an bemalte er die Zettel nicht mehr. Seine Behutsamkeit im Betragen gegen Dienstgenossen war liebenswürdig und man könnte sagen, geschmackvoll. Der König hatte ihm im Jahr 1774, als er selbst die Oper nur noch selten besuchte, mit der Opern-Direction scharfe Instruktionen gegeben, die ihm sehr beschwerlich waren. Fasch besorgte sie sehr genau und mit sinniger Schonung, ohne jemals merken zu lassen, daß er dem Könige näher sei als dessen andere Diener. Er besaß eine Reihe von Briefen Friedrichs des Großen, worunter Eigenhändige waren, durch welche er sich sehr gewaltig hätte zeigen können, was er aber niemals that. Diese Briefe sind verbrannt und ich würde sie niemals gesehen haben, wenn es nicht bei dieser Gelegenheit ihrer Vernichtung gewesen wäre.
Was Fasch am Könige am meisten liebte, war dessen eigenes, selbstständiges Wesen und er glaubte von ihm geachtet zu seyn; aber er drängte sich nie an ihn, noch weniger ließ er sich ausfragen. Wenn der König fragte, wie dieß oder jenes, das er ihm aufgetragen hatte, vollführt sey? gab Fasch sogleich Antwort; fragte er aber weiter, was öfter geschah; so erhielt er allemahl zur Antwort: das haben mir Ihre Majestät nicht aufgetragen!
Der König war einst so ärgerlich in seinem Konzert, daß er Faschen laut befahl, einem alten verdienten Violonzellisten etwas Hartes zu sagen. Fasch ging [S. 46] still an diesen heran, nahm ihn bei der Hand und bat ihn, etwas rascher und stärker zu spielen. Am andern Morgen kam der öffentlich beschämte Mann zu Fasch und fragte: was er wohl zu seiner Genugthuung thun müsse? Behalten Sie mich lieb, war die Antwort, und glauben Sie, daß ich Ihr Alter und Ihr Verdienst zu schätzen weiß; der alte Mann weinte an seiner Brust und ging.
Die Leute des Königs hatten einst vergessen, Faschen zur Musik zu bestellen. Als Fasch am andern Tage in die Vorkammer des Königs kam, waren die Leute in der größten Furcht und baten ihn, sie um Gottes Willen nicht zu verrathen; der König hätte nach ihm gefragt und sie hätten ihn krank gemeldet. Fasch sagte: wenn der König nicht frägt, werde ich nichts sagen, aber ich werde nicht lügen. Fasch ging in das Musikzimmer, begrüßte den König und setzte sich sofort an das Klavier. Den Augenblick ging der König, der schon die Flöte in der Hand hatte, hinaus, schalt seine Leute heftig und sagte: sie hätten ihn belogen, sie hätten Faschen gar nicht bestellt; wenn sie ihren Dienst ferner vergessen würden, werde er sie fortjagen.
Der König war dafür bekannt, daß er die Kirchenmusik nicht liebte, weil er einmal in der Oper gesagt hatte: die Musik schmeckt nach der Kirche! Man wollte ihm ferner die Eigenschaften eines feinen und edeln Herzens nicht zugestehn. Seine Ansprüche auf den besten Geschmack in der Litteratur und in den Künsten; sein Machtregiment hier wie in der übrigen Welt, war vielen unerträglich und verhaßt. Unter diesen war Bach, Faschens Freund, einer der heftigsten, und es fielen wohl zwischen beiden Freunden kleine Streitigkeiten darüber vor. Der König merkte es Bachen auch an, hatte eine persönliche Abneigung gegen ihn und schätzte diesen großen Künstler deswegen nicht nach Verdienst. Fasch, der den König viele Jahre nach einander zu beobachten Gelegenheit gehabt, mit demselben oft Unterredungen über Gegenstände der Kunst geführt und von seiner Gemüthsbeschaffenheit viele Proben hatte, vertheidigte dessen edles Herz mit Muth und Kraft gegen jeden, der es angriff. Wenn er eine Geschichte zum Nachtheil des [S. 47] Königs auslegen hörte, so widerlegte er sie entweder auf der Stelle, oder er setzte einen ihm genau bekannten Charakterzug dagegen, wodurch der König im schönsten Lichte erschien. Er wollte dafür angesehn seyn, daß er den König liebte und sagte: derjenige, der mit jeder übel oder unverstandnen Anekdote gegen einen Mann von bekanntem Charakter, der immer öffentlich handeln muß, argumentire, sey, was sein Urtheil betreffe, wenig zu achten.
Besonders sprach Fasch gern und mit dreistem Lobe von des Königs Flötenspiel. Er hat mehrern Personen gesagt: daß unter allen Virtuosen die er gehört, sein Freund Bach, Franz Benda und der König, das rührendste Adagio vorgetragen hätten.
Der König, der sich selber mehrere Solo für die Flöte setzte, hatte sich einst im Adagio ein Stück Rezitativ angebracht, das er mit großer Hingebung spielte. Fasch wurde davon ergriffen und accompagnirte ihm mit besonderer Liebe, wodurch der König sehr zufrieden wurde. Quanz hatte vorher ein ganzes Rezitativ in irgend einem Stücke componirt. Als der König das Stück geendigt hatte, fragte er Faschen: was er davon halte, ein Rezitativ auf einem Instrumente zu spielen? Fasch antwortete: das Rezitativ sei eigentlich ohne Worte nicht zu statuiren; wenn es sich aber, wie hier, an einen rhythmischen Gedanken fügte, der eine schon bekannte Bedeutung hätte, so könne es von guter Wirkung seyn. Ihre Majestät hätten den Ausdruck des Flehens, besonders durch Ihren Vortrag hier so getroffen, daß man eine bittende Person vor sich glaubte. – Recht! sagte der König: Quanzens Rezitativ klingt nicht viel besser, als wenn die Tonleiter auf der Mühle gemahlen würde; ich habe mir die Stelle dabei gedacht: wie Coriolan’s Mutter auf den Knieen ihren Sohn um Schonung und Frieden für die Stadt Rom bittet.
Außer Quanzen nahm sich nicht leicht einer von den Musikern die Freiheit, dem Könige Bravo! zu sagen. Der König sagte einst sehr aufgeräumt zu Faschen, daß er ihm auch wohl einmal sagen könnte, wenn er es gut gemacht [S. 48] hätte, welches auch Fasch von nun an that, doch niemals wenn Quanz zugegen war.
Der König hatte sich einst in einem Solo von seiner eignen Arbeit eine glückliche, kanonische Stelle angebracht, woran Fasch sogleich die Eigenschaft erkannte, solche dreistimmig zu machen. Dieser accompagnirte die Stelle auf dem Fortepiano so, daß der König dadurch aufmerksam wurde und nachher fragte: kennt Er solche Arbeit? Es ist ein dreistimmiger Kanon, sagte Fasch, der Ihrer Majestät wohl gelungen ist. Nun, sagte der König, so versteht Ers doch besser als ich, denn ich habe nur an zwei Stimmen gedacht. Darauf erzählte der König Faschen: wie er bei Graun wirklich musikalische Schularbeiten gemacht habe; ich habe nur wissen wollen, fuhr er fort, wie es gemacht wird. Viele Musikanten wissen nichts davon und die es recht verstehn, thun so gelehrt damit, als wenn unser einem das überhohe Dinge wären. Es freut mich immer, wenn ich finde, daß sich der Verstand mit der Musik zu schaffen macht; wenn eine schöne Musik gelehrt klingt, das ist mir so angenehm, als wenn ich bei Tische klug reden höre.
In einem Adagio, das der König blies, kam eine Stelle zweimahl vor, die mit der großen Sexte beziffert war, an deren Stelle Fasch auf dem Klaviere ein anderes Interval griff. Als die Stelle das zweitemahl vorkam, rief der König kurz vorher: die große Sexte! – Wie Ewr Majestät befehlen! sagte Fasch, und schlug die Sexte derb an. Als das Stück aus war, fragte der König: glaubt Er, daß die Sexte falsch ist? – Ja, Ihre Majestät! Wenns aber der Komponist nun haben will? – So bleibt sie doch falsch! Monsieur Quanz aber sagt, daß die Sexte hier stehn könnte! – Herr Quanz kann Recht haben; ich halte mich an die Sexte und diese ist falsch! – Nu, nu! sagte der König, es ist doch keine verlorne Schlacht.
Fasch sprach einst mit dem größten Lobe von Grauns Passionsmusik: der Tod Jesu. Ja, sagte der König, das ist seine beste Oper! Wenn er gelebt [S. 49] hätte, würde er es immer besser gemacht haben; sein Te Deum hat mir damals in meiner Lage sehr gut gefallen, obgleich es mitunter auch sehr lustig darinne hergeht; denn selbst die Freude muß in der Kirche einen Ernst behalten, der dem geheimnisvollsten Wesen zukommt.
Man beschuldigte den König einer großen Einseitigkeit des Geschmacks in der Musik, weil er keine andere Musik hörte als von Quanz, Graun und Hasse. Einst sagte er zu Faschen, als die Rede von Opern war: Graun hätte einen tüchtigen Mann neben sich haben müssen, der ihn gespornt hätte; allein, wo soll alles Geld herkommen, solche Leute zu bezahlen die es werth sind. Ich gebe Geld genug für die Musik aus, und wo sind denn die Bessern? Hasse war Einer! die andern kennt kein Mensch, und in Italien sind sie froh, wenn sie nur bravissimo! rufen können.
Im Umgange mit seinen Freunden, und besonders in seinem Hause, war Fasch munter und sehr gesprächig. Wenn er etwas recht ungereimt fand, konnte er so stark lachen, daß seine Brust krachte und man besorgt um ihn wurde. Er hatte eine natürliche Anlage zur Satyre, die man aber nicht bemerkte, weil er sie mit redlichem Fleiß unterdrückte. Seine Sarkasmen betrafen immer ihn selbst und er spottete dann mit vieler Leichtfertigkeit über seine kleine Eigenheiten und Neigungen, welche er mit Lust befriedigte. Unter diese gehörte vornehmlich die Neigung zu jeder Art von Genuß. Er wußte sich seine Tagesordnung so einzurichten, daß jeder Augenblick einen Genuß für ihn hatte. Sein kleines Mittagsmahl, das höchstens aus drei Schüsseln bestand, ließ er sich auf seine Art, mit Überbleibseln voriger Mahlzeiten, Früchten und mehrerlei Weinen, angenehm ausschmücken; dann saß er wie der Maler vor seinen Farben, indem er nach Willkühr dies oder jenes wählte. Kleine Geschenke von Wein und Früchten nahm er gern an und bezahlte dafür dem Uberbringer [sic!] reichliches Trinkgeld; der Sender aber konnte darauf rechnen, daß seiner im Augenblicke des Genusses dankbar gedacht wurde.
[S. 50] Tabak rauchte er gern und trank dazu den ganzen Vor- und Nachmittag Kaffee und Chokolade und des Abends Bier. Hatte er eine Pfeiffe ausgeraucht, so nahm er gern eine Prise Schnupftabak, den er außerdem selten gebrauchte. Diese kleinen Genüsse beschränkte er aber ganz auf sein einsames Leben, ohne solche jemals mit seinen Geschäften oder mit seinem Umgange zu vermischen. So wie ein Fremder nur seine Thür berührte, legte er die Pfeiffe weg und nahm sie nicht eher wieder, bis er allein war. Er fertigte nicht einmahl einen Bedienten ab, ohne die Pfeiffe wegzulegen. Derjenige, in dessen Gegenwart er in seiner Stube Tabak rauchte, hatte schon sein Vertrauen und mußte auch ein Raucher seyn; niemals aber habe ich ihn bewegen können, während des Unterrichts, den er mir für Bezahlung gab, seine Pfeiffe wieder zu nehmen. In allem was sein kleines Hauswesen betraf, beachtete er eine bestimmte Ordnung. Was er zu seiner Einrichtung bestimmt brauchte, wurde im Ganzen gekauft, und es fehlte ihm niemals an Vorrath. Das Eigenste war die Einrichtung seiner Geldkasse. Er behauptete, kein guter Wirth zu seyn, und deswegen theilte er sein Geld so ein, daß er darüber niemals weiter zu denken brauchte. Er ließ sich viele kleine Beutel von ganz unterscheidenden Farben machen: weiß, schwarz, gelb, roth, grün u. s. w. So bald sein vierteljähriges Gehalt ankam, wurde in diese Beutel abgesetzt: zu Miethe, Aufwartung, Essen, Kleidung und Wäsche, Kaffee, Zucker, Holz, Licht und Wein. Aus diesen Beuteln bezahlte er nun die genannten Erfordernisse sogleich wie er sie erhielt. Wenn das Vierteljahr um war, leerte er sie von dem Erübrigten und füllte sie mit dem neu angekommenen Gelde. Von dem was er aber erübrigt hatte, erhielt erst seine Krankenkasse neuen Zuschuß, dann die Weinkasse und das übrige kam in eine Armenkasse mit der er Nothleidende unterstützte. Er war aber auch außerdem wohlthätig. Einem jungen thätigen Manne, der sich an ihn wandte, schoß er eine so bedeutende Summe unentgeldlich vor, daß dieser davon auf sein Handwerk Bürger und Meister werden, sich verheirathen, ein Haus kaufen und sich in einen vollkommen nahrhaften Zustand setzen konnte. Er hatte [S. 51] dies gewagt und freuete sich kindlich, wenn er nachher diesen Mann schalten sah. Oft wurde er aber auch hintergangen und kam um sein Geld, welches er denn so ansah, als ob er es nicht gehabt hätte. Einem Handwerksmanne hatte Fasch, acht Jahre vor seinem Tode funfzehn [sic!] Thaler gegen einen Schuldschein geliehen, die jener ihm verzinsen sollte; der Schuldner ließ sich aber nicht wieder sehn und bezahlte weder Kapital noch Zinsen, obgleich er es jetzt im Stande war. Fasch ließ einige Tage vor seinem Tode den Mann um das Geld mahnen, welcher auch kam und zahlte; Fasch sahe ihn aber nicht an und schenkte dieß Geld auf der Stelle dem Manne, der seine Papiere verbrannt hatte.
Er war ein großer Freund aller hitzigen Getränke und Speisen. Die fetten spanischen Weine und Ungarwein trank er am liebsten, weil sie ihn fähig zur Arbeit machten. Die Rheinweine wußte er genau zu unterscheiden, sagte es aber nicht, um keinen der etwas auf seinen Wein hält, durch Kritik zu beunruhigen. Das einzige Merkzeichen seines Urtheils war, daß er immer stiller wurde, je besser der Wein war; er schien dabei zu meditiren. Wenn er Aufträge im Dienst hatte und Mangel an Kräften spürte, konnte er ein ganzes Weinglas schweizerisches Kirschwasser austrinken und dann wie ein gesunder Mann arbeiten. ► Im Jahr 1792 ward ihm die Zusammensetzung der Oper Vasco di Gama übertragen, wo jeder Sänger seine Arien einlegte. Ich erfuhr dieß erst nach zwölf oder mehrern Tagen, ging zu ihm und bot mich an, ihm an dieser Arbeit, die gewiß keinen Reitz für ihn hatte, zu helfen. Er war schon damit fertig, hatte aber für einige zwanzig Thaler ungarischen Wein und Mallaga dabei ausgetrunken. Wenn diese Oper, sagte er, nicht nach Wein riecht, so habe ich mein Geld weggeworfen. So war er auch im Essen. Er hatte eine ziemliche Anzahl Leibgerichte, die ihm jeder gern vorsetzte. Wenn ein solches Gericht auf den Tisch kam, war es ein Vergnügen sein Gesicht anzusehn, das wie ein Farbenklavier spielte. Eine bloße Bouillon nannte er einen schlechten Kontrapunkt; seine gewöhnliche Brühsuppe mußte einen dicken Grund von vielen Küchengewächsen, Kräutern und [S. 52] Kartoffeln haben, dann war es ein doppelter Kontrapunkt. In solcher Suppe aß er sich oft so satt, daß er nichts mehr essen konnte, und dann sagte er: ich habe wenig und nichts als Suppe gegessen. Alle italienische Gerichte, besonders wenn sie recht feurig und würzhaft waren, Kohl und Rüben, recht fett gekocht und brennend gewürzt, waren ihm eben recht. Dann schlief er eine halbe Stunde, rauchte ein wenig und arbeitete darauf spät in die Nacht hinein. Des Morgens stand er im Sommer um fünf Uhr auf, frisirte und rasirte sich, um in wenigen Minuten angekleidet erscheinen zu können. Seine Art zu arbeiten bestimmte sich mehrentheils aus der Natur der Arbeiten. Auf seinem Klavier stand ein Schreibpult worauf er alles schrieb. War sein Zustand erträglich, so arbeitete er lebhaft und schnell; in Krankheiten fleißig und gelehrt. Immer waren seine Arbeiten doch gedacht und rein organisirt. Eine gute Komposition mußte ihm wie ein wohlgebauter Körper seyn, an dem nicht blos die Haut glatt ist. Er verglich ein gutes Musikstück gern mit einem Drama, worin keine Person auftreten darf, ohne etwas zu thun das man gern bemerkt. So wie die Adern in einem Körper ihren bestimmten Anfang und ihr Ende haben; so mußten, nach seiner Meinung, die Mittelstimmen eintreten, sich bewegen und ihre Funktionen einstellen. Dies verlangte er besonders von der Instrumentalmusik, die man seit einiger Zeit die reine Musik nennt. Wenn diese letztere, deren abstrakten Sinn er gar wohl kannte, das Höchste in der Kunst, ja, die höchste Kunst seyn sollte; so müßte sie auch, meinte er, auf das Vollkommenste gemacht seyn.
Unter den Eigenschaften eines Künstlers war ihm das Bestreben zu gefallen, die verdächtigste und widernatürlichste. Das Gefällige, sagte er, muß aus den Werken kommen, allein die Gefälligkeit muß keinen Einfluß haben auf die Werke, sonst kommt etwas anders heraus als verlangt wird, und der Zweck der Kunst wird übersehn. Das Zufällige in den Gedanken muß nothwendig seyn und das Nothwendige zufällig scheinen: das ist das Genie! und wo dies ist, da will niemand gefallen oder sich gefallen lassen, sondern das rechte Wort findet die rechte [S. 53] Stelle. Ein Genie, das sich unter Bedingungen einläßt, bleibt wenigstens nicht was es ist und daher kömmt es, daß ein Geist, der sich einst in der Verklärung zeigte, in manchem Werke wie ein Gespenst erscheint und freilich oft auch so, nur etwas anders wirkt. Das wahre Genie will auch nicht gepriesen seyn: es wirkt am besten unerwartet und unbestochen und flattert jauchzend von hinnen, so bald es seiner Wirkung gewiß ist; diese schöne Täuschung ist die schönste Wahrheit und dauert am längsten aus, weil sie jeder selbst erwerben muß.
In dem vielstimmigen Satze hatte er zuletzt eine solche Gewandheit und Sicherheit erreicht, daß er ihm wenig mehr Mühe machte als der vierstimmige Satz. Er zeigte mir einst eine vielstimmige Cadenz, wo er nach vielem Hin- und hersinnen die sechszehnte Stimme nicht hatte finden können. Ich bekam das Papier kaum vor die Augen, als mir wie von ungefähr ein möglicher Gang einfiel, den er nicht hatte. Schreiben Sie ihn hin, sagte er. Als ich des andern Tages zu ihm kam, hatte er zu diesen sechszehn Stimmen noch acht Stimmen gesetzt, und als ich darüber meine Verwunderung blicken ließ, zerschnitt er die ganze Arbeit vor meinen Augen und sagte: man kanns machen, aber es ist nicht die Mühe werth. Die Kunst ist keine Sache worüber man sich wundern soll; durch sie soll man vielmehr die Natur recht natürlich finden!
Ich brachte ihm einst eine Composition die gedruckt werden sollte, worin er mir einen verlängerten Rhythmus wegstrich. Ich war still darüber und ersetzte das Weggestrichene vor dem Abdrucke. Als ich ihm das gedruckte Exemplar brachte, wollte ich mich bei ihm über diese Sache entschuldigen. Nein! sagte er, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen; ich bin vollkommen Ihrer Meinung, ohne deswegen die meinige zurück zu nehmen. Ich habe Ihnen gesagt was recht ist und Sie haben gethan was gut ist, es freut mich daß Sie Ihrer Sache so gewiß sind.
Ein Gelehrter kam zu Fasch und bat um einen Begriff von der Theorie der Fuge und ihrer künstlichen Einrichtung, den Fasch ihm mittheilte so gut ihm [S. 54] die Worte zu Gebot waren. In einer Schrift dieses Mannes fand er hernach ziemlich genau, was er ihm gesagt hatte. Sind wir Musiker nicht rechte einfältige Leute? sagte er; ich habe beinahe funfzig [sic!] Jahre gelernt, eine Fuge zu machen, die mir recht wäre, und der Mann hats in zehn Minuten gefaßt und in eben der Zeit auch wieder von sich gegeben.
Von seinem Leben wollte er niemals etwas ausführliches erzählen. Einzelne Begebenheiten, die einen Zusammenhang mit andern Dingen hatten, ließ er sich wohl entfallen, aber wo dieser Zusammenhang aufhörte, brach er ab. Ich glaube, es war Herr Gerber aus Sondershausen, der ihn einst um eine schriftliche Mittheilung seines Lebens bat. Damit, sagte Fasch, kann ich dienen, ohne eine Feder anzusetzen, es steht Gellerts ► Fabel, der Greis: er lebte, nahm ein Weib und starb! Streichen Sie die beiden letzten Dinge weg, so haben Sie meine ganze Geschichte. Ich hatte schon einige Jahre vor seinem Tode angefangen, sein Leben aufzuzeichnen und Materialien zu sammeln, aber er merkte es und war in der Folge behutsamer, sich etwas verlauten zu lassen. Das beste Mittel ihn zur Sprache zu bringen war, wenn er eine Sache falsch erzählen hörte; dann berichtigte er sie, so wie er sie wußte. Er wollte mir nicht einmahl seinen Geburtstag sagen. ► Herr Gerber hatte in seinem Lexicon eine unrichtige Jahrzahl angegeben und auf diese Art erfuhr ich zuerst, wann er gebohren war und zugleich die Geschichte seiner Jugend.
Ich ging einst mit ihm bei Potsdam über den Begräbnißplatz, wo wir viele Monumente betrachteten und Anmerkungen dazu machten. Fasch war sehr ernsthaft. Ich sagte, daß es kaum der Mühe werth sey, ein Wort über diese Monumente zu verlieren, die Arbeiten seyen schlecht und paßten höchstens zu den geringen Verdiensten der meisten, die hier erst durch ihr Ende ein Zeichen ihres Daseyns hätten. Ach! sagte er, so vergänglich und schlecht diese Sachen immer seyn mögen, so haben sie doch einen unschätzbaren Werth in der Verehrung derjenigen, die sich das Andenken an geliebte Personen, wenigstens ihr eignes Leben [S. 55] hindurch zu verlängern suchen; ein geliebtes Weib, ein Kind, ein Geschwister, das sind Namen, bei denen mir das Herz aufgeht; allein, wo ist, der mein gedenkt, wenn ich hier bin? Ich bringe mein Leben hin mit Aufopferung ohne Werth und Dank; ich bin abgeblüht ohne Frucht, und wie mein Daseyn ohne Freude ist, so wird auch mein Andenken seyn: - ich bin des Lebens nicht werth! Es kann eine Folge dieser Betrachtungen seyn, daß er nachher in seinem letzten Willen eine Summe von vierhundert Thalern aussetzte, wovon ihm nach seinem Tode ein kleines Denkmal, blos mit seinem Namen, aufgestellt werden sollte. Von diesem Gelde ist sein Brustbild in weißem Marmor angefertigt. Mein Freund Schadow ist dabei so uneigennützig gewesen, daß von diesem Gelde außerdem noch ein kleines Denkmal auf dem Begräbnißplatze angebracht werden kann.
Nichts konnte ihn weniger erschrecken als der Tod, so sehr er auch die Freude liebte, nur das Sterben war ihm verhaßt. Ich wäre, sagte er einst, ein guter Soldat worden. Im Kriege, wo so recht Tod und Leben wie schwarz und weiß bei einander steht, wäre mir besser gewesen, als auf dieser Marterbank, indem er auf seinen Krankenstuhl zeigte. Als er einst zum Tode krank war, las ich ihm ein komisches Gedicht vor. Es war: der ► Maulthierzaum von Wieland. Er hörte mit stillem Vergnügen, sagte aber zuletzt: hören Sie nur auf! es ist ein Elend, wenn man nicht einmal lachen kann; ich denke, so Gott will, soll es bald aus seyn mit mir.
Oft waren seine Nächte entsetzlich leidenvoll. Ein krampfhafter Stickhusten plagte ihn wenn er lag, und so war er fast jede Nacht dem Tode nahe. In seinem Bette hing eine Schelle, um sich des Nachts Hülfe zu schaffen, die oft nothwendig war. Einst schellte in der Nacht das Mädchen heraus, die halb im Schlaf sogleich erschien und ihn starr und sprachlos fand. Das Mädgen nahm in der Bestürzung ein Glas Wasser, das vor dem Bette stand und goß es dem halb todten Manne ins Bette. Darüber sprang er auf, lachte entsetzlich und das Mädgen entfloh vor Schreck. Nach diesem Vorfalle war er ein ganzes Jahr so leidlich, daß er sich für gesund hielt.
[S. 56] In einem Hause dicht an seiner Wohnung, kam in der Nacht Feuer aus. Ich eilte zu ihm, sah das brennende Haus und wollte ihm helfen seine Sachen retten. Ich fand ihn fertig angekleidet und ohne große Besorgniß. So lange, sagte er, das Feuer nicht an meine Treppe reicht, geh ich nicht aus meiner Stube. Seine Messe, sein Geld und die nothwendigsten Sachen hatte er sich zurecht gelegt, um solche leicht mit sich zu nehmen. Die andern Leute des Hauses warfen Sachen aus ihren Fenstern und wollten ihm das nehmliche thun, er verhinderte es aber und sagte: auf diesem Wege habe ich meine Sachen nicht bekommen.
Bei seinem Hange zur Wohlthätigkeit und zum Geben, fehlte es ihm niemals an Bettlern, die seine Güte mißbrauchten, worüber er sich selbst aushöhnte: diese Leute, sagte er, sind nicht Schuld; sie brauchen mich, wozu ich brauchbar bin. Wäre ich für mein Geld besser als sie, so sind sie klüger als ich, auch für mein Geld, und wir leben doch alle. Im Jahre 1783 wohnte er in einem Hause, worinn unter seiner Stube ein Branntweinladen war. Fast alle Sonnabende belästigten ihn eine Menge Bettler, denen er viel zu reichlich gab. Eines Tages kamen ihrer so viele kurz hinter einander, daß Fasch nicht anders glaubte, als diese Leute hätten sich unter einander verabredet. Als das Laufen nicht aufhörte und wieder einer anklopfte, riß Fasch die Thür auf und fragte den Kerl hitzig: wer ihn hergeschickt hätte? Ach! nehmen Sie es doch nicht übel, sagte der Bettler erschrocken, da unten im Laden haben sie mich herauf geschickt. Fasch gab ihm und sagte: er solle sich nicht unterstehn wieder zu kommen! und riegelte die Thür zu. Den Augenblick darauf sah er aus dem Fenster den Kerl unten in den Laden gehn, dem, so wie er nur die Thür aufmachte, ein brüllendes Gelächter entgegen schallte. Es war die ganze Bettelgesellschaft hier beisammen, der Fasch das Geld zu einem lustigen Frühstück in pleno, heute und wer weiß wie oft schon gereicht hatte.
Er war niemals verheurathet und wünschte auch nicht es zu seyn. Seine [S. 57] Neigung zum andern Geschlecht reichte ohngefähr so weit als seine körperliche Natur; er ehrte die Schönheit und weidete sein Auge daran. In seinen jüngern Jahren war sein Herz beständig mit kleinen Neigungen gegen irgend ein Frauenzimmer besetzt; er offenbarte sie aber nicht und suchte blos zu gefallen. Einer Italienerin zu Liebe, die bei der Opera Buffa angestellt war, lernte er die italienische Sprache so vollkommen.
So nothwendig ihm ein Bedienter gewesen wäre, so hielt er sich, wie ers nannte, aus Bequemlichkeit keinen. Ich hätte, sagte er, noch einmahl so viel zu thun, um einen solchen Menschen nur zu beschäftigen; es ist die größte Plage, Leute um sich zu haben, denen man alles befehlen muß. Um einen Hund der ihm starb, war er sehr lange traurig und wollte keinen wieder haben. Besondere Mühe gab er sich, den Hund seines Hauswirths nach seiner Art zu erziehn, welches ihm auch dergestalt gerieth, daß man einen verzogenen Menschen zu sehn glaubte. Er lehrte ihn Wein trinken, Äpfel essen, Braten von Fleisch zu unterscheiden und dergleichen. Dieß geschah aber nicht von ihm aus langer Weile oder Zeitvertreib; er verband damit einen Ernst der etwas Ehrwürdiges hatte. Wenn man ein organisches Wesen erziehn wolle, sagte er, so müsse man es erst in einem gewissen Grade verderben, um es empfänglich zu machen. Er glaubte, die Hunde und Pferde seien durch den Umgang mit Menschen besser als andere Thiere, ja sie würden noch besser seyn, wenn man sie zu verstehn suchte und nicht statt dessen verlangte, daß sie die Menschen verstehn sollten, die sich oft genug selber nicht unter einander verstehn. Mit diesem Hunde unterhielt er sich oft lange, deutete sich seine Äußerungen, sprach mit ihm und der Hund horchte. Der Grund dieser Beschäftigungen war, daß er gern an allem bildete was in seine Nähe gerieth und Willen zeigte, wobei er sich dann nicht selten vergriff, sich darüber selbst auslachte und auch wohl dem Hunde seinen dummen Streich erzählte.
Übrigens war er kein Freund des Paradoxen, noch weniger wollte er es scheinen. Er trug und betrug sich gegen jedermann natürlich und ohne alle Ver- [S. 58] stellung, vielmehr waren alle diese Eigenheiten eine bloße Frucht seiner contemplativen Einsamkeit, die er sich auf alle Art angenehm machte.
Seine Bedienung bestand fast immer in einem jungen und kindischen Mädgen, die oft seine Unterhaltungen mit dem Hunde anhören mußte, weshalb denn auch der Hund gegen das Mädgen sehr ungezogen war, weil sie ihm wie einem Hund begegnete.
Wenn er allein war und nichts vornehmen konnte, ließ er sich öfter von dem Mädgen die Zeitungen und Seereisen vorlesen, wobei oft wunderliche Lesefehler vorgingen, die er belachte. Als eins dieser Mädgen ihm zum ersten Male vorlesen sollte, wollte es nicht gehen, welches er sehr unrecht fand, nicht einmahl deutlich lesen zu können. Das Mädgen sagte: im Gesangbuche könne sie lesen. Er ließ sie ein Lied lesen, das so ziemlich ging. Den folgenden Tag sollte sie ihm wieder eins lesen, allein es fand sich, daß sie nur das gestrige lesen konnte; er ließ sie dieses noch einmahl wiederholen und lehrte eins dazu.
Seereisen und deren Beschreibung hatten einen großen Reitz für ihn. Wenn ich reich wäre, sagte er, würde ich viel zur See gereiset seyn. Die Seeluft würde mir wohlgethan haben; schon wenn ich ein solches Buch lese, wird mir die Brust leichter.
Über öffentliche und besonders politische Angelegenheiten unterhielt er sich gern; allein er verletzte niemals die äußere Achtung gegen vornehme oder hohe Personen. Wenn ihm allgemeine Unternehmungen nicht gefielen, sagte er immer: ich finde keinen Generalbaß darin.
Seine Bescheidenheit im eigenen Wissen war aufrichtig; er konnte es nicht einmahl leiden wenn man ihn bescheiden nannte. Er hatte einen natürlichen Widerwillen gegen eine gewisse niedrige Demuth, wozu nichts ihn bewegen konnte. Den eiteln Stolz ließ er geradezu stehn wo er ihn fand und zog sich still zurück. Da er sehr pünktlich in seinen Vorsätzen und Pflichten war und auf nichts genauer hielt, als sich von allen Ansprüchen, die an ihn könnten gemacht werden, rein [S. 59] zu erhalten; so ertrug er auch hierin nicht die geringste Verletzung. Kam ihm jemand auf diese Art zu nahe, so suchte er ihn erst durch Gründe zu überzeugen, und dann bekümmerte er sich niemals wieder um ihn. So freigebig er war, so kann ich mich außer seines ganz freiwilligen Vermächtnisses, keines Geschenks von ihm rühmen. Seine Aufmerksamkeit gegen seine andere Bekannte, stach manchmahl sonderbar ab, gegen die eigne Strenge die er mir bewieß. Obgleich ich ihn selten um etwas bat, so war es ihm leicht, mir etwas geringes abzuschlagen, das er nachher andern ohne alle Umstände gewährte. Wir hatten oft kleine Streitigkeiten über solche Dinge, aus denen aber immer sehr gedachte Ursachen seiner Handlungsweise hervorgingen. Er behauptete: das Gefühl eines jeden Menschen werde in seiner besten Zeit ausgebildet, entweder durch Noth und Leiden oder durch die Liebe. Darnach handle im Grunde ein jeder, wie er sich auch stelle. Daher komme es, daß die besten Menschen so oft die nehmlichen Fehler machten und meistentheils in ihrem Leben nicht davon frei würden. Das Gute und Schlimme wächst, sagte er, auf einem Boden; wenn ich meine Fehler nicht hätte, wo sollte meine Tugend herkommen? Der Unterschied liege aber meistens darin, daß ein jeder verlange: man solle nach seiner Art gut seyn.
Faschens Verhältniß mit Kirnbergern war gänzlich verschieden von dem der andern Musiker in Berlin. Kirnberger ward von vielen gehaßt die ihn fürchteten. Fasch fürchtete ihn nicht ohne ihn deswegen zu lieben, und Kirnberger war immer sein Freund. Fasch zeigte ihm in theoretischen Streitigkeiten dreist, wo und wie er Unrecht hatte, und wer Lehre annahm war Kirnberger. Dieser beschäftigte seine hohe Schülerin, die Prinzessin Amalie, gern mit der Auflösung von Kanons, welche von ihren Verfertigern in eine Art von Räthsel gehüllt sind. Er selbst schrieb viele Kanons und bewog auch den Hamburger Bach und Fasch zu solchen Arbeiten. Einst kam von auswärts eine ansehnliche Sammlung solcher Kanons ein, über deren Auflösung sich der Meister und seine Schülerin den Kopf zerbrachen, einige aber davon waren ihnen unauflöslich. Kirnberger schickte einen [S. 60] oder zwei dieser Kanons zu Fasch, gestand ihm seine vergebliche Mühe und bat um seinen Beistand. Fasch wollte eben in den Wagen steigen um nach Potsdam zum Könige zu fahren; er steckte den Kanon in die Tasche und lösete ihn auf der Reise im Wagen auf. Von Potsdam aus schickte er Kirnbergern sogleich den Kanon zurück und schrieb ihm dabei, was er darüber gefunden hätte, und daß die ganze Schwierigkeit der Auflösung, besonders für einen Meister, darauf beruhe, daß der Kanon nicht rein im Satz sey, an welchen Umstand Kirnberger vielleicht nicht gedacht hatte. Als Fasch von Potsdam zurück war, besuchte ihn Kirnberger sogleich und sagte: Sie haben es mich recht gelinde fühlen lassen, daß ich nichts verstehe; ich möchte mich ohrfeigen, und wenn einer von meinen Schülern so dumm gewesen wäre, hätte ich ihm einen Eselskopf auf sein Papier gemalt. Fasch ermahnte Kirnbergern bei dieser Gelegenheit, sein Talent besser als auf solche Dinge zu verwenden und dieß hatte die Folge, daß Kirnberger seine Fugen herausgab.
Übrigens schätzte Fasch Kirnbergern sehr, wegen seines großen Verdienstes um die Kunst des Satzes, des musikalischen Grundbasses und der Temperatur. Einige Wochen vor seinem Tode sagte mir Fasch, nicht ohne Bitterkeit: es sey doch wunderlich, daß man nicht einmahl wisse, wo der Verfasser der Kunst des reinen Satzes geblieben wäre; man müßte doch wenigstens auf Verlangen die Knochen noch vorzeigen können. Wenn ich lebe, setzte er hinzu, und dazu kommen kann, will ich ihm für sein eigenes Geld eine Tafel setzen lassen: Hier ruht Johann Philipp Kirnberger. Denn er hat mir sein Buch geschenkt, zu einer Zeit, da ich es wirklich nicht bezahlen konnte.
____________________[S. 61] Ich hätte das Leben meines Freundes durch einen beträchtlichen Vorrath von Geschichten, Bemerkungen und Anekdoten noch sehr weit ausspinnen können. Es sey mir genug, wenn ich es als ein Freund dargestellt habe, dem die Wahrheit und die Liebe die Feder geführt hat.
Das einsame Leben eines außerordentlichen Künstlers kann nicht jedem Beschauer gleich wichtig seyn, aber es ist ein desto schönerer Spiegel für die wenigen Auserwählten, welche in ewigem Kampfe mit Hindernissen und Gebrechen, blos durch Eifer und Genie auf eine Höhe der Kunst gelangen, wo sie der Welt ein Licht werden können.
Seine Grundsätze über die höhere Kunst habe ich so gut wiedergegeben, als ich sie theils aus seinem Leben, theils aus seiner Art zu arbeiten und besonders aus seinen vielfältigen mündlichen Gesprächen aufgefaßt habe, und man wird sie überall auf seine Werke anwenden können, die ich nicht zu loben brauche.
Ich läugne nicht, daß mir die nahe Bekanntschaft mit diesem merkwürdigen Manne und das Vermögen, meine Mitwelt mit seinem Wesen und Charakter bekannt zu machen, aufs höchste schmeichele. Aber die väterliche Liebe und vertraute Freundschaft dieses edeln Mannes überwiegt jede Empfindung von Eitelkeit in mir so sehr, daß ich gern sagen mag: er habe mich würdig genug gehalten, die Früchte seines Fleißes und seiner Achtung für die Welt auszubreiten und sein Andenken damit zu erhalten.
Wäre die Singakademie nicht mehr gewesen, so hätte er, nach seinen letzten Äußerungen gegen mich, alle seine Werke zerstört und blos die einzige sechszehnstimmige Messe hinterlassen. Auch hat er mich zu nichts verpflichtet, als zur Herausgabe der sechszehnstimmigen Messe. Indessen sind seine Werke einmahl da. Ich werde erst diese Messe, welche schon in der Arbeit ist, herausgeben, und in der Folge nach und nach alle seine übrigen Werke. Zerstören will und kann [S. 62] ] ich sie nicht, und da sie also in der Welt bleiben müssen, so ist es gleichviel, ob sie jetzt oder künftig ins Publikum kommen; aber es ist nicht gleichviel, ob sie durch meine oder durch fremde Hände gehen. Die Welt wird sie richten und an ihren Ort stellen.________________________________________
[1] Hr. Kapellmeister Hiller in Leipzig hat das Leben dieses thätigen Mannes im ersten Theil seiner Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten, Leipzig bei Dyck, ausführlich beschrieben, doch ohne seine Quelle anzugeben.
[2] Unter C. P. E. Bachs Charakterstücken ist ein: La Coorl, überschrieben, welches sich auf diesen Umstand bezieht.
[3] Dieser Kanon ist auf eine Choralmelodie gemacht und aus fünf Kanons zusammengesetzt, von denen einer siebenstimmig, einer sechsstimmig und drey vierstimmig sind. Jeder dieser Kanons besteht für sich aus einem besondern Gedanken, der in den verschiedenen Stimmen, in allen Umkehrungen; der Augmentation, Diminution, des stretto und ristretto so erscheint, daß das Auge bei jeder Note auf eine verborgene Kunst fällt. Alle diese fünf Kanons aber zusammen, machen einen einzigen fünf und zwanzigstimmigen Satz aus, der bei seiner Fülle dennoch mit Dissonanzen versehen ist. Es kommt auf jeden Kenner selbst an, wie viel Werth er auf solche Arbeiten legen will, und Fasch wußte wohl, daß man damit weder Leidenschaften erregt, noch beruhigt. Eigentlich wollte er Kirnbergern damit zeigen, daß nichts so künstlich sey, welches nicht noch weiter könne getrieben werden. Die Natur ist, was sie ist; auch die Kunst hat ihre Natur, und es wird nicht leicht einen guten Contrapunctisten geben, der nichts in Kanons gethan hätte, weil sich diese Arbeit unter den Übungen in Contrapuncten von selbst darbietet. Kirnberger trieb diese Kunst als Tonlehrer gleichsam ex officio und brachte seiner Schülerin der Prinzessin Amalia einen entschiedenen Geschmack an dieser Arbeit bei. Diese Dame ließ in allen Provinzen von Italien und Deutschland gelehrte Musikwerke und besonders Kanons aufsuchen und bezahlte sie oft mit Golde. Fasch glaubte, daß Musiker und besonders Kunstrichter mit diesen Künsteleien bekannt seyn müßten, schon deswegen, weil die größten Männer der Vorzeit ihre Werke damit geziert hätten, die man ohne diese Kenntiß nicht gehörig schätzen könne.
[4] Salimbeni hatte auch seinen Abschied schon vor dem Kriege genommen und war nach Dresden gegangen, welches den König sehr verdroß.
[5] Daß Graun wenigsten öfter so gearbeitet habe, hat mir auch der verstorbene Marpurg gesagt, der es von Graun selbst gehört haben wollte.
[6] Wenn ich nicht irre, war dies Bachs Meinung, der sich schon in frühern Zeiten gegen diese vielstimmige Arbeit erklärt und gesagt hatte: man könne mit vier und fünf Stimmen so viel Gutes hervorbringen, daß man jenes Satzes vollkommen entbehren könne. Bachs Heilig mit zwei Chören trift auch mit dieser Meinung überein.
[7] Mademoiselle Charlotte Dieterich, Stieftochter des verstorbenen Geheimen Rahts Milow in dessen Hause sie wohnte.
[8] Die Wittwe des verstorbenen Generalchirurgus Voitus, eine geborne Pappritz.
[9] Vorsteher: Der königl. Geheimrat Zencker, Der Prediger Messow, Der Professor Hartung; Vorsteherinnen: Frau Generalchir. Voitus, Demoiselle Dieterich, Frau Justizräthin Seebald.[10] Als im Jahr 1797 der verstorbene Kapellmeister Schulz aus Kopenhagen, eine von ihm componirte Motette hörte, wunderte er sich nicht so sehr über die reine und sichere Ausführung als über die stille und gänzlich unbemerkbare Direction, die ihm bis dahin unmöglich geschienen hatte und gestand es laut.
Kommentar
Kommentar
S. 8 Die Erziehung seines Sohnes – Es ist auffallend, dass Zelter die Mutter Faschs mit keinem Wort erwähnt. Johanna Helena Simers wurde in Groß-Khmelen (Niederlausitz) geboren (Datum nicht ermittelt). Johann Friedrich Fasch heiratete sie am 22. Juli 1728 in zweiter Ehe. Karl Friedrich Christian blieb ihr einziger überlebender Sohn, ein Bruder verstarb im Säuglingsalter. Sie starb bereits 1743, als Karl Friedrich Christian 7 Jahre alt war. Wenn Fasch sie Zelter gegenüber unerwähnt ließ, muss dies tiefgreifende Gründe gehabt haben, über die man nur spekulieren kann. Zelter, der sich seiner eigenen Mutter in seiner Autobiographie mit Wärme erinnert, hatte keine erzähldramaturgische Veranlassung, sie zu übergehen.S. 8 stillen geistlichen Übungen – Zelter spielt auf die tief pietistisch geprägte Haltung Johann Friedrich Faschs an, die offenbar starken Einfluss auf die geschilderten Erziehungspraktiken hatte. Fasch Senior verkehrte in den Dresdner Kreisen von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, wo er auch seine Frau kennenlernte. Man kann die Schilderung der eingezogenen Lebensart des jungen Fasch als kritische Sicht der pietistischen Innerlichkeitskultur lesen.
S. 8 Konzertmeister Höckh – Carl Höckh (1707–1773 Ebersdorf / Steiermark) erlernte das Violinspiel bei seinem Vater. Nach Wanderjahren als Regimentsoboist ausgedehnte Konzertreisen mit Franz Benda, der ihn 1734 an den Zerbster Hof empfahl, wo er das Amt des Hofkapellmeisters bekleidete. Als Pädagoge hatte er überregionale Bedeutung. Zu seinen Schülern zählen neben Fasch auch Wilhelm Rust und Johann Wilhelm Hertel. Komponist von u.a. 17 Violinkonzerten und 27 Violinsonaten.
S. 9 freie Luft und körperliche Bewegung – Zelters antithetische Darstellung der Erziehung mag, auch wenn er den mündlichen Mitteilungen Faschs treu folgt, durchaus von dem mächtigen Einfluss Rousseaus geprägt sein, wenn er hier die befreiende Wirkung der Natur und der Gesellschaft mit gleichaltrigen preist und damit die zuvor geschilderte körperliche Schwäche Faschs als psychosomatische Reaktion auf die pietistisch geprägte Zurückgezogenheit erscheinen lässt.
S. 10 Concertmeister Hertel – Johann Christian Hertel (1698–1754), Violinist, Gambist und Komponist: Seit 1733 Konzertmeister der Eisenacher Hofkapelle, 1743 Wechsel nach Neustrelitz. 1751, also kurz nach Faschs Weggang ins Kloster Berge, übernahm Hertels Sohn Johann Wilhelm de facto die Leitung der Hofkapelle, die 1752 im Zuge des Strelitzer Thronfolgestreites aufgelöst wurde. Hertel komponierte überwiegend dem Stil der Berliner Schule verpflichtete Instrumentalmusik.
S. 11 Linike – Johann Georg Linike (um 1680–1762), Violinist und Komponist, hatte bereits zahlreiche Lebensstationen hinter sich, bevor er 1728 als Kapelldirektor am Hofe von Mecklenburg-Strelitz angestellt wurde. Er spielte in der königlichen Kapelle in Berlin, in Köthen, Merseburg und der Hamburger Oper. Als Fasch 1750 in Neustrelitz eintraf, hatte er seine Posten bereits seit acht Jahren an Johann Christian Hertel verloren und war auf den Posten des Hofcembalisten abgeschoben worden.
S. 11 Kloster Bergen bei Magdeburg – Das Kloster St. Johannes der Täufer auf dem Berge in Buckau bei Magdeburg war im 18. Jahrhundert ein bedeutendes Pädagogium. Besonders unter Abt Johann Adam Steinmetz, der ihm von 1732 bis 1762 vorstand, galt es als Zentrum pietistischer Pädagogik. So dürften Johann Friedrich Faschs pietistische Neigungen und seine gesteigerte Fürsorglichkeit für seinen einzigen Sohn die Wahl dieser eng mit den Franckeschen Stiftungen liierten, prestigeträchtigen Schule bestimmt haben, die u.a. Christoph Martin Wieland und Friedrich von Matthison zu ihren Schülern zählte.
S. 12 daß der junge Mensch in Thränen schwamm – Dieses Zeugnis schwärmerischer Gefühlsreligion "avant la lettre" deutet auf eine bemerkenswerte Beziehung zu jenem Text, der die ästhetischen Grundlagen romantischer Kunstreligiosität legte, Wilhelm Heinrich Wackenroders Erzählung "Joseph Berglinger" aus den "Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders". Berglinger, der Protagonist, reist als Knabe in die "Residenzstadt" und gerät beim Hören der geistlichen Werke in eine schwärmerische Verzückung, die seinen Entschluss befördert, Komponist zu werden. Wackenroder war 1794 bis 1796 Faschs Kompositionsschüler und hat Motive und Handlungsstränge der Lebensgeschichte seines Lehrers in seine Berglinger-Novelle eingeflochten. Nicht unwahrscheinlich, dass er auch Wackenroder von seinem Dresden-Aufenthalt berichtet hat. Zelter war dann sowohl der 1796 in Berlin erschienene Text als auch seine Wirkung in der frühromantischen Bewegung bekannt.
S. 12 Hasse, der [...] zur katholischen Religion übergetreten – Johann Adolph Hasse war in Wahrheit nicht aus Liebe, sondern aus Karrieregründen zum Katholizismus übergetreten. 1722 in Italien angekommen, war er bereits im August 1724 in Neapel konvertiert. Sein spätere Gattin Faustina Bordoni traf er erstmals bei der Einstudierung seiner Oper "Dalis" in Venedig im Mai 1730.
S. 13 Romani – Antonio Romani (Geburtsdatum unbekannt), bedeutender italienischer Tenor, kam 1744 an die Hofoper. Er sang dort die bedeutendsten Partien der Opern Grauns und Hasses. Starb 1762 in Berlin.
S. 13 Astroa – Giovanna Astrua, um 1720 bei Vercelli geborene Sängerin. Nach ihrem Aufstieg am Teatro San Carlo in Neapel wurde sie 1746 nach Berlin verpflichtet, wo sie zur gefeierten und höchstdotierten Primadonna avancierte, bis sie sich 1756 aufgrund ihrer Tuberkulose-Erkrankung zurückziehen musste, an der sie im darauffolgenden Jahr starb.
S. 15 Besoldungsscheine – Während des Krieges wurden an sämtliche Zivilbeamte statt eines baren Gehaltes "Kassen-" oder "Besoldungsscheine" ausgegeben, die allerdings im Zahlungsverkehr nicht angenommen wurden und beim Wechsler zu den besagten vier Fünfteln Verlust eingelöst werden konnten.
S. 17 Patience – Faschs Vorliebe für das Patiencespiel ist bemerkenswert, da sie nach Zelter noch vor der ersten schriftlichen Erwähnung dieses Spiels einsetzte, die sich in der Anthologie "Das neue Königliche l’Hombre" findet (Hamburg 1783). Man geht davon aus, dass das Spiel im 18. Jahrhundert in Deutschland erfunden wurde.
S. 18 schrieb er noch sehr unvollkommen deutsch – Noch bis weit nach 1815 wurden die schriftlichen Arbeiten in Pädagogien wie Kloster Berge in lateinischer Sprache abgefasst.
S. 19 spanische Gedicht des Yriarte – Tomás de Iriarte y Oropesa (1750–1791), Dichter der spanischen Aufklärung. Sein aus fünf Gesängen bestehendes didaktisches Poem "La musica" (1779) dokumentiert seine musikalischen Interessen. So spielte Iriarte nicht nur Violine, er komponierte auch Sinfonien und Lieder. Die Dichtung fand auch außerhalb Spaniens weite Verbreitung. So überreichte Iriartes Bruder, Gesandter am Wiener Hof, das Werk Metastasio und Haydn, die es priesen. Haydn hielt das Werk bis in seine letzten Jahre in Ehren. Iriarte sucht in seiner in asymmetrischen Versen gehaltenen Dichtung einen quasi-wissenschaftlichen Überblick über die Musik zu leisten.
S. 20 forderte Bach seinen Abschied, den er auch erhielt, weil er in Hamburg seine Einkünfte verbessern konnte – Carl Philipp Emanuel Bach bezog am preußischen Hof ein Jahresgehalt von 300 Reichstalern, erhielt aber ab Dezember 1755 eine Zulage von 500 Reichstalern. In Hamburg betrug sein Grundgehalt 1200 Reichstaler, durch zahlreiche Akzidentien, etwa Gelegenheitsmusiken für Trauungen und Beerdigungen, erhöhte es sich noch einmal beträchtlich.
S. 23 seinem Hofpoeten – Hofpoeten waren Leopoldo di Villati (1701–1752), der von seiner Berufung bis zu seinem Tode 1752 vierzehn Graunsche Textbücher bearbeitete, und ihm unmittelbar nachfolgend Gian Pietro Tagliazucchi (gest. 1768), der auch den französisch geschriebenen "Montezuma"Friedrichs II. 1755 in italienische Verse brachte.
S. 25 1783 kam der Königl. Kapellmeister Reichardt aus Italien zurück – Reichardts erste Italienreise fand im Sommer 1783, nach dem Tod seiner ersten Gattin am 9. Mai statt. Leider sind wir über diese für die Wende im Leben Faschs überaus folgenreiche Unternehmung nur lückenhaft informiert. Gesichert sind die Stationen Rom, Venedig und Mailand. Die Sammlung von Spartierungen umfasste u.a. 9 Messen und 7 Motetten, wobei die Werke Palestrinas im Mittelpunkt von Reichardts Aufmerksamkeit standen.
S. 28 die Eulersche Erfindung des Tons J oder 1/7 – Von dem Mathematiker Leonhard Euler und Johann Philipp Kirnberger wurde ein Ton "i" ("J" ist vermutlich ein Druckfehler) eingeführt, der den exakten siebten Oberton bezeichnen soll. Bekanntlich ist dieser im Verhältnis zum Grundton der erste unreine Oberton, da er keine rechnerisch genaue Septime ergibt, sondern tiefer liegt. Aus dieser Textpassage geht nicht hervor, ob Fasch auf eigenem Weg auf die Idee gekommen ist, diesen Ton zu benennen, oder ob dies nach dem Studium der genannten Theoretiker erfolgte. Tatsächlich erprobte er, nach einem Bericht von Chladni, mit dem Chor eine Tonfolge i – h. Es sei aber nicht hörbar gewesen, ob nicht tatsächlich der Halbtonschritt b – h gesungen worden wäre. Im Rahmen der von Zelter beschriebenen neuen Befassung mit der Theorie der Tonkunst dürfte dieser Aspekt noch den bizarren Spekulationen des "alten Lebens" zugehören.
S. 29 Einen der Sale im Akademie-Gebäude – Es handelt sich hierbei um das alte Akademiegebäude Unter den Linden 38, an dessen Stelle sich heute die Staatsbibliothek (Haus 1) befindet. Das Gebäude wurde ab 1687 als Neuer Marstall für 200 Pferde errichtet und bereits 1691 aufgestockt. Ab 1695 nahm das Gebäude zusätzlich die Akademie der bildenden Künste und seit 1700 die Sozietät (später Akademie) der mechanischen Wissenschaften auf. Vielfach umgebaut, wurde es erst 1903 abgerissen. Die Sing-Akademie erhielt die Erlaubnis, ihre Zusammenkünfte im sogenannten "Runden Saal" abzuhalten, der die prominenteste Stelle im Lindenflügel einnahm. Er befand sich im ersten Stock, direkt über dem zentralen Portal.
S. 31 Tod der Wittwe – In Gegensatz zu den Trauermotetten auf Friedrich Wilhelm II. und Prinz Friedrich Ludwig Karl von Preußen (beide in der Staatsbibliothek zu Berlin) hat sich eine Trauermusik auf den "Tod der Wittwe" (i.e. Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern, Königin von Preußen) nicht erhalten.
S. 34 Am Grabe fand sich eine seiner ehemaligen Schülerinnen – Diese kryptische Bemerkung Zelters dürfte nur dem engsten Kreis der Sing-Akademiker verständlich gewesen sein. Zelters zweite Gattin, Juliane Pappritz, war Faschs Gesangsschülerin gewesen. Aus ihren Verlobungsbriefen kann man entnehmen, dass Fasch regen, regelrecht kupplerischen Anteil an dieser Verbindung genommen hatte und als väterlicher Freund fast wie ein Familienmitglied betrauert wurde.
S. 35 eisernen Fond – altertümlicher Begriff für ein festgelegtes Stiftungskapital, dessen Zinserträge zumeist wohltätigen Zwecken dienten.
S. 35 Görcke – Faschs behandelnder Arzt zählte zu den herausragenden Medizinern Preußens. Johann Georg Görcke (1750–1828), Chef des Medizinalwesens des königlich-preußischen Heeres, hatte 1795 die sogenannte Pepinière gegründet, eine chirurgische Fortbildungsstätte für Militärärzte. Fasch gehörte also, entgegen dem von Zelter gelegentlich überpointierten Eindruck einer prekären Existenz, in dieser Hinsicht zu einer privilegierten Elite.
S. 37 Organisten Stöckel – Nicht ermittelt.
S. 40 und Klopstock – Es handelt sich um Carl Heinrich Grauns geistliches Lied "Auferstehn ja auferstehn wirst du" GraunWV C:X:3.
S. 40 Porstischen Gesangbuche – Johann Porst (1668–1728), Theologe, Berliner Hofprediger und Pastor der Nikolaikirche, brachte sein berühmtes Gesangbuch erstmals 1708 heraus; es erfuhr zahlreiche Bearbeitungen. Es ist durchdrungen von pietistischer Frömmigkeit und war besonders in Preußen noch bis ins 19. Jahrhundert stark verbreitet. Die Exaktheit, mit der Zelter die von Fasch gewünschten Lieder und deren Strophen benennt, mag deren besondere Bedeutung für den Sterbenden belegen. Fasch verlangt nach Joachim Paulis Lied "So hab ich nun vollendet den schweren Lebenslauf" (Porst 880). Pauli (1636–1708), nicht zu verwechseln mit dem Berliner Drucker gleichen Namens, stand in enger Verbindung zu Paul Gerhard und war Mitglied der "Fruchtbringenden Gesellschaft". Das zweite Lied "So komm, geliebte Todes-Stund" (Porst 882) stammt von Johann Bretten. Beide Texte überhöhen Ergebung und sehnliche Todes-Erwartung in durchaus pietistischer Gefühlsfrömmigkeit.
S. 40 berühmte Graf aus Dresden – Anton Graff (1736–1813) war der bedeutendste Portraitist seiner Epoche. Seine Bildnisse Friedrichs II., Schillers oder Lessings sind in ihrer weiten Verbreitung geradezu ikonisch geworden. Zelters Datierung ("Zwölf Wochen vor seinem Tode") ist in der Forschung nicht unumstritten. Indes hatte er keine Veranlassung, eine falsche Datierung nahezulegen. Das Gemälde befindet sich als Leihgabe der Sing-Akademie zu Berlin im Musikinstrumenten-Museum Berlin.
S. 40 Madame Henry – Susanne Henry (1763–1819) war die Tochter des Kupferstechers Daniel Chodowiecki. Das um 1790 datierte Gemälde befindet sich als Leihgabe der Sing-Akademie zu Berlin im Märkischen Museum Berlin.
S. 40 trefliche Zeichnung von meinem Freunde dem Bildhauer Schadow – Zelter berichtete Goethe brieflich über die Entstehung der Tuschezeichnung Johann Gottfried Schadows, die später von Eberhard Siegfried Henne gestochen und erheblich ergänzt auf das Frontispiz der Biographie gelangte (vgl. dazu die Einleitung).
S. 51 Um Jahr 1792 ward ihm die Zusammensetzung der Oper Vasco di Gama – Die genannte Opera seria "Vasco da Gama" wurde von Felice Alessandri komponiert und 1792 in Berlin uraufgeführt. Das Libretto stammt von Antonio Filistri de’ Carmondani. Mit Zelters Hinweis, bei dieser Arbeit habe jeder Sänger seine Arien einzulegen, ist auf den Pasticcio-Charakter des Werkes angespielt. Alessandri, der seit 1789 stellvertretender Direktor der Hofoper war, hatte mit dem Werk jedenfalls einen Misserfolg zu verbuchen. Er verließ Berlin im Sommer 1792.
S. 54 Fabel, der Greis – Gellerts erstmals 1769 erschienene Fabel endet im Original "Hört, Zeiten, hörts! Er ward gebohren, Er lebte, nahm ein Weib, und starb." Fasch überhöht mit seiner sarkastischen Bemerkung den ironischen Ton des Gedichtes noch.
S. 54 Herr Gerber hatte in seinem Lexicon – In der ersten Auflage seines "Historisch-Biographischen Lexicons der Tonkünstler" hatte Gerber zu Fasch "geb. in Zerbst um 1734" angegeben (Leipzig 1790, Bd. 1, Sp. 399). In seinem "Neuen historisch-biographischen Lexikon der Tonkünstler" korrigierte Gerber den Fehler (Leipzig 1812, Bd. 2, Sp. 79).
S. 55 Maulthierzaum von Wieland – Eigentlich kein "komisches Gedicht", sondern eine zweiteilige Verserzählung, unter dem Titel "Das Sommermärchen" 1777 erstmals publiziert. Bemerkenswert ist der zugrundeliegende, humoristisch behandelte Artusstoff, ein im späteren 18. Jahrhundert seltenes Sujet und vermutlich Zelters erster Kontakt mit einer literarischen Quelle dieses Stoffes.