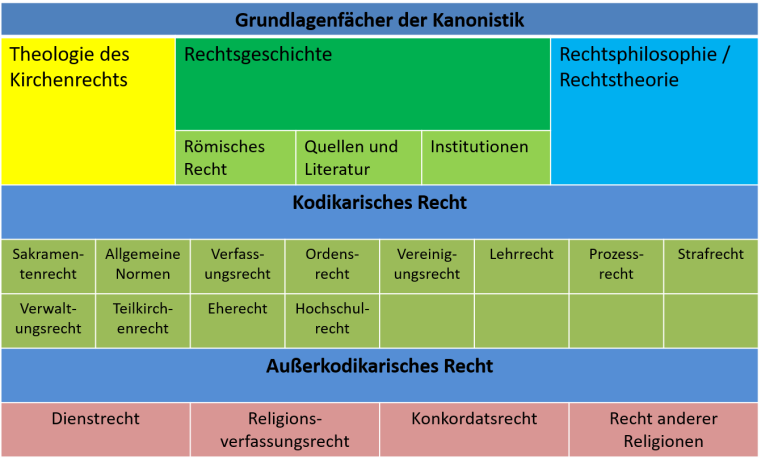Forschung
Was ist Kirchenrecht / Kanonisches Recht?

© IKR Melchior Cano (1509-1560) führt zur Notwendigkeit des Kanonischen Rechts aus:
„Denn es gibt einige Gelehrte in dieser Disziplin [Theologie], die so abgeneigt sind, dass sie die Autorität jener [der Kanonisten] für völlig entfernt vom Gebrauch der Theologie halten. Wir werden jedoch zeigen, wie viel die Autorität solcher Gelehrter für einen Theologen zu beachten ist, indem wir davon ausgehen, dass Theologen, die die kanonischen Bestimmungen der Päpste ignorieren, sehr viel fehlt, was für den Gebrauch der Theologie notwendig ist.“ [De Locis Theologicis 8. 6]
Quellen des Rechts
Das Kirchenrecht der katholischen Kirche – bzw. am lateinischen Wortlaut orientiert eher als Kanonisches Recht bezeichnet – ist das gesamte formale (epistemologische) und materiale (empirische) Rechtssystem der katholischen Kirche.Die empirischen Quellen des Rechts (fontes essendi) setzten sich aus dem geschriebenen Recht (ius scriptum) und dem ungeschriebenen Recht (ius non scriptum) zusammen. Zum ius scriptum zählen die Gesetze und den Gesetzen gleichgestellten Bestimmungen, die vom universalen Gesetzgeber (dem Papst/Bischofskollegium) oder partikularen Gesetzgebern (Bischofskonferenzen, Plenarsynoden, Provinzsynoden oder Diözesanbischöfen und ihnen Gleichgestellten) gemäß c. 8 CIC erlassen werden. Das ungeschriebene Recht (ius non scriptum) ist die Gewohnheit (cc. 23-28 CIC), die Gerichts- und Verwaltungspraxis, die Rechtsdoktrin sowie das göttliche Recht (ius divinum positivum).
Die beiden wesentlichen epistemologischen Quellen (fontes cognosciendi), in denen das Recht zusammengefasst ist, sind die beiden Kodikfikationen für die lateinische/römisch-katholische Kirche der Codex Iuris Canonici von 1983 und für die unierten Ostkirchen der Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium aus dem Jahr 1990. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Apostolische Konstitutionen, Motu Proprii und weitere Einzelgesetze, die vor und nach den Kodifikationen erlassen wurden.
Wesen des Rechts
„Das Kanonische Recht ist eine archaische Ordnung, die von der wesenhaften Einheit zwischen geistlichem und weltlichem Recht geprägt ist.“ [J. Neumann, Grundriss des katholischen Kirchenrechts, Darmstadt 1982, 3]. Das Kanonische Recht ist sowohl rechtlich als auch theologisch zu betrachten, da es seinem Wesen nach beide Dimensionen in sich vereint. In Analogie zu Lumen gentium 8 zeichnet das Kanonische Recht sein inkarnatorischer Charakter aus, d. h. es ist in dieser Welt manifestiert, den Prinzipien des allgemeinen Rechts folgend, und dennoch weist es über sich als reine Rechtsordnung hinaus. Auf den Punkt gebracht: Die kirchlichen Rechtsordnungen verweisen immer auf die Heilsordnung, ohne mit ihnen je identisch zu sein.
Folglich stammen die Prinzipien und lehrmäßigen Vorgaben (ontologische Quellen) nicht aus dem Kanonischen Recht selbst, sondern werden von der systematischen Theologie, hier vor allem der Dogmatik, bereitgestellt und soweit möglich in rechtliche Normen transformiert. Darum gilt: Der Glaube bestimmt das Kirchenbild und das Kirchenbild bestimmt wiederum den Begriff vom Kanonischen Recht. [H. Barion, Rudolph Sohm und die Grundlegung des Kirchenrechts, in: Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart; 81, Tübingen 1931, 26]Was ist Kanonistik?

Saint Omer, Bibliothèque municipale 453, fol. 10r© IKR Der Begriff Kanonistik steht für die Wissenschaft vom Kanonischen Recht. Von daher werden Wissenschaftler:innen, die sich mit dem Kanonischen Recht beschäftigen, auch als Kanonistinnen und Kanonisten bezeichnet.
Die zentrale Aufgabe der Kanonistik ist die wissenschaftliche Auslegung des Kanonischen Rechts. Dies erfolgt den Vorgaben des Gesetzgebers gemäß c. 17 CIC in der Form der grammatisch-logischen Canonexegese.
Hostiensis (* kurz vor 1200 – 1271) führt zu dieser Methode aus:
„Zuerst, indem der Fall [die gesetzliche Regelung] vorgestellt oder der Sinn des Texts berichtet wird. Zweitens, indem der Text gelesen und dargestellt und auch rekonstruiert wird, wenn er schwierig erscheinen sollte. Drittens durch die Einführung von Ähnlichem. Viertens durch die Einführung von Gegensätzlichem und deren Auflösung und durch das Unterscheiden [verschiedener Regelungen]. Fünftens, indem Fragen gestellt und entschieden werden. Sechstens, indem Bemerkenswertes dargestellt wird, für das und wie die besprochene Dekretale angeführt wird.
Dies alles kann jedoch nicht immer der Reihe nach beachtet werden, entweder, weil es in dem Vergessen anheim gefallen ist, oder weil es nicht vollständig beachtet wird.
Es gibt auch Leute, die lesen die Glossen so wie einen Text, was nur Idioten gefällt; oder sie entfernen sich daraus, weil sie den Apparat (Kommentar) korrigieren und sich so nur um Worte kümmern. Dadurch aber wird dem Verständnis des Sinnes und dessen Einprägung weder beim Lehrer noch beim Studierenden geholfen.“ [Summa Aurea, L. V, de magistris c. 6]Hostiensis These besagt, dass die Beachtung des reinen Wortlauts nicht ausreicht, weil sie zwar bei der Gesetzesfindung mit Blick ins Gesetzbuch hilft, aber diese nicht einfach ersetzt. D. h. es müssen für die Auslegung eines Gesetzes ebenso dessen historische Genese, der Kontext der Norm sowie Parallelstellen, der Zweck des Gesetzes und die Denkweise (mens) des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Erst dann kommt es zu einer argumentativ gestützten Rechtsauffassung, die jedoch immer argumentativ widerlegbar bleibt.
Eine Rechtsauslegung mit Gesetzeskraft kann allein der Papst oder in seinem Namen das Dikasterium für Gesetzestexte als authentische Interpretation (c. 16 CIC) verfügen.
Zur Zukunft des Kanonischen Recht und der Kanonistik:
„Das Recht als eine Kategorie der Wirklichkeit gehört zur Abbildhaftigkeit der Kirche und wird vom Neuen Testament durch den Gebrauch offensichtlicher Rechtsbegriffe bejaht. Ein totaler Verzicht auf rechtliche Strukturen in der Kirche und auf verbindliche, der Gerechtigkeit wie dem Geist des Neuen Testaments entsprechende Normen würde darum im Gegensatz zur Sprache der heiligen Schrift und zu ihrem ursprünglichen Verständnis treten.
Als bekennendes Recht kann und soll die rechtliche Ordnung der Kirche freilich dienendes Recht sein, das über ein rein innerweltliches Rechtsverständnis hinausweist und sich als eschatologisch auf Hoffnung hin ausgerichtete Ordnung versteht, die offen ist für die jeweils neuen Fragen und veränderten Gegebenheiten einer jeden Zeit. Denn nur insofern das kirchliche Recht eschatologisch ausgerichtet ist, ist es lebendiges Recht, d. h. ein Recht, das stets über sich hinausweist und nie sich selber Selbstzweck bleibt. Nur so lange es um der Gerechtigkeit und um der Ordnung willen den immer neu sich wandelnden Gegebenheiten zu entsprechen sucht, steht es als wahres Recht innerkirchlichen Ordnungsdenkens nicht im Gegensatz, sondern im Einklang mit der Sprechweise wie auch mit dem Geist des Neuen Testaments.“ [J. Neumann, Kirchenrecht. Chance und Versuchung, Graz 1972, 21f.]