„Wissenschaft heißt Rätsel lösen“
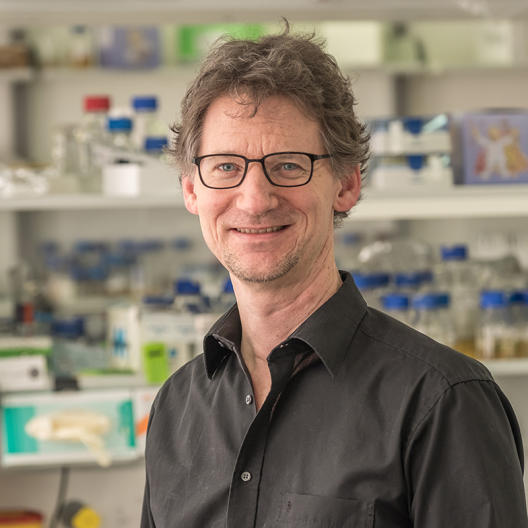
Herr Prof. Wedlich-Söldner, mit welcher wissenschaftlichen Frage beschäftigen Sie sich aktuell?
Ohne Unterlass laufen in der Zelle hochdynamische Prozesse ab, die präzise reguliert und koordiniert werden müssen. Mit meiner Gruppe am Institut für Zelldynamik und Bildgebung untersuche ich, wie die Zelle eine derart straffe Organisation aufrechterhält. Zurzeit liegt dabei der Fokus unserer Arbeit vor allem auf der Organisation der Plasmamembran, also der Hülle, die die Zelle umschließt, und dem Zellskelett, das der Zelle je nach Bedarf Form gibt oder dynamische Veränderungen erlaubt. Um uns zelluläre Prozesse anzusehen, nutzen wir unter anderem einfache Modellsysteme wie die Bäckerhefe oder Bakterien, weil man sie genetisch und molekular leicht manipulieren kann. Eine wichtige aktuelle Frage ist, wie sich Zellen verhalten, wenn sie akute Signale verarbeiten müssen – etwa wenn sich ihre Umgebung plötzlich verändert oder sie Stress ausgesetzt sind. Dann passen sich Zellen oft an, indem sie innerhalb weniger Minuten mit Hilfe des Zellskeletts ihre Plasmamembran umorganisieren. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei Fasern aus dem Protein Aktin. Diese bilden auf der Innenseite der Plasmamembran ein Netzwerk, das die Zelle stützt. Dies und andere fundamentale Prozesse in der Zelle möchten wir gerne im Detail entschlüsseln, nicht zuletzt, weil sie auch bei Entzündungsreaktionen oder bei der zellulären Abwehr bestimmter Krankheitserreger relevant sind.
Was macht Sie als Wissenschaftler persönlich aus?
Ich knoble sehr gerne, und Wissenschaft betreiben heißt im Grunde nichts anderes als Rätsel zu lösen. Außerdem habe ich einen Hang zur Abstraktion: Es macht mir einfach Spaß, Theorien zu entwickeln. Das Problem ist natürlich, dass man diese Ideen dann auch beweisen muss, was nicht immer so ganz einfach gelingt. Wenn es aber klappt, ist das ein purer Erkenntnisgewinn, der vielleicht sogar zu neuen Konzepten führt. Mein persönlicher Antrieb in der Wissenschaft ist die Aussicht, biologische Grundgesetze zu finden, also Wechselwirkungen zwischen Komponenten, zwischen Molekülen oder einzelnen Zellen, die sich dann zu Geweben organisieren.
Was ist Ihr großes Ziel als Wissenschaftler?
Die Organisation von Zellen ist die Grundlage allen Lebens. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, ein paar ihrer Mechanismen zu entschlüsseln. Diese Erkenntnisse erlauben dann auch, das Verhalten von Zellen so zu beeinflussen, dass sie verbesserte oder ganze neue Eigenschaften zeigen. Ein Beispiel: Bestimmte Moleküle in der Plasmamembran sind für die Energiegewinnung in der Zelle verantwortlich. Wir möchten sie an anderer Stelle verankern, um die Ausbeute der Zelle zu erhöhen. Anders gesagt: Dieselbe Menge Zucker würde mehr Energie liefern, was für Biotechnologen sehr interessant wäre.
Was ist Ihr liebstes technisches Forschungsspielzeug und was kann es?
Das ist einfach: die Lichtmikroskopie. Wir haben momentan mehrere Mikroskope, die auf verschiedene Anwendungen spezialisiert sind. Damit können wir auch lebendige Zellen beobachten und Prozesse in Echtzeit verfolgen, wobei es nicht ganz einfach ist, die genau richtigen „Schnappschüsse“ zu erwischen und aussagekräftige Filme zu machen. Die Bearbeitung und Auswertung dieser Aufnahmen nimmt viel Zeit in Anspruch. Zum Glück sind mir die Faszination und der Spaß an dieser Tätigkeit bis heute unverändert erhalten geblieben – oder nehmen mit den Fortschritten in der Mikroskopietechnik eher noch zu.
Erinnern Sie sich an Ihren größten Glücksmoment als Wissenschaftler?
Ich weiß nicht, ob ich von Glücksmomenten sprechen würde. Erfolgreiche Wissenschaft bedeutet für mich eher, dass man sich Schritt für Schritt und meist über lange Zeit einem Ziel nähert, also ein Konzept entwickelt und das letztendlich beweisen kann. Heureka-Momente erlebe ich eher selten, dafür aber eine tiefe Zufriedenheit, weil mich meine Tätigkeit erfüllt und die spannenden Fragen nie ausgehen. Konkrete Erfolge gab und gibt es aber natürlich schon, vor allem, wenn neue und überraschende Beobachtungen zu neuen Ideen und Konzepten führen – und sich diese dann auch noch bestätigen lassen.
Und wie sah Ihr größter Frustmoment aus?
Meist ist der Weg von der Idee zum Nachweis auch gespickt mit Frustmomenten, weil es natürlich nie ganz glatt geht. Es gilt sicher nicht nur in der Wissenschaft, dass man aus solchen Rückschlägen Positives ziehen sollte. So wäre eine unserer größten Publikationen nicht so erfolgreich gewesen, wenn uns eine andere Gruppe mit der Veröffentlichung ähnlicher Ergebnisse nicht zuvorgekommen wäre. Wir waren gezwungen, einen Schritt weiter als bis dahin geplant zu gehen, was unsere Geschichte letztlich noch viel spannender gemacht hat.
Welches wissenschaftliche Phänomen begeistert Sie heute noch regelmäßig?
Das koordinierte Durcheinander in der Zelle wird wohl nie aufhören mich zu begeistern. Man muss sich das vielleicht wie eine Großbaustelle vorstellen: Zunächst wirkt alles chaotisch, weil sich die Ordnung hinter den Abläufen nicht auf den ersten Blick erschließt. Den Durchblick muss man sich hart erarbeiten. Übertragen auf Zellen bedeutet das, dass sie jeweils sehr spezifische Formen und Verhaltensweisen haben, die sich aber dennoch im Millisekundentakt ändern. Unveränderliche Strukturen gibt es kaum. Und trotzdem bleiben die Zellen weitgehend berechenbar.
Wie viel Kunst, Kreativität und Handwerk steckt in Ihrer Wissenschaft?
Das Mikroskopieren würde ich als Handwerk bezeichnen. Wahrscheinlich könnte jeder innerhalb eines Tages lernen, wie man die Geräte nutzt. Doch damit ist es nicht getan, weil die Daten dann noch interpretiert werden müssen, was Jahre dauert. Hier geht das Handwerk in Kunst über. Erfahrung, ein gutes Auge und Intuition sind hier wichtige Voraussetzungen, um Neues zu schaffen – und sich auch als Forscher ein klein wenig wie ein Künstler zu fühlen.

