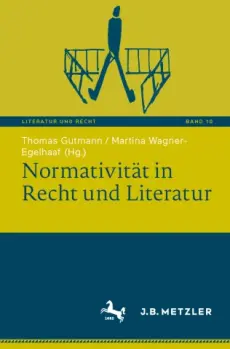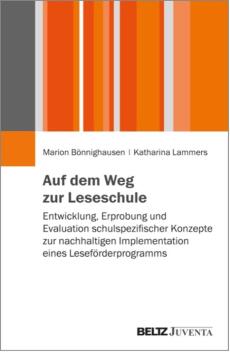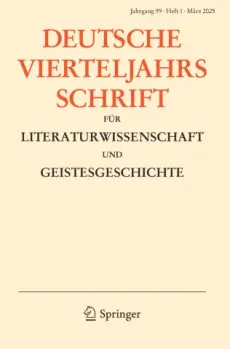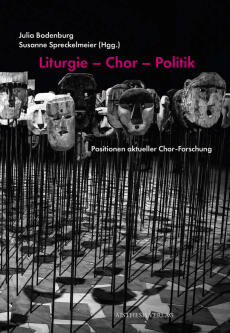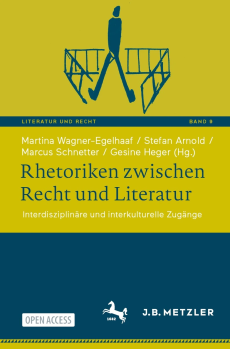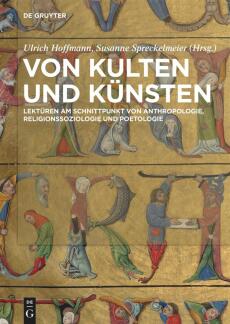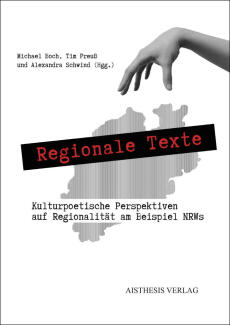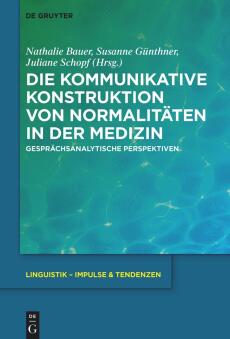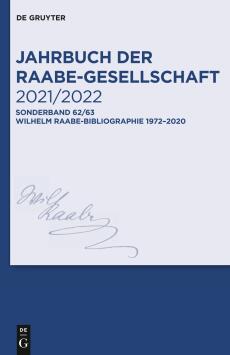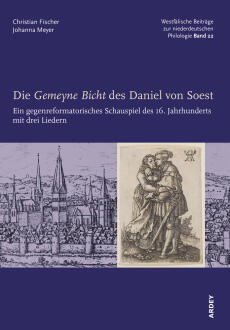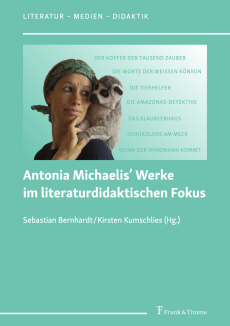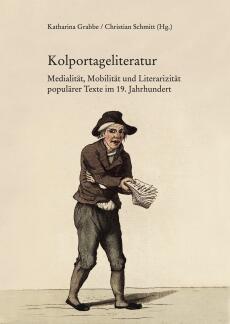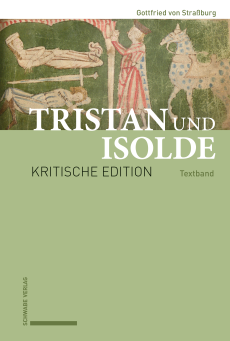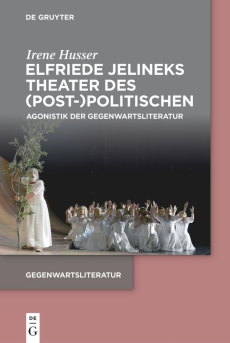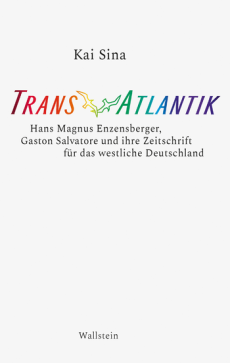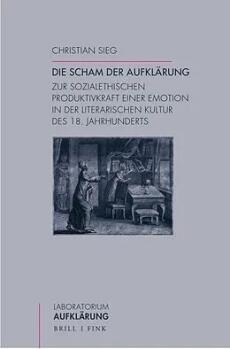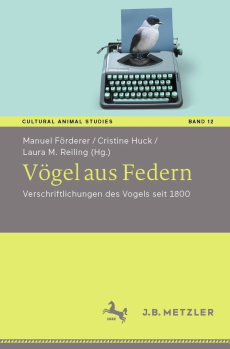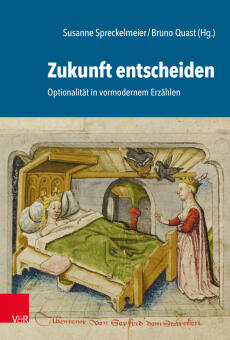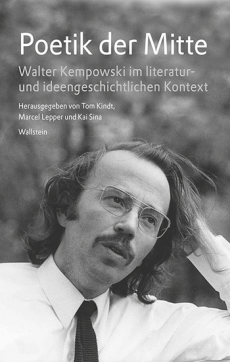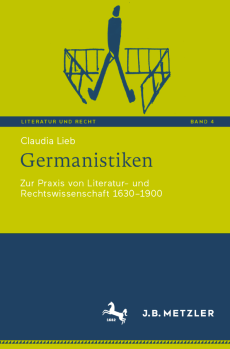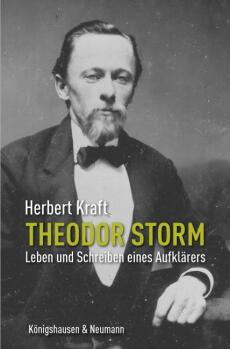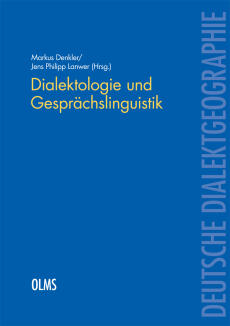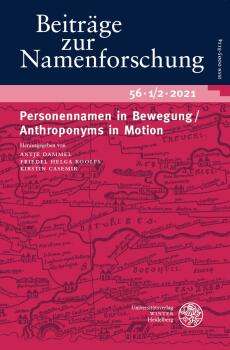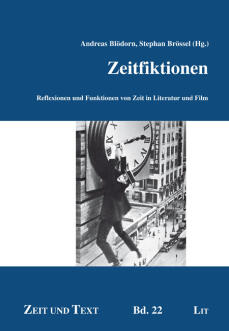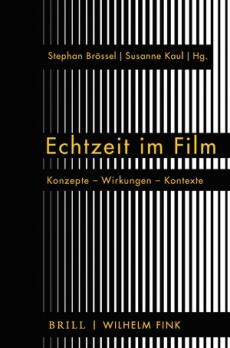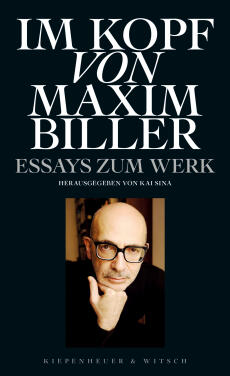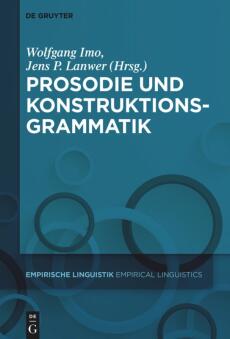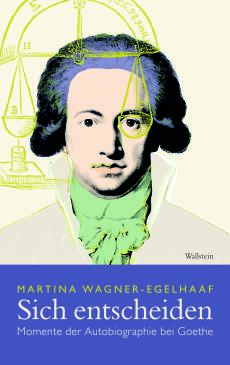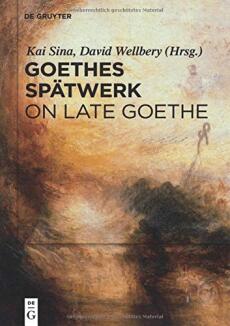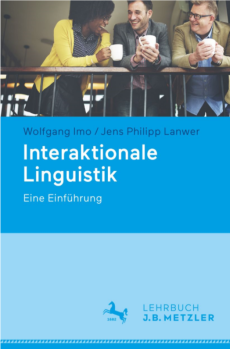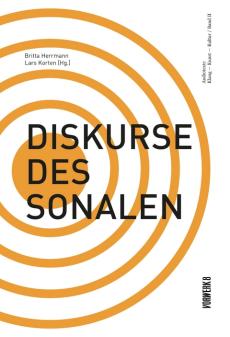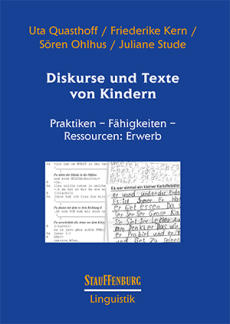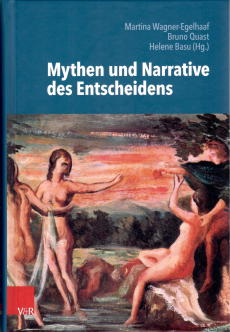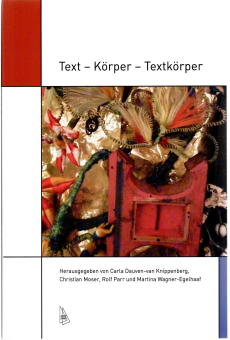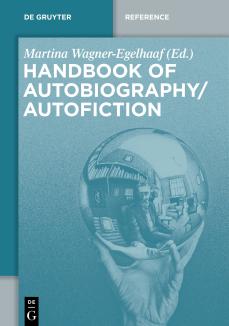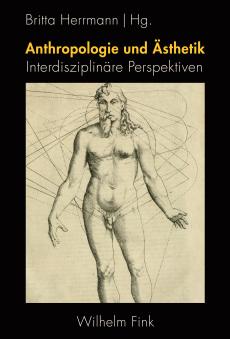Sebastian Bernhardt (Hrsg.): Literaturunterricht in den Sekundarstufen zwischen Themenorientierung und Ästhetik. Berlin: Frank&Timme 2025 (=Literatur–Medien–Didaktik, Band 19).
Literatur beruht auf eigenen Prinzipien und Normen. Sie ist fiktional, hat aber trotzdem immer einen Bezug zur Wirklichkeit. Deshalb verhandeln literarische Texte und fiktionale Medien auch regelmäßig Schlüsselprobleme ihrer Gegenwart. Dabei eröffnen sie Konfliktfelder und ermutigen zur philosophischen Reflexion. Mithilfe ästhetischer Verfremdung laden Literatur und Medien so zu einem differenzierten Blick auf die Welt ein. Entsprechend bietet sich der Einsatz literarischer Medien im Unterricht der Sekundarstufen an, um auf ungewohnten Wegen an Themen heranzuführen. Die Beiträge in diesem Band demonstrieren anschaulich, wie Literatur erfolgreich in der Schule genutzt werden kann. Sie beweisen zudem, dass Literatur und Medien im Schulunterricht verwendet werden können, ohne ihren Zauber zu verlieren oder zu bloßen Impulsgeber:innen zu werden.
Weitere Informationen zur Veröfentlichung finden Sie hier.