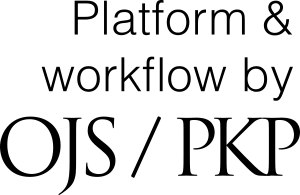Call for Papers 2025 – Ästhetik der Nachhaltigkeit
Vor dem Hintergrund vielfacher und verschränkter sozial-ökologischer Krisen ist die Gestaltung zukunftsfähiger Entwürfe des gesellschaftlichen Zusammenlebens eine zentrale Herausforderung der Gegenwart. Die Aushandlung über das richtige, sozial-ökologisch verträgliche Leben, das auch bisherige Normalität(en) zur Disposition stellt und neu konstituiert, findet dabei in verschiedenen Arenen statt. In der öffentlichen Debatte eher wenig berücksichtigt wird die ästhetische Dimension der sozial-ökologischen Transformation. Dabei spielen das leiblich-körperliche, affektive und auch künstlerische Erfahren bzw. Gestalten gegenwärtiger und potenziell zukünftiger Lebensweisen eine ebenso wichtige Rolle wie die funktionale Aufrichtung ästhetischer Formen. Hierbei tritt auch der mögliche Einfluss reflexiver ästhetischer Praktiken auf das außerkünstlerische Erleben von normierten Formen ins Relief. Auf welche Weise sind diese affektiv besetzt? Das im weiteren Sinne als Ästhetik verstandene Erleben, Affiziert-Sein, aber auch das reflexive Gestalten und Formgeben möchte der vorliegende Call for Papers aufgreifen. Ausgangspunkt ist, dass ästhetische Vorstellungskraft und Erfahrbarkeit eine zentrale Rolle im Rahmen sozial-ökologischer Transformationsbestrebungen spielen. Der Ästhetik sozialer Praxis wird das Potenzial zugeschrieben, transformative Kräfte freizusetzen und auch die Akzeptanz für alternative Zukünfte zu erhöhen. Zugleich können ästhetische Normen sozial-ökologische Transformationsbestrebungen konterkarieren – man denke beispielsweise an die Kritik am Ausbau erneuerbarer Energien, die das ästhetische Landschaftserleben verändern. An solchen und weiteren Orten wird Normalität reflexiv. Auch kann die Ästhetik ökologischer oder ästhetisch-performativer Lebensformen dezidiert zur Distinktion von anderen Lebensformen in Stellung gebracht werden, wenn man beispielsweise an das Feld der Kreativberufe denkt oder nachhaltige Lebensstile in den Blick nimmt. Die Subjektivierung einer ökologischen Urteilskraft kann über Zugehörigkeit und Ausschluss entscheiden. Das Feld der Ästhetisierung von Nachhaltigkeit kann aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive breit aufgefasst werden, sodass die folgenden Themenbereiche und Fragestellungen adressierbar sind:
- Wie lässt sich sozial-ökologische Transformation grundsätzlich ästhetisch begreifen? Welche Formen des Ästhetischen können hier (re)konzeptualisiert werden? Welche Bedeutung haben zeitliche, räumliche und soziale Strukturen? Von welchen Akteuren und auf welche Weisen werden Normalität bzw. die diese Normalität suspendierenden Transformationsansprüche ästhetisch repräsentiert und reproduziert?
- Welche Rolle(n) können Künste und kreative Praktiken mit ästhetischem Handwerk (z. B. Design, Modeschöpfung, Architektur) in der Ästhetisierung von Nachhaltigkeit spielen? Enthalten sie Möglichkeiten der Intervention; falls ja, durch welche Formate? Besitzt die Kunst Ähnlichkeiten zum politischen Aktivismus oder bietet sie ein alternatives Aktionspotenzial? Welche Bedeutung kommt einzelnen Bereichen der Kunst (Bildende Künste, Musik, Literatur, Darstellende Künste) zu? Welche (außer-ästhetischen) Funktionen im Sinne ihrer Auswirkung andere soziale Praxisfelder können Bilder und Narrative der Nachhaltigkeit haben? Welche ästhetischen Herausforderungen bestehen im Bereich der Architektur bzw. materiellen Gestaltung sozial-ökologischer Transformation?
- Wie lassen sich materielle Bedingungen der sozial-ökologischen Transformation ästhetisch verstehen? Eröffnen sich hier Potenziale für die Erkenntnis- und Wandlungsfähigkeiten von Materialität hinsichtlich ihrer konstitutiven Bedeutung, den Verflechtungen mit der menschlichen Lebenswelt (Neuer Materialismus), ihrer Erneuerbarkeit und Lokalität? Welche Formen der Affizierung und Subjektivierung finden sich durch die sozio-materiellen Konstellationen der Transformation? Wie verändert sich die Ästhetik von Alltagspraktiken?
Interessierte Autor*innen aus Wissenschaft und Praxis sind eingeladen, bis zum 15. April 2025 Exposés von maximal 500 Wörtern (exkl. Literaturverzeichnis) einzureichen. Dabei sind sowohl theoretische als auch empirische Beiträge erwünscht. Neben der Einreichung von Abstracts für fachwissenschaftliche Beiträge im Journal SuN sind auch Vorschläge für Blog-Beiträge für den 2023 gestarteten Begleit-Blog der SuN erwünscht, die an eine breitere Zielgruppe gerichtet sind. Alle Beitragsvorschläge können unter sun.redaktion@uni-muenster.de eingereicht werden.