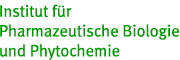only german version available:
Fast zur festen Institution geworden, fand nun schon zum vierten Mal im Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie der Universität Münster im Rahmen des strukturierten Nachwuchsförderprogrammes ein wissenschaftliches Symposium für Nachwuchswissenschaftler zum Thema „Phytotherapeutika in der aktuellen Forschung“ statt. Diese Young Researcher Meetings wenden sich bevorzugt an DoktorandInnen, die sich thematisch mit den zahlreichen Facetten der rationalen Phytopharmazie und Naturstoffchemie beschäftigen. Ziel der Workshops ist der Austausch wissenschaftlicher Ergebnisse von hohem Niveau zwischen den Dissertanten, die freie, konstruktive Diskussion der Resultate und Methoden ohne Zutun der jeweiligen Betreuer und älterer Wissenschaftler. Aber auch das gegenseitige Kennenlernen und eine gemeinsame festliche Abendveranstaltung sind wesentliche Aspekte des Symposiums.
Auch dieses Jahr fanden sich 43 Doktorandinnen und Doktoranden aus deutschen und schweizerischen Universitäten ein; vornehmlich PharmazeutInnen, aber auch MedizinerInnen, BiologInnen, BiotechnologInnen, u.a., deren Interesse, und manchmal (wie sich bei dieser Gelegenheit herausstellte) auch Leidenschaft in der wissenschaftlichen Untersuchung von Arzneipflanzen und Naturstoffen liegen. Das Spannende an diesen Tagungen ist die interdisziplinäre Beleuchtung von Fragestellungen aus den unterschiedlichen Sichtweisen der phytochemischen Naturstoffseite, der tierexperimentellen und molekularen Pharmakologie sowie aus der Sicht des klinisch tätigen Praktikers. Dieser vielschichtige Ansatz der Diskussion im Grenzgebiet zwischen Chemie, Pharmakologie und Klinik macht auch den Reiz dieser Symposien aus.
Im ersten Vortragsblock wurden Daten zur gezielten Entwicklung neuer Targets für bioaktive Naturstoffe referiert. Hierbei wurden Untersuchungen zur Anwendung von Extrakten gegenüber der Phospholipase A2 als neues Target für entzündungshemmende Pflanzendrogen präsentiert, wobei überraschenderweise häufig Drogen, die zur Durchspülungstherapie verwendet werden Enzymhemmung verursachten.
Ein gänzlich neues Target mit vielversprechenden Anwendungsgebieten stellt auch die humane Hyaluronidase 1 dar, die erstmals mittels Autodisplay-Technik untersucht werden konnte. Interessanterweise sind hier Triterpensaponine als mögliche Inhibitoren dieses Enzyms effektiv.
Anti-Trypanosomale Wirkstoffe aus der Natur werden mittlerweile spezifisch gegenüber der parasitären Glycerinaldehyd-3-Phosphatdehydrogenase erfolgreich gescreent, wobei mittlerweile ganze Substanzdatenbanken untersucht werden. Antiadhäsive Glycokonjugate gegenüber Helicobacter pylori-Infektionen werden mittlerweile aus verschiedenen Extrakten isoliert, die spezifisch Oberflächenadhäsine des Bakteriums inhibieren, die verantwortlich für die Wirt-Parasit-Erkennung sind.
In der zweiten Session wurden pharmakologische Daten präsentiert, die sich im Bereich der Diabetesbehandlung mit der Wirkung des Alkaloids Lupanin auf die Funktion der Beta-Zellen und die Glucosehomöostase beschäftigten. Es konnte auch gezeigt werden, dass Resveratrol deutliche positive Effekte auf die Insulinsekretion und Aktivität der Langerhans-Inseln hat. Ein komplex zusammengesetztes pflanzliches Handelspräparat mit Anwendung bei entzündlichen Darmerkrankungen wurde hinsichtlich pharmakologischer Effekte der einzelnen Drogen untersucht, wobei sich klare spasmolytische und antiinflammatorische Effekte belegen lassen, was die traditionelle Anwendung des Präparates belegt. Auch in dieser Session wurden Daten gegenüber den Erregern vernachlässigter Tropenerkrankungen präsentiert, wobei insbesondere Sesquiterpenlactone gegen Leishmania infantum vorgestellt wurden.
Herpes simplex Virus 1: jeder kennt Lippenherpes, aber Behandlungsstrategien erfolgen bis heute meist mit Replikationsinhibitioren. Interessant erscheinen deshalb Testsysteme, die zum ersten Mal die gezielte Untersuchung der Fusion zwischen Virus und Wirtszelle ermöglichen und das gezielte Screening von spezifischen Inhibitoren ermöglichen. Auch hier ergaben sich spannende „Hits“ aus der „Naturstoffkiste“.
Im Rahmen einer strukturierten Postervorstellung wurden bei Poster&Wein neue Aspekte klinischer, pharmakologischer und phytochemischer Forschung diskutiert. Beim anschließenden munteren Abendessen in großer Runde war auch kein Ende der wissenschaftlichen Gespräche zu verzeichnen.
Am nächsten Morgen wurden neben phytochemischen Untersuchungen auch Screeningdaten von Naturstoffen vorgestellt, die sich auf antiprotozoale Verbindungen weiterhin auf antiadhäsive Verbindungen gegen uropathogene E. coli, auf oligomere Proanthocyanidine gegenüber Wurmerkrankungen, und TCM-Drogen mit traditioneller Anwendung gegen Infektionen bezogen, die hochspezifisch das "quorum sensing" und damit die bakterieneigene Kommunikation unterbinden.
Phytochemisch spannende Daten wurden zu neuartigen oligomeren Proanthocyanidinen aus Weidenarten präsentiert, die wahrscheinlich als substituierte Verbindungen vorliegen können.
Im finalen Vortragsblock Biotechnologie und Biosynthese wurden spannende Daten vorgestellt, die aufzeigen, wie durch Kenntnis der Biosynthese gezielte Klonierungen zur Herstellung Naturstoff-produzierender Systeme für die biotechnologische Herstellung generiert werden können. Ein beeindruckendes Beispiel hierfür war die Herstellung eines antifungalen Peptids aus der Tomate, welches nach Klonierung in E. coli in guten Ausbeuten rekombinant hergestellt wurde und zur Untersuchung des vielversprechenden Wirkmechanismus zur Verfügung steht.
Auch die Klonierung und Expression verschiedener Prenyltransferasen aus Hypericum-Arten, die an Aromaten substituieren, war erfolgreich, und lässt erstmals gezielte Untersuchungen zur Natur dieser Enzyme zu, die wiederum entscheidende Hinweise auf die biosynthetischer Formation von Hyperforin und Analoga geben können.
Ein weiteres Projekt stellte die rekombinante Expression der Cysteinsynthase dar und die daraus folgende Untersuchung von Cyanidentgiftungsenzymen.
Eine Vielzahl von Postern rundete die Veranstaltung ab. Insgesamt bot sich ein aktuelles spannendes Programm mit intensiver Diskussion und einmal mehr hatte sich deutlich gezeigt, dass der Nachwuchs es hervorragend versteht, eigene Ergebnisse perfektioniert exzellent präsentieren, zu diskutieren und neue Ideen und Gedanken zu generieren.
Organisiert wurde die Tagung von Profs. A. Hensel, T. J. Schmidt (Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie, Universität Münster), Prof. K. Nieber (Pharmakologie, Universität Leipzig) und Prof. M. Düfer (Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie / Abt. Pharmakologie, Universität Münster).
Die gut geplante organisatorische und technische Abwicklung (herzlichen Dank!) lag in den bewährten Händen der „Event-Managerinnen“ Frau M. Plesse und E. Thiele.
Die Tagung wurde durch die Gesellschaft für Phytotherapie gefördert und durch die Firmen Cassela-med GmbH&Co.KG (Klosterfrau Healthcare Group), Dr. Loges GmbH, Medice Arzneimittel, MLP Finanzdienstleistungen AG, PhytoLab GmbH&Co.KG, Schwabe GmbH&Co.KG, Salus Haus GmbH&Co.KG, Sidroga GmbH, Steigerwald Arzneimittel GmbH, ThermoFisher GmbH und Waters GmbH unterstützt. Sie wäre ohne diesen großzügigen Support sicher in dieser Form nicht durchführbar gewesen.
Die Veranstalter freuen sich jetzt schon auf die nächste Veranstaltung 2017.
Prof. Dr. A. Hensel
Wissenschaftliche Leitung und Organisation:
Prof. Dr. M. Düfer, Universität Münster
Prof. Dr. A. Hensel, Universität Münster
Prof. Dr. K. Nieber, Universität Leipzig
Prof. Dr. T. J. Schmidt, Universität Münster