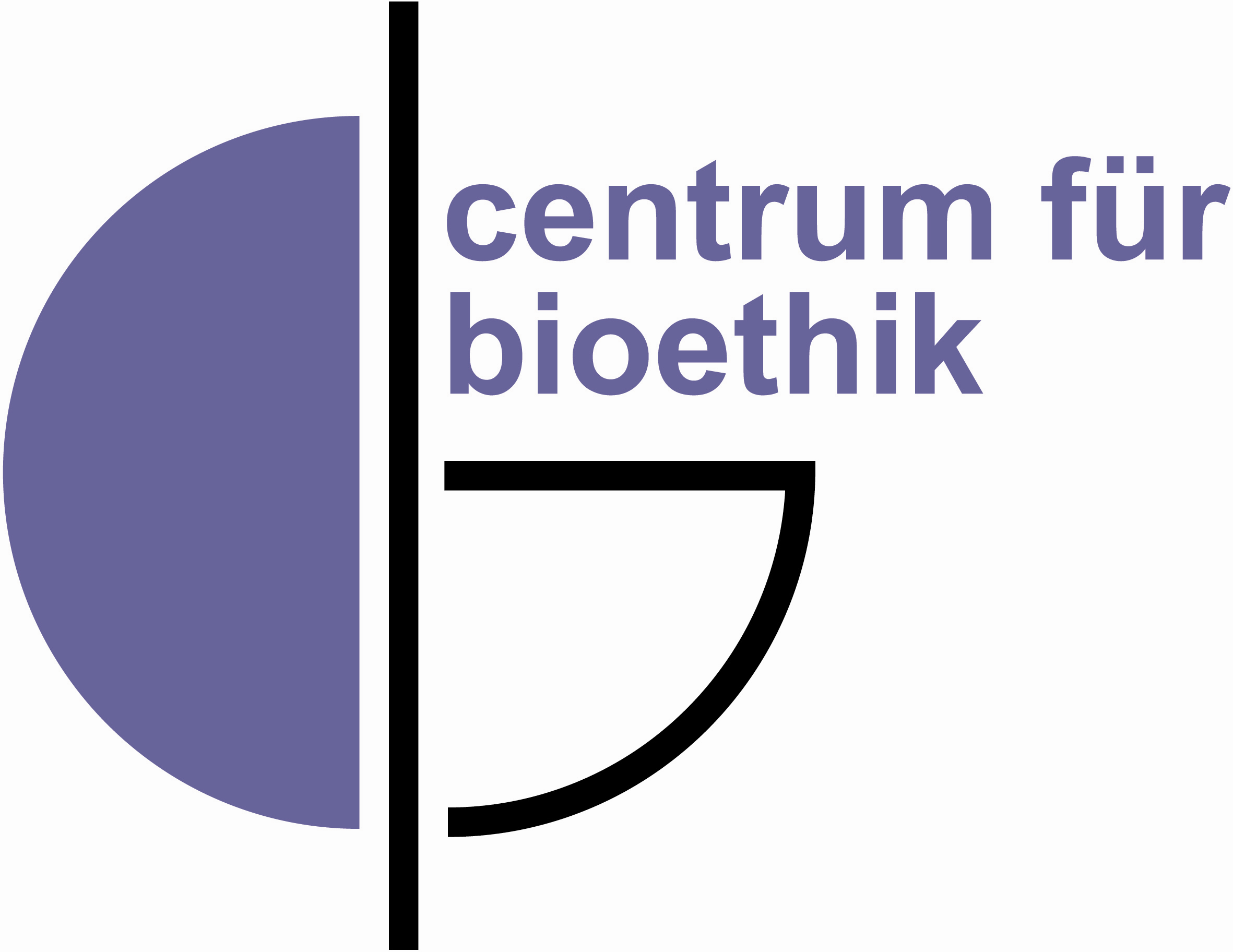Teilprojekt 4
Nutzen- und Schadenspotentiale von Forschungsprojekten einer Medizinischen Fakultät: eine empirische Analyse
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. Heiner Raspe
Zielsetzung und Konzeption
Hintergrund und Problematik
Eine Grundaufgabe der ethischen und rechtlichen Beurteilung von Forschungsprojekten an, mit und aus Menschen zielt auf die Analyse ihrer Nutzen-, Belastungs- und Schadenspotentiale. Probanden und Patienten sind, wo immer möglich, vor Belastungen und Risiken zu bewahren, die Teilnahme an Forschung soll ihnen selbst möglichst direkt nutzen. Darin stimmen alle normativen Vorgaben (u.a. Nürnberger Kodex, Deklaration von Helsinki, Biomedizin Kovention, Arzneimittelgesetz, GCP-Verordnung, Universal Draft Declaration on Bioethics and Human Rights) überein. Es handelt sich um ein altes und starkes ethisches Gebot, das rechtlich immer wieder befestigt worden ist, vor allem nach einer evidenten Überschreitung durch Forscher und ihre Projekte. Dies war in Deutschland schon mit der Preußischen Anweisung (1900) und den Reichsrichtlinien zur Forschung am Menschen (1931) der Fall.
In unserem Land sind die Rechte, das Wohlergehen und der Schutz der Teilnehmer klinischer Prüfungen in jüngerer Zeit noch einmal durch die eingreifenden Novellierungen des Medizinproduktegesetzes (MPG, 2002) und des Arzneimittelgesetzes (AMG, 2004) bekräftigt und gestärkt worden. Das AMG und die ihr folgende GCP-Verordnung von August 2004 setzen eine Richtlinie der EG (21/2001/EG) um.
Die eingangs erwähnte Beurteilung kann nicht allein den Forschern überlassen bleiben. Handelt es sich bei ihnen um Ärztinnen und Ärzte, dann sind sie berufsrechtlich gehalten, ihre Forschungsprojekte der Ethikkommission der für sie zuständigen Ärztekammer zur Beratung und Begutachtung vorzulegen. Sind sie als Ärzte oder Pflegende, Psychologen, Naturwissenschaftlicher etc. Mitglieder oder Mitarbeiter einer akademischen Einrichtung, dann ist für sie die Forschungsethikkommission ihrer Fakultät bzw. Universität zuständig.
In Deutschland gibt es mehr als 50 solcher nach Landesrecht gebildeten Ethikkommissionen. Sie sind in einem Arbeitskreis (www.ak-med-ethik-komm.de) zusammengeschlossen. An diesen und seine Mitglieder richten sich vom BMBF geförderten Empfehlungen zur Begutachtung klinischer Studien durch Ethik-Kommissionen (Raspe et al. 2005), die sich die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer im April 2005 zu Eigen gemacht hat. Ihre Items 15 und 16 widmen sich der Analyse der Nutzen- und Schadenspotentiale von Projekten der klinischen Forschung.
„Klinische Forschung“ wurde und wird uneinheitlich definiert. Eine frühe Denkschrift der DFG (1979) sah in ihr „alle wissenschaftlichen Aktivitäten, die der Aufklärung von Krankheitsphänomenen dienen“; der Wissenschaftsrat (1986) wollte zusätzlich „die wissenschaftliche Beschäftigung mit (der) Erkennung Behandlung“ von Krankheiten einschließen. Die DFG (1999) unterscheidet in ihrer letzten Denkschrift grundlagenorientierte, krankheitsorientierte und patientenorientierte Forschung. Allerdings befriedigt auch diese Differenzierung noch nicht vollständig, die drei Begriffe definieren ein sehr weites Feld, in dem nach Auffassung des Antragstellers (Raspe 2004) klinische Forschung im engeren, d.h. klinisch-handlungsleitenden Sinne unterschieden werden sollte. Es ist offensichtlich, dass Risiko- und vor allem Nutzenpotentiale für Studienteilnehmer wesentlich auch vom Typus klinischer Forschung abhängen. Grundlagenorientierte Forschung kann keinen direkten Nutzen für Probanden oder Patienten in Aussicht stellen. Eine für Ethikkommissionen beurteilungsrelevante Taxonomie und Kriteriologie von/für Forschungsprojekte/n mit, an und aus Menschen sind noch zu erarbeiten.
Während Belastungen und Risiken besonders in der therapeutischen Forschung relativ gut analysiert sind (so gibt es klare Vorstellungen, was „minimal risk and minimal burden“ sind), gilt das für die Potentiale aktuellen oder zukünftigen Nutzens sehr viel weniger. Das beginnt schon im Sprachlichen: gemeinhin wird von „Nutzen und Risiken“ so gesprochen, als gäbe es Nutzen nur im Indikativ, Risiken dagegen nur im Potentialis, als Wahrscheinlichkeit.
Zudem ist in vielen Dokumenten von einem „direkten“ (u.a. Richtlinie 2001/20/EG; AMG) oder „tatsächlichen und unmittelbaren“ (u.a. Biomedizin Konvention, Artikel 17) Nutzen die Rede. Irgendein Definitionsversuch ist keiner Verlautbarung zu entnehmen, obwohl sie sonst durchaus umfangreiche Begriffsbestimmungen enthalten (z.B. AMG, EG-Richtlinie). Auch die Figur des „Gruppennutzens“, der in der Biomedizin Konvention, dem AMG und der Draft Declaration on Bioethics and Human Rights und der GCP-Verordnung herangezogen wird, findet keine klare Definition, was in den Beratungen der Enquetekommission des Bundestages zu „Ethik und Recht der modernen Medizin“ selbst unter Fachleuten zu erheblicher Verwirrung führte. Auf sie dürfte sich ein Teil der emotional geführten deutschen Diskussion um die Figur des Gruppennutzens zurückführen lassen.
Eigene Vorarbeiten
Das Thema „Nutzen durch, in und aus klinischer Forschung“ hat unsere Arbeitsgruppe zuletzt in der Bearbeitung der o.g. Empfehlungen beschäftigt. Sie bauten auf zwei vorausgehenden Veröffentlichungen (Raspe 2005a, 2005b) auf. In diesen haben wir eigene Definitionen und eine Taxonomie des Nutzens (aber noch keine trennscharfen Kriterien) vorgeschlagen (s.u.). Diese sind inzwischen in die Arbeit der vorzeitig beendeten Enquetekommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“ eingeflossen. H. Raspe war als Sachverständiger der Kommission auch Mitglied ihrer Themengruppe Forschung (Bericht vom 6.9.2005).
Für die Nutzenanalyse und -beurteilung grundlegend ist die bereits erwähnte und auch rechtlich relevante Unterscheidung zwischen Eigen-, Gruppen- und Fremdnutzen. Eigennützige Forschung beinhaltet für die Forschungsteilnehmer jeder der möglicherweise mehreren Untergruppen ex ante (!) die Chance eines „direkten“ Nutzens durch die geprüften präventiven, diagnostischen, prognostischen, therapeutischen, rehabilitativen oder palliativen Methoden.
Bei gruppenützigen Projekten besteht eine solche Chance nicht, die Forschungsergebnisse beinhalten aber ein Nutzenpotential für nicht in die Studie eingeschlossenen Patienten oder Probanden mit gleichen demographischen und klinischen Merkmalen wie die Teilnehmer. Dies ist regelmäßig der Fall z.B. für die Teilnehmer Placebo-kontrollierter Studien. Die Mitglieder einer Placebogruppen können keinen Vorteil erwarten, der einerseits über eine Suggestionswirkung und andererseits über die Vermeidung eines möglichen Schadens durch das zu prüfende Verum hinausgeht. Eine Gruppennützigkeit ist für alle Teilnehmer diagnostischer oder prognostischer Validierungsstudien gegeben, in denen ein neuer Test mit dem bisherigen Goldstandard verglichen wird.
Bei fremdnütziger Forschung ist für keine heute gegebene Personengruppe ein Nutzen zu erwarten; ihre Ergebnisse dienen etwas „Fremdem“, zumeist der Wissenschaft, d.h. dem Verständnis natürlicher Prozesse in Gesundheit und Krankheit.
Ein Eigen- und Gruppen-Nutzen kann zudem als therapeutisch und/oder präventiv klassifiziert werden. Er kann früher oder mit z.T. erheblicher Verzögerung eintreten.
Belastungs- und Schadenspotential betreffen in erster Linie („direkt“) immer die Mitglieder einer der involvierten Studiengruppen. Unter anderem bei genetischen Forschungsprojekten sind aber auch Risiken (und Chancen) für Dritte, z.B. Familienangehörige, zu erwägen.
Außer Betracht bleibt hier der „Kollateralnutzen“ in und durch Forschungsprojekte, der u.a. einer überdurchschnittlichen ärztlichen Betreuung der in sie einbezogenen Patienten oder Probanden zugeschrieben wird. Für ihn gibt es bisher keine empirische Evidenz; jüngste Studien machen einen solchen Nutzen im Gegenteil unwahrscheinlich (Lemaire 2004; Vist et al. 2005). Er soll in diesem Projekt außer Betracht bleiben.
Das Projekt
Das hier beantragte Projekt geht von den oben vorgeschlagenen Unterscheidungen der Nutzen- und Schadens- bzw. Belastungspotentiale aus. Es schlägt vor, sie
(1) einem kritischen Literaturvergleich auszusetzen. Ein solcher wurde bereits im Zuge der Vorbereitungen der zitierten Empfehlungen (Raspe et al 2005, Abschnitt 4) begonnen; hierfür wurden rund 50 internationale Leit- und Richtlinien zur Durchführung und Beurteilung klinischer Forschungsprojekte durchgesehen. Allerdings steht eine kritische Sichtung und Analyse von Primärpublikationen in Zeitschriften und Büchern noch aus;
(2) die somit konsolidierten Unterscheidungen und Kriterien auf die 360 bis 400 Anträge und Studienprotokolle anzuwenden, die der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Lübeck in zwei Jahren vorgelegt werden (z.B. 2004, 2005).
Es sollen folgende wissenschaftliche Fragen bearbeitet werden:
- Welchen Typen „klinischer“ Forschung lassen sich die Projekte zuordnen? Hierfür sind zuerst eine Taxonomie und Kriteriologie zu entwickeln.
- Welche Nutzenpotentiale lassen sich – ex ante auf Basis der im Antrag zitierten Evidenz - qualitativ und quantitativ identifizieren?
- Lassen sie sich inhaltlich (genannte Ziel- bzw. Outcomes-Variablen) verschiedenen Nutzenklassen zuordnen?
- Lassen sich quantitative Unterscheidungen treffen unter Berücksichtigung von Effektstärken, absoluten Risikodifferenzen, anderen Assoziationsmaßen, Eintrittswahrscheinlichkeiten (NNT), Nachhaltigkeit.
Innerhalb der Anträge ist auf gelegentlich zu beobachtende Differenzen zwischen Studienprotokoll bzw. Ethikantrag und Patienteninformation und Einverständniserklärung zu achten.
An ausgewählten Anträgen (den Kompetenzen des Antragstellers entsprechend vor allem Anträge zu Studien mit rheumatologisch-orthopädischer Fragestellung) ist zu prüfen, ob die angegebenen Nutzenmöglichkeiten, Belastungen und Risiken mit den in der Literatur berichteten übereinstimmen.
Daneben gilt eine besondere Aufmerksamkeit genetischen und reproduktionsmedizinischen Studien, die Ethikkommissionen in zunehmender Frequenz vorgelegt werden, und für die sich besondere ethische und datenschutzrechtliche Fragestellungen ergeben, u.a. durch die mögliche Involvierung der Interessen Dritter, z.B. Familienangehöriger.
- Welche Chancen/Risikenabwägungen werden von den Antragstellern wie vorgenommen?
- Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Projekt für die o.g. „Empfehlungen“ von Raspe et al. (2005)? Sind sie zu ergänzen, zu präzisieren, anders zu fassen?
Zu erwartende Ergebnisse, Schlussfolgerungen
Der o.g. Arbeitskreis medizinischer Ethikkommissionen diskutiert schon länger eine Klassifikation von Forschungsprojekten mit, an und aus (d.h. ex vivo) Menschen. Eine Lösung konnte bisher nicht gefunden werden. Das hier beantragte Projekt lässt erwarten, dass eine solche vorgeschlagen, diskutiert und ggf. verabschiedet werden kann. Sie würde Eingang in die von uns erarbeiteten und jeweils neuen Erkenntnissen bzw. Vorschriften anzupassenden „Empfehlungen…“ finden.
Das gleiche gilt für eine Klassifikation von Nutzen-, Belastungs- und Schadenspotentialen. Gelänge es, hier zu überzeugenden Vorschlägen zu kommen, so würde dies der allseits beklagten Heterogenität der Beratungsprozesse und -ergebnisse der öffentlich-rechtlichen Ethikkommissionen in Deutschland entgegenwirken können. Hieran haben sowohl die DFG wie das BMBF ein intensives Interesse (cf. Empfehlungen S. 1/2).
Selbstverständlich würde auch die ethische und rechtliche Diskussion profitieren. So wird man, nach einer konsolidierten Definition von „Gruppennutzen“, noch einmal überlegen müssen, welche Argumente dafür und dagegen sprechen, Gruppennutzen bisher für nicht-einwilligungsfähige Kinder zu akzeptieren, für nicht-einwilligungsfähige Erwachsene aber auszuschließen. Es scheint möglich (jedenfalls notwendig), der bei uns fest gefahrenen Diskussion (cf. Protokoll der Enquete-Kommission zu einem öffentlichen Bürgerforum zum Thema „Die Biomedizinkonvention des Europarates – jetzt unterzeichnen?“, Tübingen, 4.7.2005) um die Biomedizin-Konvention und jetzt auch noch um die soeben in einer Vorversion veröffentlichte UN-„Declaration on Bioethics and Human Rights“ neue Impulse zu geben.