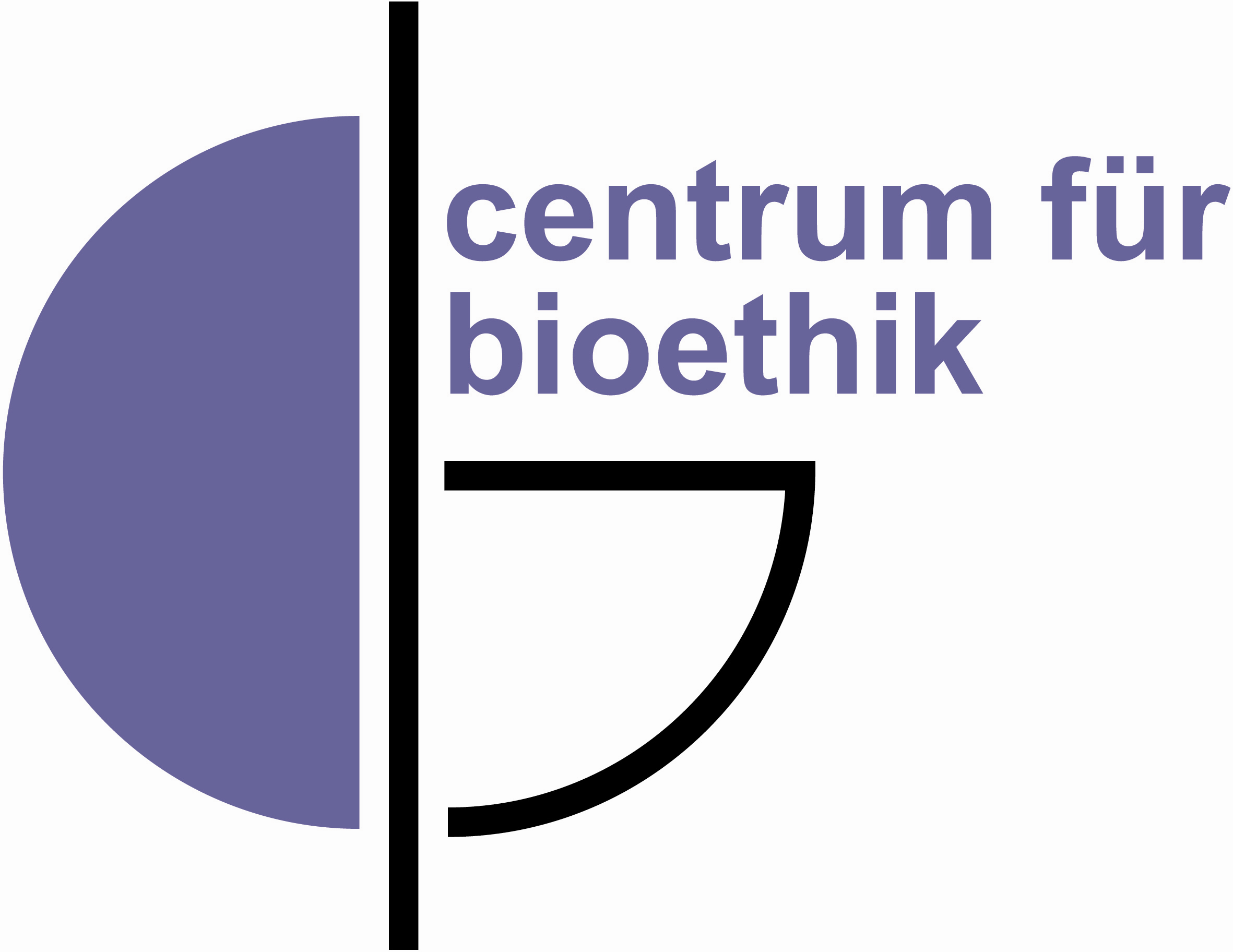Teilprojekt 3
Normative Grundlagen der klinischen Forschung an Einwilligungsunfähigen, insbesondere an Neugeborenen und Kleinkindern
Projektleiter: Prof. Dr. Reinhard Merkel
Zielsetzung und Konzeption
Hintergrund und Problematik
Seit August 2004 erlaubt das Arzneimittelgesetz (AMG) in seinem § 41 Abs. 2 Nr. 2 in engen Grenzen eine bestimmte Form nicht unmittelbar eigen-, sondern „gruppennütziger“ klinischer Forschung an Minderjährigen, nämlich die Prüfung neuer, noch nicht zugelassener Arzneimittel an Mitgliedern dieser Personengruppe. Die Regelung folgt einer Vorgabe der EU-Richtlinie 2001/20/EG zur „guten klinischen Praxis“. Sie ist sachlich auf Arzneimittelstudien und persönlich auf erkrankte Minderjährige beschränkt; gesunde Kinder sind als Probanden in jederlei Funktion ausgeschlossen (§ 41 Abs. 2, S. 1). Außerhalb der sachlichen Reichweite des AMG ist weiterhin jede fremdnützige Forschung an Nichteinwilligungsfähigen verboten. Auch das Medizinproduktegesetz (MPG) ist der Änderung des AMG nicht angepasst worden. Studien an Minderjährigen erlaubt es nur dann, wenn sie einen möglichen diagnostischen oder therapeutischen Nutzen für den jeweiligen Probanden selber versprechen (§ 20 Abs. 4 Nr. 1 MPG). Weitere spezialgesetzliche Regelungen zur klinischen Forschung an Einwilligungsunfähigen existieren nicht. Entsprechende Studien außerhalb von AMG und MPG, etwa zur Erprobung neuer chirurgischer oder anderer praktisch-therapeutischer Methoden, unterliegen damit den allgemeinen Verbotsschranken der familienrechtlichen Vorschriften des BGB. Diese gestatten eine Einwilligung der zuständigen gesetzlichen Vertreter in die Teilnahme Minderjähriger an solchen Studien nur im unmittelbaren eigenen (diagnostischen oder therapeutischen) Interesse des potentiellen Probanden (vgl. §§ 1626, 1627, 1666 BGB). Drittnützige Forschungen dieser Provenienz an Einwilligungsunfähigen sind damit schlechterdings ausgeschlossen.Das ist ein höchst unbefriedigender, von Klinikern wie Forschern einhellig beklagter Zustand. Der Grund liegt auf der Hand: Im Maße ihres gesetzlichen Ausschlusses von der Teilnahme an klinischen Studien bleiben Kleinkinder auch von der Entwicklung neuer diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten ausgeschlossen, die nur in solchen Studien geprüft und zur Anwendungsreife gebracht werden können. Damit wird eine ganze Bevölkerungsgruppe von wesentlichen Teilen des medizinischen Fortschritts abgekoppelt oder doch nur mittelbar und vielfach risikobelastet an ihm beteiligt, nämlich über den sog. „off-label use“ von Medikamenten, die nur an Erwachsenen erprobt worden und nur für diese zugelassen sind. Es ist aber eine Binsenweisheit, dass Kinder im Hinblick auf die Metabolisierung von Arzneimitteln und damit das Auftreten von erwünschten und vor allem von unerwünschten Effekten nicht etwa „kleine Erwachsene“ sind, also ihr Medikamentenbedarf nicht einfach durch Extrapolation aus dem von Erwachsenen abgeleitet werden kann. Einige schwere Arzneimittelkatastrophen im Bereich der Pädiatrie und Neonatologie haben das in den vergangenen 50 Jahren mit hohen Opferzahlen bitter beglaubigt (Christensen, Helms, Chesney 1999: 593 ff.; Blumer 1999: 598 ff [601 f.]). Auch die Thalidomid- („Contergan“-)Katastrophe in Deutschland gehört im weiteren Sinn in diesen Zusammenhang.
Seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wird der skizzierte Zustand als „therapeutic orphanism“ von Kleinkindern bezeichnet, als deren Waisen- oder bestenfalls Stiefkinder-Status gegenüber der klinischen Entwicklung (Shirkey, 1968: 119f.). Das wirft ersichtlich ein gravierendes Problem der sozialen Gerechtigkeit auf, nämlich das einer rechtlichen wie tatsächlichen (Un-)Gleichbehandlung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Andererseits steht außer Zweifel, dass Kleinkinder gegenüber invasiv-forschenden Zugriffen in besonderem Maße schutzbedürftig sind. Auch das ist, nämlich in skandalösen Übergriffen einer skrupellosen Forschung, mehrfach bitter belegt worden (Glantz 1998: 213 ff.; Levine 1988: 70 f.).
Damit ist das Problem prima facie als Dilemma markiert. Dass seine normativen Grundlagen von den bisherigen Debatten – jedenfalls in Deutschland – auch nur annähernd vollständig erfasst und transparent gemacht worden wären, kann man nicht behaupten. Stattdessen herrschen hierzulande zwei mehr oder weniger apodiktische Grundhaltungen vor: Erstens die vollständige Verwerfung jeder drittnützigen Forschung an Kleinkindern im Hinblick auf das grundgesetzliche Instrumentalisierungsverbot, also den Menschenwürdeschutz nach Art. 1 Abs. 1 GG; und zweitens die Behauptung, gruppennützige Forschung erweise sich bei genauerem Hinsehen in Wahrheit als eigennützig. Beide Positionen sind unrichtig. Die ihnen zugrunde liegenden Irrtümer sind freilich noch wenig verstanden – so wenig wie die rechtsprinzipiellen Schwierigkeiten im Normfundament der gesamten Materie. Man kann – und an diesen trivialen Satz muss angesichts der dargestellten Lage wohl erinnert werden – die normativen Probleme solcher Studien jedenfalls nicht dadurch lösen, dass man sie verschwinden lässt.
Projektziele
Damit ist die Aufgabe umrissen. Ihre Lösung scheint mir eine eingehende Klärung vor allem der folgenden (noch sehr groben) Überlegungen vorauszusetzen.1. Begriffliche Fundamente
Die zentralen Begriffe des „Nutzens“ bzw. „Schadens“, der den Probanden (oder Dritten) aus solchen Studien erwachsen kann, müssen erheblich genauer bestimmt werden, als das bislang geschehen ist. Der Grund dafür ist selbstverständlich kein einfach lexikalisches Interesse, sondern das einer normativen Klärung. Es ist trivial und offensichtlich, dass die möglichen Differenzierungen innerhalb der semantischen Reichweite beider Begriffe jedenfalls prima facie normative Folgen nach sich ziehen. Grob: was „Schaden“ genannt werden kann oder muss, ist grundsätzlich verboten, was „Nutzen“ heißen, kann dagegen erlaubt oder geboten.
Das sei für unser Thema an einigen Fragen exemplarisch illustriert:
- Können Studien noch „eigennützig“ heißen, wenn sie für den Probanden zwar keinen unmittelbaren Nutzen haben, einen späteren mittelbaren aber immerhin als möglich erscheinen lassen, etwa weil sie Therapien befördern sollen, die dem Probanden bei einer späteren (Wieder-)Erkrankung zugute kommen könnten? Oder sogar, weil sie zeitlich weit entfernte und gewissermaßen nur mehrfach vermittelte positive Effekte haben könnten, z.B. insofern, als ein heutiges Kleinkind später selbst Kinder haben mag, die an einer Krankheit leiden, zu deren dann verfügbarer Therapie auch die derzeit in Frage stehende Studie möglicherweise einen fördernden Beitrag leistet?
- Oder: Sind Studien auch dann noch „eigennützig“, wenn sie neben zahlreichen anderen, ausschließlich fremdnützigen Zielvorgaben ein einziges Element enthalten, das auch einen möglichen Nutzen für den Probanden verspricht?
- Oder schließlich: Welche Wahrscheinlichkeiten der erhofften Ergebnisse müssen oder sollten für solche „Nutzen“-Klassifizierungen jeweils vorausgesetzt werden? Auch jenseits dieser Fragen sind weitere Differenzierungen denkbar (vgl. etwa National Bioethics Advisory Commisson [USA] 2001: 73 f.).
Diese Fragen und Aufgaben sind in Deutschland derzeit von konsensfähigen Lösungen, überwiegend sogar von ihrer genaueren Formulierung noch weit entfernt. Dass solche Lösungen für die weitere Entwicklung der klinischen Forschung an Kleinkindern gefunden werden müssen, ist vor dem Hintersrund des eingangs angedeuteten Problems des „therapeutic orphanism“ aber offensichtlich.
2. Normative Grundfragen
a) Das prinzipielle Problem der gruppen- oder sonst fremdnützigen Forschung an Kindern liegt – soweit sie nicht in einem gänzlich nicht-invasiven Umgang, etwa dem der bloßen Beobachtung besteht – auf der Hand: Sie greift in grundrechtsgeschützte Sphären des Kindes ein, ohne dass es die Möglichkeit einer rechtfertigenden Einwilligung gäbe. Zwar sind Eltern im Hinblick auf körperliche Eingriffe an ihren Kindern, die im Rahmen indizierter medizinischer Behandlungen erforderlich werden, berechtigt und ggf. verpflichtet. Das ist aber nicht als gleichsam stellvertretende Ausübung von Autonomie, also einer freien Entscheidungsmöglichkeit zu verstehen. Vielmehr sind die Eltern verpflichtet, diese Zuständigkeit allein im objektiven Interesse ihres Kindes auszuüben; sie unterliegen insofern einer genauen rechtlichen Kontrolle (§§ 1626, 1627, 1666 BGB). Eine ausschließlich fremdnützige Forschung liegt aber nach rechtlichen Kriterien nicht im eigenen Interesse des Kindes. Körperliche Eingriffe, die einer solchen Forschung dienen sollen, sind daher von der Einwilligungskompetenz der Eltern grundsätzlich nicht gedeckt.
b) Deshalb kann die Legitimation einer gruppen- oder sonst fremdnützigen Forschung an Kindern, soweit sie überhaupt begründbar ist, vermutlich nur einer wohlverstandenen Einbindung bereits der frühkindlichen Patienten in die Fairness-Textur der gesellschaftlichen Normenordnung entnommen werden. Denn allenfalls aus dieser scheint sich eine genuin eigene Inpflichtnahme der Kinder im Hinblick auf fremdnützige Eingriffe in bestimmten (engen) Grenzen ableiten zu lassen. Allgemein formuliert besagt das: Solche Forschungen könnten dann zulässig sein, wenn ihnen (eng begrenzte) Eingriffsrechte der Forschenden zugrunde lägen, denen auf Seiten der Probanden (entsprechend schwache) solidarische Duldungspflichten korrespondierten. – Das legt zunächst zwei Grundfragen nahe:
- Welche prinzipiellen Handlungserlaubnisse (moralischer wie rechtlicher Provenienz) kennen und anerkennen wir, die möglicherweise schon für sich allein, also ohne Blick auf den Handlungsadressaten, das Handeln des Forschenden legitimieren können?
- Welche prinzipiellen Duldungspflichten, ebenfalls moralischer wie rechtlicher Natur, kennen und anerkennen wir, die möglicherweise die Zumutung eines forschenden Eingriffs auch dann legitimieren können, wenn dessen Adressat einwilligungsunfähig ist.
Beide Fragen werden in Deutschland nicht selten prinzipiell abgewiesen, nämlich mit der Auskunft beschieden, unsere Normenordnung kenne und anerkenne weder das eine noch das andere. Das ist aber nicht richtig. Zu unseren legitimen ethischen wie rechtlichen Grundnormen gehören (erstens) zahlreiche Handlungserlaubnisse, die ohne Blick auf die Handlungsfolgen gewährt werden, wiewohl sie unbeteiligten Dritten Risiken für Leib und Leben zumuten. Und wir bejahen (zweitens) mit guten ethischen Gründen auch bestimmte, im Umfang geringfügige Duldungspflichten, die jeweils korrespondierende Eingriffserlaubnisse ohne Blick auf die Zustimmung des Eingriffsadressaten gewähren. Auch die Rechtsordnung erkennt solche Duldungspflichten und die korrespondierenden Eingriffsrechte an (vgl. etwa die §§ 34 und 323c StGB). Nicht jede Rechtsordnung tut das; unsere hat aber für ihre Entscheidung die besseren Gründe auf ihrer Seite. Die in der Rechtstheorie geläufigen Kennzeichnungen der beiden angedeuteten Normprinzipien lauten: „erlaubtes Risiko“ und „Notstands(duldungs)pflichten aus Solidarität“.
c) Freilich ist dabei sogleich Folgendes zu bedenken: Die rechtliche Kategorie des erlaubten Risikos gewährt, richtig verstanden, keine Eingriffs-, also Verletzungserlaubnisse. Sie gewährt vielmehr, wie der Begriff selber bereits andeutet, Erlaubnisse zu einem Verhalten, das gewisse (grundsätzlich sehr geringe) Risiken für andere schafft. Verwirklicht sich ein solches Risiko dann unerwarteterweise in einem Eingriff, einem sog. Verletzungserfolg, so wird dem zuvor eben erlaubt Handelnden dieser Erfolg nicht als rechtswidrig verursacht zugerechnet. Gleichwohl bedeutet das nicht, dass er den Erfolg herbeiführen durfte, also ein Recht gerade dazu hatte. Beispielhaft: Wenn Eltern ihr Kind ins Flugzeug setzen, damit es den Onkel in Amerika besuchen kann, dann kennen sie typischerweise das Risiko, dass Flugzeuge manchmal abstürzen. Die Zumutung dieses geringen und sozialadäquaten Risikos ist dem Kind gegenüber aber erlaubt. Stürzt nun das Flugzeug wider Erwarten tatsächlich ab und kommt das Kind dabei ums Leben, so kann man durchaus sagen, dass die Eltern erlaubt gehandelt und dadurch den Tod ihres Kindes verursacht haben. Nicht sagen kann man aber, dass sie ihr Kind erlaubt getötet hätten. Denn eine solche (Tötungs-) Erlaubnis hatten sie selbstverständlich nicht.
In diesem Sinne kommt das Prinzip des erlaubten Risikos ersichtlich nicht als tragendes Normfundament für Eingriffe im Rahmen fremdnütziger klinischer Forschungen an Einwilligungsunfähigen in Betracht, selbst wenn diese Eingriffe nur in minimalen Belastungen bestehen. Denn solche Belastungen werden nicht als zwar mögliche, aber unerwartete Folgen eines nur als solchen erlaubten riskanten Verhaltens in Kauf genommen. Im Rahmen der Forschung werden sie vielmehr als sichere, die Forschung erst ermöglichende Eingriffe produziert. Dafür gewährt aber, wie oben angedeutet, das Prinzip des erlaubten Risikos keine Deckung. Das macht es in unserem Zusammenhang jedoch keineswegs bedeutungslos. Denn wenn sich diese normative Deckung anderswoher beschaffen und beglaubigen ließe, dann wären den in anderen Zusammenhängen geläufigen normativen Kriterien der Begrenzung (sogar) des erlaubten Risikos wichtige Aufschlüsse über die gebotene Begrenzung (erst recht) für ein direkt eingreifendes Forschen an Kindern zu entnehmen.
Aber die prinzipiell legitimierende Deckung einer solchen Forschung kann sich, sofern sie überhaupt zu haben ist, nur aus dem zweiten oben erwähnten Grundprinzip ergeben – dem einer genuin eigenen solidarischen Eingriffsduldungspflicht des Kindes selber. Und eine solche Pflicht dürfte sich allenfalls im normativen Rahmen eines allgemeinen Fairnesszusammenhangs des Gebens von (minimalen) Opfern und Nehmens von (ganz erheblichen) Vorteilen innerhalb eines im Grundsatz solidarisch organisierten Systems der gesellschaftlichen Gesundheitsversorgung begründen lassen.
3. Die daraus resultierende hauptsächliche Aufgabe
Vor diesem Hintergrund kann man nun die Kernaufgabe des Teilprojekts etwa in den folgenden Fragen umreißen:
- Ob und ggf. wie sich die genannten beiden Grundprinzipien tatsächlich auf die Probleme der Forschung an Einwilligungsunfähigen anwenden lassen;
- wie weit dann ihr Lösungspotential reicht bzw. wo genau ihre Grenzen verlaufen und in welcher Weise sie ggf. weiterentwickelt werden müssen und können;
- ob es insofern normative Unterschiede zwischen kranken und gesunden Kindern als potentiellen Probanden gibt;
- wie weit solche primär individualrechtlichen Normprinzipien auch auf das rechtspolitische Handeln des Gesetzgebers projizierbar sind, welche normativen Grenzen, aber auch welche Ausdehnung der Reichweite solcher Prinzipien sich dabei möglicherweise ergeben und welcher Modifikationen in der Formulierung der Prinzipien selber es dann gegebenenfalls bedarf.
Unter den hier angedeuteten Kategorien des „erlaubten Risikos“ und der „Eingriffsduldungspflichten aus Solidarität“ ist (wie angedeutet) die skizzierte Aufgabe in Deutschland noch nicht formuliert, geschweige denn jemals genauer untersucht worden. Der Verfasser dieser Zeilen selbst hat allerdings einen ersten Vorschlag der entsprechenden Forschungsdesiderata ausgearbeitet und schriftlich vorgelegt (Merkel 2005: 137 ff.). Damit ist ein dringendes Anliegen der Forschung bezeichnet.