
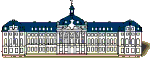
 |
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
|
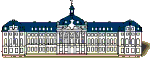 |
| Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin - Allgemeine Pädiatrie - Pädiatrische Nephrologie Waldeyerstr. 22 48149 Münster Leiterin: Prof. Dr. Med. Monika Bulla |
Tel. (0251) 83-56217, 83-56215
Fax: (0251) 83-58699 www: http://medweb.uni-muenster.de/institute/paed/ |
|
|
|
||||
|
|
Forschungsschwerpunkte 2001 - 2002 Fachbereich 05 - Medizinische Fakultät |
|||
|
Molekulargenetische Untersuchung bei therapieresistentem nephrotischem Syndrom
Ein nephrotisches Syndrom (NS) ist charakterisiert durch eine große Proteinurie,
Hypalbuminämie, Hypertriglyzeridämie und Ödeme. Es beruht auf einer pathologischen
Permeabilität der Filtrationsbarriere der Glomeruluskapillare. Diese normalerweise hochselektiv
arbeitende Filtrationsbarriere wird hauptsächlich durch die komplexe Zytoarchitektur im Bereich der
Schlitzmembran der Podozytenfußfortsätze bestimmt. Liegt eine Störung der von den
Podozyten exprimierten spezifischen Moleküle in der Schlitzmembran oder in der Verankerung in der
glomerulären Basalmembran vor, so wird die Glomeruluskapillare permeabel für
großmolekulare Eiweiße und es entwickelt sich ein therapeutisch unbeeinflussbares NS.
Für einige hereditäre NS-Formen konnten Mutationen der podozytenspezifischen
Proteinmoleküle aufgedeckt werden. Hierbei handelt es sich um die Erkrankungen congenitales
nephrotisches Syndrom vom finnischen Typ (CNF), fokal segmentale Glomerulosklerose (FSGS) und diffuse
mesangiale Sklerose (DMS). Beim CNF wurde der Genort auf dem Chromosom 19q12-q13 kartiert (NPHS1).
Das Gen codiert für das von den Podozyten exprimierte transmembranöse Protein Nephrin. Bis
heute sind 36 Mutationen des NPHS1 beschrieben. Beim familiären autosomal rezessiven FSGS konnte
der Genort auf dem Chromosom 1q25-32 (NPHS2) und als Genprodukt das Eiweiß-Podocin aufgedeckt
werden. Die Erkrankung beruht auf Nonsense-, Missense- und Splicestellen-Mutationen. Beim autosomal
dominanten FSGS ist der Genort das Chromosom 19q13 und das Genprodukt a-Actinin 4. Podocin bindet an die zytoplasmatische Domäne von Nephrin und
verstärkt die Nephrinsignaltransduktion. a-Actinin 4 ist für die
Verankerung der Podozyten von Wichtigkeit.
Bei einem weiteren hereditären NS, dem DMS ist der Genort und das Genprodukt noch unbekannt.
Jedoch ein Drittel der Fälle mit DMS ist mit einem Wilms-Tumor und/oder Pseudohermaphroditismus
masculinus assoziiert (Denys-Drash-Syndrom). Hier besteht eine nachweisliche WT1-Gen-Positivität.
Das Wilms-Tumor-Suppressor-Gen WT1 kartiert auf dem Chromosom 11p13. WT1 codiert für den
Zinkfingertranskriptionsfaktor, welcher eine wesentliche Rolle in der embryonalen Entwicklung der Nieren
und Gonaden spielt. Solch eine WT1-Mutation, wie sie bei Patientin mit isolierter DMS gefunden wird,
lässt sich auch bei Patienten mit FSGS nachweisen.
Mit Hilfe solcher molekulargenetischer Untersuchungen eröffnet sich die Möglichkeit, NS bzgl.
der therapeutischen Beeinflussbarkeit, der Familiarität, des Tumorrisikos und der Rekurrenzgefahr im
Transplantat zu differenzieren. So ist bei der Hotspot-Mutation Fin-Major beim CNF in 30 % der
Fälle mit einem Wiederauftreten der Proteinurie im Transplantat aufgrund einer
Antikörperbildung gegenüber dem Nephrin des transplantierten Organs zu rechnen. Bei
familiären FSGS mit Podocin-Mutation ist bisher eine Rekurrenz im Nierentransplantat, wie es in
30 % der Fälle des sporadischen FSGS eintritt, nicht beobachtet worden. Der Nachweis einer
WT1-Mutation macht eine engmaschige sonographische Überwachung des durch Wilms-Tumorrisiko
bedrohten Patienten erforderlich. Bei terminaler Niereninsuffizienz sollte bei solch einem Patienten durch
bilaterale Nephrektomie eine Tumorprävention angestrebt werden.
In Form einer engen internationalen und interdisziplinären Kooperation mit humangenetischen Instituten
werden Kinder mit therapieresistentem nephrotischem Syndrom und frühkindlichem nephrotischem
Syndrom bzgl. ihrer molekulargenetischen Veränderungen untersucht. In Nephrektomiepräparaten
wird den Veränderungen der Podozyten intensiv nachgegangen.
Beteiligte Wissenschaftler: Veröffentlichungen: |
||||