
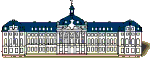
 |
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
|
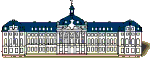 |
| Klinik und Poliklinik für Neurologie Albert Schweitzer Strasse 33 48149 Münster Direktor: Prof. Dr. med. E. B. Ringelstein |
Tel. (0251) 83-48016
Fax: (0251) 83-48181 e-mail: r.reilmann@uni-muenster.de www: http://neurologie.uni-muenster.de/ |
|
|
|
||||
|
|
Forschungsschwerpunkte 2001 - 2002 Fachbereich 05 - Medizinische Fakultät |
|||
|
Spracherwerb und statistisches Lernen: Entwicklung eines Spracherwerbsmodells
Von der
Arbeitsgruppe
wurde ein auf impliziten Lernprinzipien basierendes Kunstsprachtraining entwickelt und geprüft.
Unter
implizitem Lernen, im Kontrast zu explizitem Lernen, versteht man Lernen ohne bewusste
Erinnerungsstrategien. Implizite Lernmodelle haben sich bei der Behandlung hirngeschädigter
Patienten
als sehr vielversprechend erwiesen, da der Lernprozess unabhängiger von
Aufmerksamkeitsressourcen
ist als beim expliziten Lernen.Zunächst wurde mit Hilfe einer im Internet verfügbaren
Software
ein Datensatz von Kunstwörtern aus zufälligen Vokal-Konsonant-Folgen mit jeweils vier
Buchstaben generiert. Diese 183, von einer männlichen Stimme gesprochenen und in bezug auf
Wortlänge und Lautstärke normalisierten Kunstwörter sowie 125 Zeichnungen des
für den amerikanischen Sprachraum in der 80'er Jahren standardisierten Bildermaterials wurden
40
studentischen Probanden zur Beurteilung vorgegeben (Breitenstein & Knecht, 2002). Es wurden 50
Kunstwörter nach den Kriterien ausgewählt, dass a) das Kunstwort von
mindestens 80
Prozent der Probanden richtig erkannt wurde; b) jeweils nicht mehr als drei Probanden die
gleiche
Assoziation mit existierenden Wörtern hatten; und c) der Klang des Kunstwortes als
emotional
neutral beurteilt wurde. Für die Auswahl der 50 Bilder bestand das Kriterium, dass mehr als
95 Prozent der Beurteiler das Bild mit dem gleichen Namen benannten. Die
ausgewählten Bilder
und Kunstwörter wurden nach einem Zufallskriterium gepaart, d.h. es gab insgesamt 50 richtige
Zuordnungen für jeden Probanden (z.B. war das Kunstwort "enas" korrekt mit dem Bild eines
Hundes
gepaart). Für jeden Probanden waren die richtigen Zuordnungen unterschiedlich (d.h. bei einem
weiteren
Proband war das Kunstwort "enas" mit dem Bild eines Schmetterlings korrekt gepaart), um
systematische
Paarungseffekte wie Lautmalerei zu vermeiden. Das implizite Lernprinzip besteht darin, dass die
korrekten
Zuordnungen über die verschiedenen Trainingsblocks hinweg häufiger auftreten als die
inkorrekten Zuordnungen. Im ersten Block mit 200 Durchgängen beträgt das
Verhältnis
von korrekten zu inkorrekten Zuordnungen 2:1 und steigt bis zum fünften Block auf ein
Verhältnis von 10:1 an. Insgesamt wurden drei verschiedene Gruppen von jeweils 15 bis 21
Probanden
untersucht. Bei zwei Gruppen fanden die insgesamt fünf Trainingssitzungen mit jeweils zwei
Blocks an
fünf unterschiedlichen Tagen (mit einem Abstand von 1-5 Tagen) statt. Die erste Gruppe lernte
ohne
Rückmeldung (Breitenstein & Knecht, 2002). Der zweiten Gruppe wurde nach jedem
Durchgang mittels
eines "smiley"oder "whiney" rückgemeldet, ob ihre Antwort richtig oder falsch war. Wie zu
erwarten,
war die Lernkurve in der Gruppe mit Rückmeldung (explizites Lernen) anfangs steiler, aber der
Lernerfolg war nach dem fünften Block insgesamt vergleichbar. Dieses Ergebnis zeigt, dass
durch
implizites Lernen stabile Verhaltensänderungen erzielt werden können, ohne dass die
Probanden
bewusst Aufmerksamkeit und Konzentration auf den Spracherwerb verwenden. Das implizite Training
sollte
sich daher besonders für Patienten mit Aphasie eignen, da diese zusätzlich häufig an
unspezifischen Aufmerksamkeitsstörungen leiden. Die dritte Gruppe nahm innerhalb einer
Sitzung an
fünf Trainingsblöcken à 200 Durchgängen teil (Kurzversion). Die
Kurzversion
wurde für eine von unserer Gruppe geplante funktionelle Kernspintomographie-Untersuchung
des
Gehirns zum Kunstspracherwerb entwickelt. Außerdem wurde in dieser Experimentalkohorte
eine
ausführliche, neuropsychologische Testbatterie (verbale und visuell-räumliche Intelligenz,
verbales und visuell-räumliches Kurz- und Langzeitgedächtnis, Merkfähigkeit
für
Wörter, Daueraufmerksamkeit, Persönlichkeitstests) sowie eine funktionelle transkranielle
Dopplersonographie-Untersuchung zur Erfassung der Sprachlateralisation durchgeführt. Dabei
zeigte
sich, dass weder Intelligenz- noch Gedächtnisleistungen noch die
Hemisphärenspezialisierung
eine signifikante Korrelation mit dem Trainingserfolg aufwiesen. Allein die Anzahl flüssig
gesprochener
Fremdsprachen sowie die Merkfähigkeit für Wörter korrelierte signifikant mit der
Verbesserung vom ersten zum fünften Trainingsblock, was die Validität unseres
Trainingsprogramms stützt. Das Kunstsprachmodell hat hohe ökologische Relevanz
für den
natürlichen Spracherwerb bei Kindern (Erstspracherwerb) und Erwachsenen
(Zweitspracherwerb) sowie
für den Sprach-Neuerwerb nach einer Hirnschädigung wie bei der Aphasie
(zusammenfassend s.
Breitenstein & Knecht, 2003). Sowohl der Erstspracherwerb als auch der Wiedererwerb von
Sprache nach
Aphasie folgt dem Prinzip, dass zuerst einzelne Worte gelernt werden, die dann mit Hilfe
grammatischer
Regeln zu längeren Spracheinheiten verknüpft werden. Untersuchungen mit Kindern legen
nahe,
dass diese die ersten Wortbedeutungen allein aufgrund des wiederholten gemeinsamen Auftretens
eines
Perzepts (z.B. der Nachbarshund im Garten) und eines spezifischen Lauts (z.B. "Hund") lernen. Aus
theoretischen und pragmatischen Gründen wurde das Sprachtraining auf die sogenannte
semantische
Komponente, d.h. das Erlernen von Wortbedeutungen beschränkt. Die Semantik spielt bei der
erfolgreichen Kommunikation eine wichtigere Rolle als die grammatische Komponente der Sprache.
Klinische
Beobachtungen legen nahe, dass Patienten mit einer Broca Aphasie, die durch häufige
grammatische
Defizite bei erhaltener Semantik gekennzeichnet sind, effizienter Informationen übermitteln
können als Patienten mit einer Wernicke Aphasie mit erhaltener grammatischer Fähigkeit,
aber
beeinträchtigter Semantik.
Drittmittelgeber: Beteiligte Wissenschaftler: Veröffentlichungen: |
||||