
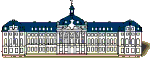
 |
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
|
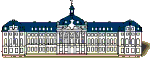 |
| Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten - Allgemeine Dermatologie und Venerologie - Von-Esmarch-Str. 58 48149 Münster Leiter: Prof. Dr. Thomas Luger |
Tel. (0251) 83-5 6504
Fax: (0251) 83-5 6522 e-mail: derma@uni-muenster.de www: http://www.klinikum.uni-muenster.de/institute/derma/ |
|
|
|
||||
|
|
Forschungsschwerpunkte 2001 - 2002 Fachbereich 05 - Medizinische Fakultät |
|||
|
Untersuchungen zum Nebenwirkungsprofil der Calcineurininhibitoren
Zu Beginn einer Therapie
mit Tacrolimus, aber auch im geringern Ausmaß bei topischer Anwendung von Pimecrolimus bemerken
die Patienten ein vorübergehendes Brennen, Juckempfinden oder Erythem. Diese Nebenwirkungen
ähneln der neurogenen Entzündung, die durch eine topische Capsaicintherapie und der durch
Capsaicin verursachten Neuropeptidausschüttung hervorgerufen wird. Da die Neuropeptidausschleusung
durch Capsaicin mittels morphologischer Methoden bestätigt werden konnte, lag es nahe, dies auch
für die Calcineurininhibitoren zu überprüfen. Dazu wurden Balb/c Mäuse zwei Mal
täglich mit Pimecrolimus 1% oder Tacrolimus 0,1% am Rücken behandelt. Anhand
immunfluoreszenzoptischer Untersuchungen konnte gezeigt werden, das die sensorischen Nervenfasern schon
nach 2 Tagen kontinuierlicher Applikation eine verringerte Immunreaktivität für die Neuropeptide
SP und CGRP aufwiesen. Zusätzlich fand sich nach 2 und 4 Tagen topischer Anwendung von
Tacrolimus bzw. nach 8 Tagen topischer Pimecrolimus-Applikation eine Degranulation der Mastzellen. Diese
Befunde legen die Vermutung nahe, dass Tacrolimus und Pimecrolimus Neuropeptide ausschleusen, die
wiederum auf Mastzellen wirken, um dort eine Degranulation zu bewirkten. Durch diese Hypothese
wären einerseits die initialen Nebenwirkungen erklärbar. Zum anderen bieten die Befunde auch
einen Erklärungsansatz für die gute antipruritische Wirkung beider Substanzen, die direkt
sensorische Nervenfasern beeinflussen. Bislang ist jedoch noch unklar, über welche Rezeptoren diese
Effekte mediiert werden.
Beteiligte Wissenschaftlerin:
|
||||