
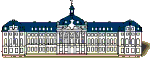
 |
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
|
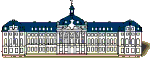 |
| Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin - Allgemeine Pädiatrie - Pädiatrische Nephrologie Waldeyerstr. 22 48149 Münster Leiterin: Prof. Dr. Med. Monika Bulla |
Tel. (0251) 83-56217, 83-56215
Fax: (0251) 83-58699 www: http://medweb.uni-muenster.de/institute/paed/ |
|
|
|
||||
|
|
Forschungsschwerpunkte 2001 - 2002 Fachbereich 05 - Medizinische Fakultät |
|||
|
Sevelamer-Studie
Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz weisen aufgrund einer unzureichenden renalen
Phosphatausscheidung eine Hyperphosphatämie auf. Diese trifft besonders für Patienten unter
Dialysetherapie zu. Die Folgen dieser Hyperphosphatämie sind Entwicklung eines sekundären
Hyperparathyreoidismus (sHTP) und eine renale Osteopathie. Eine phosphatreduzierte Diät kombiniert
mit oraler Gabe von calciumhaltigen Phosphatbindern (Calciumcarbonat, Calciumazetat) stellen eine etablierte
Behandlungsmaßnahme dar. Diese Maßnahme ist jedoch limitiert durch Überhöhung
der Serumcalciumwerte und der durch die bei Phosphat reduzierte Diät zwangsläufig eintretende
Verminderung der Eiweiß- und Kalorienzufuhr. Diese Therapie führt aufgrund der schwierigen
Steuerbarkeit immer wieder zu erhöhten Calcium-Phosphat-Produkten, welche nicht nur zur
Weichteilverkalkung, sondern auch zur Gefäßverkalkung im Sinne der prämaturen
Arteriosklerose führen. Solche Erkrankungen im Bereich des kardiovaskulären Systemes sind
für 50 % der Todesfälle unter Nierenersatztherapie (Dialyse, Nierentransplantation)
verantwortlich. Es ist daher sinnvoll, bei niereninsuffizienten Patienten eine medikamentöse Senkung
des Serumphosphates ohne gleichzeitige Calciumgaben zu erzielen.
Daher wurde eine multizentrische Studie initiiert, in der die Behandlung der Hyperphosphatämie bei
Kindern mit chronischer Niereninsuffizienz vermittels dem calciumfreien Phosphatbinder Sevelamer
(= Renagel®) im Vergleich zu einer Behandlung mit calciumhaltigem Phosphatbinder
(Calciumacetat) überprüft wurde. Die Studiendauer belief sich von 07/2001 bis 12/2002. In die
Studie eingeschlossen wurden 25 Patienten im Alter zwischen 0 und 18 Jahren mit chronischer
Niereninsuffizienz (GFR ³ 20 bis
< 60 ml/Minute/1,73m² KOF oder unter Dialysetherapie (HD, PD). Die Patienten
wurden rekrutiert aus 5 Zentren. Die Beobachtungszeit betrug 20 Wochen. Die multizentrische Studie wurde
nach entsprechender Aufklärung und Einwilligung offen, randomisiert im Crossoverdesign
durchgeführt. Geprüft wurde die Senkung des Serumphosphatspiegels nach 8 Wochen Therapie,
die Anzahl der Hypercalcämieepisoden, die Höhe des Calcium-Phosphat-Produktes, die
Beeinflussung des sHPT sowie der urämischen Dyslipidämie durch Sevelamer. Verabreicht wurde
Sevelamer in Tabletten à 400 mg, Calciumazetat wurde in Tabletten
à 500 mg verabreicht. Im Studienarm A wurde nach 2 Wochen "wash out" eine
Sevelamer-Behandlung über 8 Wochen durchgeführt, danach wurde nach 2 Wochen "wash out"
über 8 Wochen Calciumacetat verabreicht. Im Studienarm B wurde nach 2 Wochen "wash out"
über 8 Wochen Calciumazetat verabreicht, danach nach 2 Wochen "wash out" für 8 Wochen
Sevelamer verabreicht. Nach Abschluss der Studie werden nunmehr die Ergebnisse ausgewertet.
Drittmittelgeber: Beteiligte Wissenschaftler:
|
||||