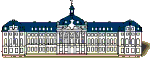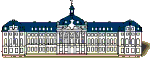|
Systemische Inflammation nach extrakorporaler Zirkulation und mesenteriale Oxygenierung
Hintergrund:
Die bislang vorliegenden Erkenntnisse über
den Darm als Schock- und Ischämieorgan, beruhen in erster Linie auf unterschiedlichen Tiermodellen
und nur auf vereinzelten klinischen Studien. Der Darm reagiert sehr vulnerabel sowohl auf eine
vorübergehende Minderperfusion als auch auf exogen zugeführtes Endotoxin. Beide
Mechanismen führen zu einem Anstieg der Darmpermeabilität, wodurch die Integrität der
Darmwand als Barriere zwischen gramnegativen Bakterien des Darmlumens und Blutkreislauf
eingeschränkt oder aufgehoben ist. Der Verlust dieser Barrierefunktion führt zu einer
Translokation von Bakterien und Toxinen in die Blutbahn. Dort werden die Mikroorganismen lysiert und als
Zellwandbestandteil gramnegativer Bakterien wird Endotoxin freigesetzt. Endotoxin selbst stimuliert wiederum
humorale und zelluläre Systeme, die inflammatorische Mediatoren synthetisieren. Die freigesetzten
endogenen inflammatorischen Mediatoren sind aber nicht selektiv gegen das Endotoxin gerichtet und
können zu einer systemischen Inflammation und einem Versagen unterschiedlicher Organsysteme
führen. Insbesondere kardiochirurgische Eingriffe mit extrakorporaler Zirkulation führen zu
einem Entzündungsprozess, der mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität
einhergehen kann. Ursachen der Inflammation nach extrakorporaler Zirkulation sind das chirurgische Trauma,
der Kontakt des Patientenblutes mit der Oberfläche des extrakorporalen Kreislaufs, ein Ischämie-
und Reperfusionschaden des Myokards und der Lunge während des Abklemmens der Aorta, sowie eine
periphere und mesenteriale Minderperfusion.
Ergebnisse:
Inzidenz, Expression und Verlauf von systemischer Inflammation und Akut-Phase-Reaktion nach
extrakorporaler Zirkulation
Bei herzchirurgischen
Eingriffen mit extrakorporaler Zirkulation tritt eine Endotoxinämie auf, die bis zu 6 Stunden
postoperativ ihre stärkste Ausprägung erreicht und sich danach wieder zurückbildet.
Parallel zum Anstieg der Endotoxinämie steigt die mesenteriale Sauerstoffextraktion an als Zeichen einer
mesenterialen Minderperfusion bzw. eines Missverhältnisses zwischen mesenterialem Sauerstoffangebot
und -verbrauch während und unmittelbar nach extrakorporaler Zirkulation . Ein weiteres Zeichen
dafür, dass die extrakorporale Zirkulation eine relevante mesenteriale Minderperfusion verursacht, ist die
enge positive Korrelation zwischen Endotoxinämie und Dauer der extrakorporalen Zirkulation. Der
Endotoxinämie folgt unmittelbar nach Ende der extrakorporalen Zirkulation die Freisetzung des
proinflammatorischen Zytokins IL-6, deren zeitlicher Verlauf hinsichtlich Ausprägung und
Rückbildung mit dem des Endotoxins übereinstimmt. Somit ist die Endotoxinämie
mitbeteiligt an der Entwicklung der systemischen Inflammation nach extrakorporaler Zirkulation. Es fanden
sich ferner Korrelationen zwischen IL-6 Konzentrationen und der Dauer der extrakorporalen Zirkulation.
Diese primäre Inflammation wurde bei allen Patienten beobachtet und war wiederum in allen
Fällen gefolgt von einem postoperativen Temperaturanstieg und einer Akut-Phase-Reaktion. Die
extrakorporale Zirkulation induziert demnach eine vorübergehende, aber vollständige
Entzündungsreaktion des menschlichen Organismus, die unter Berücksichtigung des
komplikationslosen weiteren Krankheitsverlaufes der untersuchten Patienten in der Regel ohne bleibende
Schäden verläuft.
Der Einfluss von Phosphodiesterase-III-Hemmern
und Dopexamin auf mesenteriale Oxygenierung, Endotoxinämie und systemische Inflammation nach
extrakorporaler Zirkulation
Die mesenteriale Minderperfusion während
extrakorporaler Zirkulation wird weder durch eine präoperativ beginnende, kontinuierliche Infusion von
Enoximon und Milrinon noch von Dopexamin entscheidend beeinflusst. Eine routinemäßig
durchgeführte Infusion von Phosphodiesterase-III-Hemmern und Dopexamin mit dem Ziel der
Verbesserung der mesenterialen Durchblutung aufgrund der vasodilatatorischen Eigenschaften der Substanzen
kann demnach bei sonst gesunden herzchirurgischen Patienten nicht empfohlen werden. Diese
Schlussfolgerung schließt aber nicht aus, dass die drei Substanzen aufgrund der allgemeinen
Verbesserung von Hämodynamik und systemischer Oxygenierung den weiteren Krankheitsverlauf von
Hochrisikopatienten, die sich einem herzchirurgischen Eingriff mit extrakorporaler Zirkulation unterziehen
müssen, positiv beeinflussen können. Die primäre
Inflammation nach extrakorporaler Zirkulation, repräsentiert durch den Anstieg des
proinflammatorischen Zytokins IL-6, wird insofern durch die Infusion von Milrinon, Enoximon und
Dopexamin beeinflusst, als jede der drei Substanzen eine signifikante Suppression und ein früheres
Wiederabsinken der IL-6-Konzentrationen nach extrakorporaler Zirkulation verursacht. Diese Beobachtung ist
weniger auf die vasodilatatorischen Eigenschaften der Substanzen mit nachfolgender Verbesserung der
mesenterialen Durchblutung und Verminderung der Endotoxinämie zurückzuführen, als auf
die Tatsache, dass sowohl Phosphodiesterase-Hemmer als auch Agonisten von b2-Rezeptoren und dopaminergen Rezeptoren vom Typ 1 einen
intrazellulären Anstieg von c-AMP immunkompetenter Zellen zur Folge haben, der zu einer
verminderten Synthese proinflammatorischer Zytokine führt. Zwar lässt sich anhand der
gefundenen Ergebnisse eine Mitbeteiligung der tendenziell verminderten Endotoxinkonzentrationen an der
IL-6-Suppression nicht ausschließen, aber die tierexperimentell vorbeschriebene direkte Beeinflussung
der intrazellulären c-AMP-Konzentrationen ist wahrscheinlicher. Die verminderten
IL-6-Konzentrationen führten nach Infusion von Dopexamin zu einer Abschwächung der
nachfolgenden Akut-Phase-Reaktion. Eine Beeinflussung der Akut-Phase-Reaktion durch die Gabe von
Milrinon oder Enoximon zeigt sich lediglich tendenziell angedeutet durch leicht erniedrigte Konzentrationen
des Akut-Phase-Proteins Serum-Amyloid A.
Beteiligte Wissenschaftler:
|