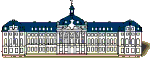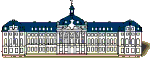|
Dermatoimmunologie und Tumorimmunologie
Biologie der Antigenpräsentation
Biologie der epidermalen Langerhanszellen
Zudem
wurden transgene Mausstämme hergestellt, in denen die Funktion epidermaler
Langerhanszellen gezielt
beeinflusst wurde, indem unter Kontrolle des hautspezifischen K14-Promoters oder des
DC-spezifischen
CD11c-Promoters Moleküle der TNF/TNF-R Genfamilie transgen überexprimiert
wurden. Durch
Überexpression des Langerhanszell-aktivierenden Faktors CD40L in der Epidermis
konnte
nachgewiesen werden, dass eine chronische Überaktivierung von Langerhanszellen nicht
nur zu einer
lokalen Entzündungsreaktion, sondern zu systemischer Autoimmunität
führt. Weitere
transgene Mausmodelle, die bei uns konstruiert wurden, exprimieren die Zytokine IL-10 oder
Il-15, bzw. die
Moleküle RANKL oder TRAIL unter der Kontrolle des K14 Promoters. Der
Phänotyp dieser
Tiere wird z.Zt. analysiert.
Biologie der dendritischen Zellen
Pathophysiologie des allergischen Kontaktekzems
Relevanz von Antigenpräsentierenden Zellen für
tumorspezifische
Immunantworten
Photokarzinogenese
Klinische Forschung
Beteiligter Wissenschaftler:
|