Der Greif als Parasemon von Assos
Zusammenfassung: Möchte man das Parasemon
von Assos bestimmen, dann fällt der erste Blick auf die
Münzprägung der Stadt. Die Silber- und Bronzeprägungen bieten im
Zeitraum von der ausgehenden Archaik bis in die römische
Kaiserzeit eine breite Basis von Darstellungen, mit denen sich
die Stadt präsentierte. Bei der Durchsicht der Münztypen
begegnet dem Betrachter häufig der Greif. Gleichwohl erscheinen
auch andere Motive, die teils den Greifen ersetzen und teils mit
ihm kombiniert werden. Um das Parasemon von Assos bestimmen zu
können, untersucht diese Arbeit die Entwicklung der Münzbilder
im Verlauf der Geschichte der Polis. In einem nächsten Schritt
werden die Ergebnisse mit den reliefverzierten Marktgewichten
der Stadt verglichen, die als weitere instrumenta publica
Rückschlüsse auf das offizielle Symbol von Assos erlauben. Die
acht bekannten Marktgewichte liegen in dieser Arbeit erstmals
gesammelt vor. Da Parasema auch immer identitätsfördernde
Merkmale besitzen, widmet sich der letzte Teil dieser Arbeit der
Frage nach der Bedeutung des Greifen für die Stadt.
Schlagwörter: Assos (https://d-nb.info/gnd/4003268-1),
Troas (https://d-nb.info/gnd/4330485-0),
Parasema, Münzen (https://d-nb.info/gnd/4040629-5),
Marktgewichte (https://d-nb.info/gnd/4234189-9),
Greif (https://d-nb.info/gnd/4158130-1),
Athena (https://d-nb.info/gnd/118504851)
Abstract:
If you want to identify the
parasemon of Assos, the first thing you look at is the city’s
coinage. The silver and bronze coins from the late Archaic to
the Roman imperial period offer a broad basis of depictions with
which the city represented itself. When examining the coin
types, the observer frequently encounters the griffin. However,
other motifs also appear, some of which replace the griffin and
some of which are combined with it. In order to determine the
parasemon of Assos, this work analyses the development of the
coin images in the course of the history of the polis. In a next
step, the results are compared with the relief-decorated market
weights of the city, which, as further instrumenta publica,
allow conclusions to be drawn about the official symbol of
Assos. The eight known market weights are collected in this work
for the first time. Since parasema always have
identity-promoting characteristics, the last part of this work
is devoted to the question of the meaning of the griffin for the
city.
Key words:
Assos, Troad, Parasema, Coins, Market weights, Griffin, Athena
1. Einleitung
Die Ruinen des antiken Assos finden
sich heute auf einem aus Andesit geformten Vulkankegel, der sich
am Ufer der südlichen Troas bis in eine Höhe von 234 m erhebt.
Gut erkennbar sind bereits aus der Ferne die Türme der
byzantinischen Befestigungsmauer und die teilweise
wiedererrichteten dorischen Säulen des Athenatempels auf der
Akropolis[1].
An dieser Stelle, die bereits in der
Bronzezeit besiedelt war, gründeten im 7. Jh. v. Chr.
griechische Siedler aus Methymna eine Kolonie. Als Hafen für die
Umschiffung des Kaps Lekton und als Verkehrsknotenpunkt für Wege
ins Landesinnere kam der Stadt eine wichtige Funktion zu[2].
Die Geschichte der Polis ist geprägt von einem Wechsel zwischen
Autonomie und der Fremdherrschaft durch Lyder, Perser, Athener,
hellenistischer Herrscher und Römer[3].
Wenngleich die Stadt mit der Zeit ihre Bedeutung verlor, so
blieb der Ort über die byzantinische und osmanische Zeit hinweg
bis heute besiedelt[4].
In den Jahren von 1881 bis 1883
führten Francis Henry Bacon und Joseph Thacher vom
Archaeological Institute of America mit Unterstützung von Robert
Koldewey erste umfangreiche Ausgrabungen in Assos durch[5].
In deren Folge kamen insgesamt 408 Fundmünzen in die USA, von
denen H. W. Bell im Jahr 1921 265 Exemplare katalogisierte
(davon 128 assische Münzen)[6].
Nach einer langen Unterbrechung fanden ab 1981 wieder Grabungen
unter der Leitung von Ümit Serdaroğlu statt. Unterstützt wurde
er von 1989 bis 1994 durch Reinhard Stupperich von der
Universität Mannheim[7].
Leider mangelt es an einer umfangreichen Untersuchung der
Münzfunde aus diesen Jahren[8].
2006 übernahm Nurettin Arslan von der
Çanakkale Onsekiz Mart Universität die Leitung der Ausgrabungen
in Assos[9].
Die Erforschung der byzantinischen Stadtgeschichte findet seit
2007 unter der Führung von Beate Böhlendorf-Arslan
(Philipps-Universität Marburg)[10]
statt. Seit 2022 ist das Münzkabinett Berlin unter der Leitung
von Bernhard Weisser im Rahmen eines Fundmünzenprojekts in Assos
tätig[11].
Zwar gab es in jüngerer Zeit mit den
wichtigen Arbeiten von Dinçer Savaş Lenger[12]
und Lorenzo Lazzarini[13]
eine eingehende Auseinandersetzung mit der assischen
Münzprägung. Das Münzbild des Greifen wurde in diesem Zuge
jedoch noch nicht tiefergehend untersucht. Dabei nahm der Greif
unter den verschiedenen Münzbildern, die Assos prägte, eine
herausragende Stellung ein. Mit wenigen temporären
Unterbrechungen wurde er vom Beginn der assischen Münzprägung an
bis in die römischen Kaiserzeit geprägt[14].
Daher drängt sich durch die lange Verwendungsdauer des Bildes
die Frage auf, ob der Greif als Parasemon von Assos gelten kann.
Parasema sind offizielle Stadtzeichen
griechischer Poleis. Verbunden mit der Einführung des Geldwesens
waren Münzbilder ein notwendiges staatliches Garantiezeichen für
Echtheit, Wert und Herkunft der Objekte[15].
Als Bild mit offiziellem Charakter erscheinen sie neben Münzen
auch auf weiteren instrumenta publica,
so auf Marktgewichten, Losplaketten, Urkundenreliefs etc.[16].
Für die eindeutige Bestimmung des Parasemons einer Stadt müssen
daher Bilder als Repräsentationszeichen auf mehreren
Materialgattungen zu finden sein[17].
Dies müsste im Fall eines Parasemons folglich auch für den
Greifen von Assos gelten[18].
Da Assos den Greifen jedoch zeitweise
durch andere Münzbilder ersetzte, stellt sich die Frage, ob sich
diese anderen Bilder auch auf instrumenta
publica finden lassen. Hiermit wäre der Greif
nicht das einzige Parasemon der Polis. Dieser Frage wird mit der
Untersuchung von Alexander-Tetradrachmen und weiteren nun neu
vorliegenden Marktgewichten nachgegangen[19].
Zuletzt lagen den Parasema immer auch identitätsfördernde
Merkmale zugrunde, die sie mit einem bestimmten Ort verbanden[20].
Parasema bezogen sich auf Eigenheiten eines Gemeinwesens, wie
etwa den Namen einer Polis, auf lokale Wirtschaftsformen und
Kulte oder mythologische Ursprünge[21].
Dementsprechend ist zu untersuchen, inwiefern der Greif eine
solche identitätsfördernde Funktion für Assos besaß[22].
2. Der Greif in der Münzprägung
von Assos[23]

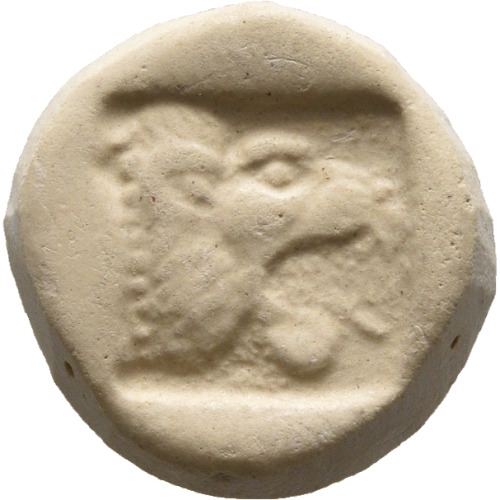
Av. Greif liegt nach l. mit erhobener r. Pfote und geschwungenen Flügeln, ein rundes Horn auf dem Kopf / Rv. Löwenkopf nach r.
British Museum 1844,1015.315; Corpus Nummorum Type 12238, Gipsabdruck (BBAW), https://www.corpus-nummorum.eu/coins/39225


Abb. 2: Obol (ca. 500–480 v.
Chr.) AR, 7 mm, 0,58 g, 8 h
Av.
Greifenkopf nach r. / Rv.
Löwenkopf nach r.
Classical
Numismatic Group, LLC 2012, Auction 90, Lot 273,
https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=207851
Für Assos begann nach der Eroberung
des Lyderreichs durch Kyros II. 548 v. Chr. und der
Eingliederung in die persische Satrapie Phrygien eine
prosperierende Phase. Dies belegt der zwischen 540 und 530 v.
Chr. erfolgte Bau des Athenatempels auf der Akropolis[24].
Die Münzprägung begann mit der Wende vom 6. zum 5. Jh. v.
Chr. Bereits die ersten Münzen, etwa Drachmen, die ca. 500–480
v. Chr. emittiert wurden[25],
zeigen einen Greifen auf der Vorderseite (Abb. 1). Er
liegt nach links und besitzt einen hochgestreckten Kopf und
Schwanz. Die Flügel sind geschwungen und die linke Pfote ist
erhoben. Seine Gestaltung in der Archaik erinnert noch stark an
vorderasiatische Vorbilder: Das Maul ist weit aufgerissen, die
Zunge lang und gekrümmt und die Augen sind kreisrund. Auf dem
Kopf trägt er ein kugelförmiges Horn[26].
Auf der Rückseite der Drachmen befindet sich ein Löwenkopf mit
geöffnetem Maul in einem quadratum incusum.
Das Nominalsystem wurde mit den
500–480 v. Chr. geprägten Hemidrachmen und Obolen zügig
erweitert. Diese Münzen zeigen ebenfalls Greifen und Löwen,
deren Blickrichtung variiert. Auffällig ist, dass der Greif auf
dem Obol lediglich als Protome mit geöffnetem Maul dargestellt
wird (Abb. 2)[27].
Möglicherweise diente das zur Unterscheidung der Nominale.


Abb. 3: Obol (ca. 479–440 v. Chr.)
AR, 9 mm, 0,60 g, 1 h
Av. Greif liegt
nach r. mit erhobener l. Pfote und geraden Flügeln / Rv.
AΣΣ (retrograd).
Löwenkopf nach r.
Münzkabinett Berlin,
Objektnummer 18271557 (B. Weisser)


Abb. 4: Obol (ca. 440–430 v. Chr.)
AR, 9 mm, 0,48 g, 11 h
Av. Greif liegt
nach l. mit erhobener r. Pfote und geraden Flügeln / Rv.
A-Σ. Löwenkopf nach
l.
Münzkabinett Berlin,
Objektnummer 18271559 (B. Weisser)
Nach dem Ende der Perserkriege und
der Schlacht am Fuße der Mykale 479 v. Chr. stand Assos nicht
mehr unter persischer Herrschaft[28].
Der einzelne Greifenkopf verschwand auf den zwischen 479 und 440
v. Chr. geprägten Obolen und wurde durch ein ganzfiguriges
Abbild ersetzt (Abb. 3)[29].
Der Greif nimmt nun im Vergleich zu den vorangegangenen
Münzserien in seiner Form eine deutlich schlankere, natürlichere
Gestalt an. Mit dem Aufkommen des assischen Ethnikons in den
Varianten ΑΣΣ,
ΑΣΣΟΟΝ und
ΑΣΣΙΟΝ[30]
verändert sich zudem die Flügelform des Greifen. Die Flügel
besitzen einen Knick und verlaufen gerade nach hinten. Die
Blickrichtung von Löwen und Greifen richtet sich nun stets nach
rechts. Das Maul ist nicht mehr unnatürlich weit aufgerissen.
Das Horn auf dem Kopf existiert nicht mehr.
Mit der Serie von 440–430 v. Chr.
änderte sich die Darstellungsweise wiederum (Abb. 4)[31].
Der Körper des Greifen ist kompakter ausgestaltet. Schwanz und
Kopf bleiben erhoben und die Flügel am Körper gerade
zurückgeführt. Er befindet sich nun auf einer Standlinie
gelagert. Der Löwenkopf ist nun von einem verkürzten Ethnikon A-Σ
im rechten und linken Feld umgeben.
Bereits seit 477 v. Chr. war Assos
Mitglied im Attisch-Delischen Seebund[32].
Die Tributlisten erwähnen die Polis mit einem Beitrag in Höhe
von einem Talent[33].
Dies nimmt Lazzarini als Erklärung für den jetzt verwendeten
Athenakopf, der auf den Vorderseiten der Münzen erscheint, die
430–420 v. Chr. geprägt wurden (Abb. 5). Er verweist aber
auch auf die Möglichkeit eines Bezugs zum Athenakult in Assos[34].
Lenger sieht in der Darstellung hingegen einen klaren Bezug zum
assischen Athenakult und nicht zu Athen[35].
Während der Greif auf den Drachmen ersetzt wird durch den nach
links gerichteten Athenakopf mit einem bekränzten attischen
Helm, bleiben der nach links blickende Löwenkopf auf der
Rückseite und das Ethnikon erhalten.


Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach l. geschmückt mit Lorbeerkranz / Rv. AΣΣ-O-O-N. Löwenkopf nach l.
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271558 (B. Weisser)


Av. Kopf der Athena nach l., auf dem Helm ein Greif / Rv. AΣΣION. Palladion nach r. auf Sockel, in der r. Hand ein Speer und in der l. Hand eine Wollbinde und Spindel?
Bibliothèque Nationale de France, Département des Monnaies, Médailles et Antiques Paris, Inv-Nr. 41768756; Corpus Nummorum Type 12361, Gipsabdruck (BBAW), https://www.corpus-nummorum.eu/coins/24159
Eine einzige assische Tetradrachme
ist aus dem Zeitraum 410–400 v. Chr. in Paris erhalten (Abb.
6)[36].
Der nach links blickende Athenakopf trägt einen Greifen auf
ihrem attischen Helm. Die Rückseite zeigt ein Palladion mit
einem Speer in der rechten und einer Wollbinde in der linken
Hand. Hierbei ist umstritten, ob sich zudem eine Spindel in der
linken Hand befindet. Dies würde es erlauben, das Kultbild der
in der Troas bekannten Athena Ilias zu identifizieren[37].
Im linken Feld findet sich das Ethnikon AΣΣION.
Eine kurzzeitige Obol-Serie (Abb. 7), die Lazzarini mit
einem möglichen lokalen Nymphenkult in Verbindung setzt, wurde
430–410 v. Chr. geprägt. Auf dem Avers befindet sich ein
Frauenkopf nach links mit einer Tänie im Haar und auf dem Revers
ein Greifenkopf nach links. Manche der Exemplare besitzen ein
Ethnikon: A, A-Ͳ-O oder AΣΣOON.
Andere wurden ohne Ethnikon geprägt[38].
Ab 415/410 v. Chr. prägte Assos erstmals Bronzemünzen (Abb. 8)[39].
Die Chalkoi greifen erneut die Motive der früheren Silberserien
auf und zeigen einen liegenden Greifen auf den Vorder- und einen
Löwenkopf ohne Ethnikon auf den Rückseiten.


Av. Weiblicher Kopf nach l. mit Taenie im Haar / Rv. A-Ͳ-O. Greifenkopf nach r.
Leu Numismatik AG 2020, Webauktion 11, Los 836


Av. Greif liegt nach r. mit erhobener l. Pfote / Rv. Löwenkopf nach r.
Assos-Grabung ID94 (B. Weisser)


Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach l. geschmückt mit Lorbeerkranz / Rv. AΣ-ΣI-ON. Bukephalion. Im linken Feld eine Weintraube
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271560 (B. Weisser)
Die wiedererlangte Autonomie nach der
Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg bestand nur für
kurze Zeit. Im Frieden von Antalkidas geriet Assos 387 v. Chr.
erneut unter persische Herrschaft[40].
In diese Phase politischer Veränderungen fällt ein neues
Münzbild (Abb. 9). Auf der Vorderseite ist ein Athenakopf
zu sehen. Auf der Rückseite ersetzt jetzt ein frontaler
Rinderkopf (Bukephalion) den Greifen. Neben dem Ethnikon AΣ-ΣI
oder AΣ-ΣI-ON
erscheint über oder neben dem Bukephalion eine Vielzahl
verschiedener Beizeichen[41].
Es wurden sowohl Silber- als auch Bronzemünzen in den Nominalen
Drachme, Hemidrachme und Chalkous geprägt. Die genaue Datierung
ist strittig. In der Literatur schwanken die Angaben zwischen
400–241 v. Chr.[42]
und 387–300 v. Chr.[43].
Lazzarini schlägt aufgrund des neuen Wohlstands unter der
persischen Herrschaft und des finanzaufwändigen Baus der
Stadtmauer einen Zeitraum von 380–340 v. Chr. vor[44].
Lenger hingegen datiert die Bronzeserie auf 410–390 v. Chr. mit
einem Verweis auf archäologische Grabkontexte[45].
Unabhängig von dieser Diskussion zeigen Münzen, die zwischen 380 und 310 v. Chr. im Umlauf waren, eine Rückkehr zum Motiv des Greifen. Er befindet sich erneut auf einer Standlinie liegend. Eine Pfote sowie Kopf und Schwanz sind erhoben. Die Flügel sind über dem Rücken geknickt und dann gerade zurückgeführt. Im Abschnitt finden sich verschiedene Beizeichen (Abb. 10). Vom langen Umlauf der Münzen zeugen häufige Gegenstempel mit einem Greifen in der gleichen Darstellungsweise und dem Ethnikon AΣΣI sowie Gegenstempel mit einer Eule (Abb. 11)[46].


Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach r. geschmückt mit Lorbeerkranz / Rv. AΣΣI. Greif liegt nach l. mit erhobener r. Pfote und geraden Flügeln
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271605 (B. Weisser)



Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach r. geschmückt mit Lorbeerkranz. Av. gedreht: Gegenstempel mit liegendem Greif nach l. und ΑΣΣΙ / Rv. AΣΣI. Greif liegt nach l. Gegenstempel mit Eule nach r.
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271623 (B. Weisser)
Politisch fällt in diesen Zeitraum
der Satrapenaufstand des Ariobarzanes gegen den persischen
Großkönig Artaxerxes II. Der Satrap verschanzte sich 366 v. Chr.
erfolgreich in Assos[47].
Hiernach übertrug er seinem Unterstützer, dem Bankier Eubulos,
die Herrschaft über die Stadt. Unter ihm und seinem Nachfolger
Hermias besaß die Stadt relative Autonomie und erlangte
Wohlstand. Mit der Gründung einer Philosophenschule, deren
Mitglieder Aristoteles und Theophrast waren, kam es zur
kulturellen Blüte[48].
345 v. Chr. wurde Hermias jedoch von den Persern gefangen
genommen und getötet. Die folgende persische Herrschaft war nur
von kurzer Dauer. Schon 334 v. Chr. wurde Assos eine freie
Stadt, nachdem Alexander der Große die Perser in der Schlacht am
Granicus geschlagen hatte[49].
In der Folge nahm Assos die Funktion eines zentralen Ortes innerhalb eines Koinons mit Polymedion und vermutlich Lamponeia ein, welche später ein fester Bestandteil des assischen Territoriums wurden[50]. Damit in Verbindung setzen lässt sich die Prägung von Bronze- und Silbermünzen zwischen 310 und 280 v. Chr. für das Koinon der Aeolis. Sie sind durch die Aufschrift AIOΛΕ gekennzeichnet (Abb. 12)[51]. Ging man ehemals davon aus, dass die Münzen von einer unbekannten Polis in der Troas mit dem Namen Aioleion stammten, so konnte Lenger zeigen, dass die Münzen in Assos geschlagen wurden[52].


Av. Weiblicher Kopf nach r. mit Stephane, Ohrringen und Halskette / Rv. AIOΛE. Geflügeltes Blitzbündel. Im Abschnitt eine Weintraube
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18281750 (B. Weisser)
Als Koinonprägung
unterscheiden sich die Münzbilder vom vormaligen Bildrepertoire
in Assos: Auf der Vorderseite der Bronzemünzen ist ein
weiblicher Kopf mit Stephane nach rechts zu sehen. Im Zentrum
der Rückseite befindet sich ein geflügeltes Blitzbündel. Darüber
steht das Ethnikon AIOΛE und im Abschnitt ein Monogramm oder
Beizeichen. Die entsprechenden Silbermünzen zeigen einen
Athenakopf nach rechts mit einem korinthischen Helm[53].
In die Zeit der Antigonidenherrschaft über die Troas fällt zudem
die erstmalige Erwähnung des Koinons der Athena Ilias, dessen
Mitglied Assos war. Das Koinon bestand bis ins 2. Jh. n. Chr.
fort[54].


Av. Kopf der Athena mit Helm in Dreiviertelansicht nach l. / Rv. AΣΣI. Greif steht nach l. mit erhobener r. Pfote und leicht geschwungenen Flügeln. Unter dem Greifen ein Athenakopf nach l.
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271654 (B. Weisser)



Dreiviertelansicht nach l. Gegenstempel mit Eule / Rv. AΣΣI. Greif steht nach l. mit erhobener r. Pfote und leicht geschwungenen Flügeln. Unter dem Greifen ein Athenakopf nach l.
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271656 (B. Weisser)
Die letzte städtische Bronzeserie in
vorrömischer Zeit wurde 281–241 v. Chr. geprägt (Abb. 13).
Die Darstellungsweise ändert sich nun stark. Der Kopf der Athena
mit Helm wird auf der Vorderseite in Dreiviertelansicht nach
links oder rechts gezeigt. Der Greif auf der Rückseite befindet
sich nicht mehr in liegender Position, sondern steht nach links.
Darüber findet sich das Ethnikon AΣΣI.
Die rechte Pfote bleibt erhoben. Viele der Exemplare besitzen
einen oder mehrere Gegenstempel mit Eulen, Greifen, Leiern und
Athenakopf (Abb. 14). Dies zeigt, dass die Münzen lange
im Umlauf blieben[55].



Av. Kopf des Herakles mit Löwenfell nach r. / Rv. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Zeus Aetophoros sitzt auf einem Thron nach l., in der l. Hand ein Zepter, in der r. Hand ein Adler. Im linken Feld ein Bukephalion, darunter einen liegender Greif nach l. (Detail). Im Abschnitt der Beamtenname MOPMΩTTOY
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18252258 (L.-J. Lübcke [Lübke & Wiedemann])
Hiernach geriet Assos in den
Machtbereich des Attalidenreichs. Dieses Ereignis wird mit dem
vorläufigen Ende der städtischen Bronzeprägungen nach 241 v.
Chr. in Verbindung gebracht[56].
In diese Zeit fällt die Prägung von assischen
Alexander-Tetradrachmen (Abb. 15)[57].
Dies ist bemerkenswert, da Assos sonst keine weiteren Münzen
mehr prägte. Wahrscheinlich wurden die Tetradrachmen auf
Veranlassung des Attaliden Eumenes II. in den späten 170er oder
frühen 160er Jahre v. Chr. geprägt und sollten Feldzüge
finanzieren[58].
Die Münzen zeigen auf der Vorderseite den Kopf des Herakles und
auf der Rückseite den nach links sitzenden Zeus mit Adler und
Zepter. Der Prägeort solcher Alexander-Tetradrachmen wurde
normalerweise mittels eines Beizeichens und teilweise durch
Ethnika angezeigt[59].
Auf den Assos zugewiesenen Stücken fehlt solch ein Ethnikon. Zu
sehen ist jedoch stets ein nach links liegender Greif im linken
Feld, der stilistisch den liegenden Greifen der bisherigen
Münzbilder von Assos gleicht. Die Münzen tragen zudem Monogramme
und in einem Fall den indigenen Namen des Münzbeamten Mormottos[60].
Als wichtiger Hafen, der vor der
Umfahrung des Kaps Lekton angesteuert werden musste, und als
wichtige Wegkreuzung ins Landesinnere blieb Assos auch in
römischer Zeit bis hinein in die Spätantike bedeutungsvoll[61].
So soll der Apostel Paulus durch Assos gekommen sein als er den
Hafen nutzte, von dem seine Gefährten ihn mit einem Boot nach
Mytilene brachten[62].
Insbesondere in der frühen Kaiserzeit prosperierte die Stadt[63]. Vom Wohlstand in dieser Zeit zeugen zahlreiche römische Grabbauten[64]. Viele Römer sind in Assos namentlich durch Inschriften auf Gräbern, Monumenten und in Widmungen belegt[65]. Die Inschrift einer Ehrenstatue des Germanicus und seiner Frau Agrippina, welche anlässlich deren Besuchs im Jahr 18 n. Chr. errichtet wurde, und eine Bronzetafel, die 37 n. Chr. zu Ehren des Caligula geschaffen wurde, um die Loyalität der Stadt Assos zum römischen Kaiserhaus zu bekunden, wurden in der Nähe des Bouleuterion gefunden. Sie zeigen das Bemühen der Stadt zur Wahrung eines guten Verhältnisses zu den römischen Kaisern und damit des eigenen Status[66]. So konnte Assos weiter prosperieren und prägte von Augustus bis in die severische Zeit erneut Münzen[67]:


Av. ΣΕΒΑΣ-ΤΟ-Σ. Kopf des Augustus nach r. / Rv. ΑΣΣΙ. Greif liegt nach r. mit erhobener l. Pfote und geschwungenen Flügeln
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271661 (B. Weisser)


Av. ϹΑΒΙΝΑ – CEΒΑ. Drapierte Büste der Sabina nach r. / Rv. ΑϹϹΙꞶΝ. Demeter steht nach r. In ihrer vorgestreckten l. Hand hält sie einen Korb mit Ähren
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271674 (B. Weisser)


Av. [ΑV ΚΑΙ] – ΚΟΜΟΔΟ. Drapierte Panzerbüste des Commodus nach r. / Rv. ΑϹϹ-ΙΩΝ. Telesphoros in der Vorderansicht
Assos-Grabung ID 90 (B. Weisser), https://assos.ikmk.net/object?id=ID90


Av. ΑV Κ Μ ΑV ΑΝΤΩΝEΙ. Panzerbüste des Kaisers Marcus Aurelius mit Lorbeerkranz nach r. / Rv. AC-CI-ΩN. Greif liegt nach l. mit erhobener r. Pfote und geschwungenen Flügeln, im Abschnitt ein geflügeltes Blitzbündel
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271675 (B. Weisser)
Die neuen Münzen zeigten fortan auf der Vorderseite
das Kaiser- oder Kaiserinnenporträt. Auf der Rückseite kehrte
man bereits zu Zeiten des Augustus zu dem älteren Greifenmotiv
zurück, bei dem das Fabelwesen wieder in liegender Position mit
erhobener Pfote, erhobenem Kopf und Schwanz und geschwungenen
Flügeln dargestellt wird (Abb. 16).
Dies zeigt, dass das Bild des Greifen und seine
Darstellungsweise trotz einer längeren Unterbrechung der
Münzprägung in Assos nicht in Vergessenheit geriet. Auffällig
ist im Vergleich zu den älteren assischen Greifendarstellungen
aber, dass die Körperform des Fabelwesens anders ausgestaltet
ist. Der Rumpf ist länger, der Hals überproportional dick und
die Beine, die Flügel und der Kopf weniger detailliert
ausgeformt[68].
Hiernach entstand auf den Rückseiten ein reichhaltiges neues
Bildrepertoire mit neuen Bildthemen. Dazu zählen etwa zahlreiche
Götterdarstellungen, wie die der Demeter in der Regierungszeit
des Kaisers Hadrian (Abb. 17)[69]
oder Telesphoros in der Zeit des Commodus (Abb.
18)[70],
um nur einige Bespiele zu nennen. Der Greif wurde letztmalig
unter Marcus Aurelius geprägt (Abb. 19)[71].
Zusammenfassend zeigt sich, dass das
Hauptmotiv auf den Münzen von Assos nur geringen Schwankungen
unterlag. Der Greif war bereits zu Beginn der Münzprägung
präsent und wurde bis in die römische Kaiserzeit tradiert. In
wenigen temporären Münzserien taucht er nicht auf: Als weitere
Münzbilder sind insbesondere das Bukephalion, der Löwenkopf und
der ab dem Ende des 5. Jh. v. Chr. gängige Athenakopf
hervorzuheben. Der Greif selbst bildet trotz kleinerer
Abweichungen in der Darstellungsform und des Stils über die Zeit
eine feste Darstellungsweise heraus: Er liegt, hat eine Pfote
erhoben und Kopf und Schwanz ragen auf. Spätestens mit dem Ende
des 5. Jh. v. Chr. sind die Flügel meist geknickt, gerade am
Körper zurückgeführt oder leicht nach oben geschwungen. Der
Greif befindet sich jetzt zudem auf einer Standlinie[72].
3. Bestimmung des Parasemons
Im Folgenden werden die
Alexander-Tetradrachmen aus der Attalidenzeit besprochen. Als
Träger von Beizeichen der prägenden Münzstätten können sie bei
der Identifizierung von Parasema helfen. Weiterhin sind acht
assische Marktgewichte bekannt, von denen fünf nachweislich aus
den Ausgrabungen von Assos stammen. Sie werden im Anschluss
untersucht. Als weitere Materialgattung nehmen sie eine zentrale
Rolle für die Bestimmung des Parasemons von Assos ein[73].
3.1 Alexander-Tetradrachmen aus
Assos
Die Alexander-Tetradrachmen, die
reichsweit in verschiedenen Münzstätten geprägt wurden,
unterscheiden sich im Wesentlichen durch die angebrachten
Legenden und Beizeichen voneinander. Sie weisen auf die
ausgebende Münzstätte hin. Beizeichen waren häufig die Parasema
der ausprägenden Städte. Sie dienten zunächst als
Münzstättenkennzeichen und leisten somit heute einen wichtigen
Beitrag für die Identifizierung von Parasema[74].
Da Price und Ellis-Evans im Fall von Assos ihre Zuweisung zu der
Stadt zu einem großen Teil auf eben jene Beizeichen stützen, ist
die Untersuchung zur Beantwortung der Frage nach dem Parasemon
von Assos lohnenswert. Problematisch ist, dass die Tetradrachmen
kein Ethnikon besitzen. Es soll der Zirkelschluss vermieden
werden, dass die Münzen aufgrund des Beizeichens wohlmöglich
falsch zugewiesen werden und darauf basierend wiederum der Greif
als Parasemon von Assos gewertet wird. Deshalb ist es in einem
ersten Schritt notwendig, die Gründe für die Zuweisung der
Münzen nach Assos zu rekapitulieren:
Price führte 1991 zunächst zwölf
Exemplare an (Price
Nr. 1599–1610), die er aufgrund der
Darstellungsweise des Greifen Assos zuordnet. Hierbei ist es
wichtig zu berücksichtigen, dass auch das in Ionien liegende
Phokaia Alexander-Tetradrachmen ohne Ethnikon und mit einem
Greifen als Beizeichen prägte[75].
Price beschreibt die Greifen von Assos als auf einer Standlinie
lagernd. Ihre Flügel sind gerade und besitzen definierte Federn.
Damit gleichen sie den Greifen auf den vorangegangenen
Stadtprägungen[76].
Greifen auf den Alexander-Tetradrachmen, die Phokaia zugewiesen
werden, besitzen hingegen stark gebogene Flügelfedern, was zu
den Darstellungen von Greifen auf den Stadtprägungen von Phokaia
passt[77].
Ellis-Evans sieht in der reinen
Betrachtung der Gestaltung allerdings auch Schwierigkeiten bei
der Zuweisung. Die Greifendarstellungen von Phokaia und Assos
sind in Teilen ähnlich. Dies liegt zum einen sicherlich daran,
dass sich bestimmte Elemente aufgrund des kleinen Formats und
desselben Bildinhalts zwangsläufig überschneiden. Zum anderen
sahen die Städte durch ihre große Entfernung womöglich nicht die
Notwendigkeit, auf eine starke optische Differenzierung zu
achten[78].
Zur Überprüfung von Prices Ergebnissen führte Ellis-Evans
deshalb eine Stempelstudie durch. So ließ sich der
Price
Nr. 1599 aufgrund einer Stempelkopplung mit dem
Price Nr. 2223 verbinden und damit
Phokaia zuordnen, trotz seiner Ähnlichkeit zu den
Assos-Prägungen[79].
Mit dem Ausscheiden des Exemplars änderte sich zunächst die
Datierung des Prägezeitraums[80].
Auch die Price-Typen Nr. 1600–1604 sind nach Ellis-Evans nur
unsicher Assos zuzuordnen. Die darauf befindlichen Monogramme
zeigen keine Verbindungen zu solchen der vorherigen
Stadtprägungen und auch nicht zu den weiteren assischen Price
Nr. 1605–1610. Mögliche Verbindungen gibt es hingegen zu
ähnlichen Monogrammen auf Exemplaren aus Phokaia[81].
Die Price-Typen Nr. 1605–1610
erlauben hingegen eine sichere Zuordnung nach Assos. So zeigt
der
Price Nr. 1610 neben dem gelagerten
Greifen mit geraden Flügeln und detaillierten Federn auch ein
Bukephalion, das ebenfalls auf den Münzen der Lenger-Serie 2
bzw. Lazzarini-Serie 9 aus Assos Verwendung fand. Weiterhin
findet mit MOPMΩTTOY die
Nennung eines Magistraten statt[82].
Der Name Mormottos (Price
Nr. 1610) ist zudem ein typisch einheimischer
Name, der nur in der Region der Troas belegt ist. Er findet sich
auf einer hellenistischen Grabinschrift aus Assos[83].
Nach Ellis-Evans gibt es demnach nur
eine einzige Serie Alexander-Tetradrachmen, die in Assos geprägt
wurde. Da alle diese Münzen den gelagerten Greifen im Stil der
städtischen Prägungen von Assos tragen, ist eine Verwendung des
Beizeichens als offizielles Symbol von Assos naheliegend. Das
genannte Bukephalion, welches Ellis-Evans ebenfalls als
Stadtzeichen von Assos vorschlägt[84]
taucht nur auf
Price
Nr. 1610 neben dem Greifen auf. Alle übrigen
assischen Alexander-Tetradrachmen tragen hingegen keinen
Rinderkopf, dafür aber andere Symbole, wie z. B. ein Blitzbündel[85].
Der Greif ist das markante Bild auf allen Stücken, durch den die
Zuweisung nach Assos möglich ist.
Anders als die von Price
vorgeschlagene Datierung von 188–160 v. Chr.[86],
wird die Assos-Serie von Ellis-Evans aufgrund von Hortfunden in
die späten 170er oder frühen 160er Jahre v. Chr. datiert[87].
Deutlich jünger können sie nicht sein, denn um 170 v. Chr.
führte Eumenes II. eine Münzreform durch. Dabei wurde das
Gewicht der Tetradrachmen von etwa 16,8 g auf ca. 12,6 g
reduziert. Die neuen Münzen werden heute in Anlehnung an das
neue Münzbild auf der Vorderseite als Kistophoren bezeichnet[88].
3.2 Marktgewichte aus Assos
Marktgewichte dienten beim Handel zur
Messung und Berechnung unterschiedlichster Handelsgüter. Ein
einheitliches und garantiertes Gewicht war deshalb ein wichtiger
Teil des Handelsgeschehens in den griechischen Poleis, für das
der Staat zu sorgen hatte[89].
Marktgewichte besaßen aus diesem Grund einen offiziellen
Charakter und wurden von Beamten, den Metronomoi und Agoranomoi,
kontrolliert und geeicht[90].
Ab dem 5. Jh. v. Chr. wurden Marktgewichte mit Reliefs und
Inschriften versehen, die von staatlicher Seite die Echtheit
garantierten[91].
Über den Abgleich der verwendeten offiziellen Bilder auf den
Marktgewichten mit den jeweiligen städtischen Münzbildern lässt
sich ermitteln, ob jene Zeichen die Eigenschaften eines
Parasemons besitzen.
Im Folgenden werden acht assische
Marktgewichte mit bildlichen Reliefs behandelt (s. Tabelle 1),
von denen fünf Exemplare nachweislich aus Grabungen aus Assos
stammen und die in dieser Arbeit erstmals gesammelt vorliegen[92].
Für ihre metrische Untersuchung ist Folgendes zu bedenken:
Gewichtsstandards änderten sich mit der Zeit. Auch ohne
bekannten Fundkontext lassen sich Marktgewichte deshalb diesen
Standards über ihr Gewicht bzw. als Teilgrößen zuordnen und
damit datieren. Dabei ist allerdings eine gewisse Vorsicht
geboten. Damit eine chronologische Zuweisung vorgenommen werden
kann, muss bekannt sein, zu welcher Zeit ein Gewichtsstandards
an einem Ort gültig war[93].
Für Assos lässt sich das nicht durchgehend beantworten.
Zumindest im Verlauf des 2. Jh. v. Chr. setzte sich die attische
Mine als Standard durch und mit der Machtübernahme Roms 133 v.
Chr. die römische Libra. Für die Zeit vor dem 2. Jh. v. Chr.
können nur hypothetische Aussagen getroffen werden[94].
Wenn der Gewichtsstandard nicht
bekannt ist und Marktgewichte dennoch anhand ihres Gewichtes
datiert werden sollen, dann ist dies nur über eine große Anzahl
von Fundstücken möglich. Aus ihnen lassen sich
Durchschnittswerte berechnen, die wiederum zu Gewichtsstandards
passen und einen Vergleich ermöglichen[95].
Dabei ist zu bedenken, dass gefundene Marktgewichte heute oft
von ihrem ursprünglichen Gewicht abweichen. Blei ist als
Material sehr anfällig für Korrosion. Bei sehr kleinen
Marktgewichten können Abweichungen von bis zu 20 % zum früheren
Originalgewicht auftreten[96].
Bei größeren Stücken sind die Schwankungen mit wenigen Gramm
hingegen häufig nicht ausschlaggebend. Weisen Marktgewichte
weiterhin wenig Verschmutzung oder Korrosion auf, dann kann
davon ausgegangen werden, dass das heutige Gewicht nahe beim
ursprünglichen liegt[97].
Bei der Interpretation ist also
Vorsicht geboten. In Assos liegt mit insgesamt acht Exemplaren
eine recht kleine Untersuchungsmenge vor. Sollten sie nicht in
den benannten Zeitraum ab dem 2. Jh. v. Chr. fallen, ist eine
Zuweisung allein über das Gewicht nicht möglich.
|
Marktgewicht
|
Gewicht |
Maße |
Inschrift |
Einheit |
|
Nr. 1 |
616,4 g |
8,0 x 7,0 cm |
ΔΗ(ΜΟΣΙΟΝ) /
ΑΣΣ[Ι](ΩΝ) |
1 Mina |
|
Nr. 2 |
943 g |
8,2 x 7,6 cm |
M(νᾶ)
Δ(ύο)? |
Doppelte Mina |
|
Nr. 3 |
452 g |
7,1 x 7,0 cm |
ΑΣΣΙΩΝ
/ ΔHM(ΟΣΙΟΝ) |
1 Mina |
|
Nr. 4 |
241 g |
6,5 x 6,0 cm |
Δ[…] |
½ Mina |
|
Nr. 5 |
? |
? |
? |
? |
|
Nr. 6 |
287,69 g |
5,2 x 5,0 cm |
A[ΣΣI]Ω[N] |
½ Mina |
|
Nr. 7 |
? |
3,5 x 3,0 cm |
- |
? |
|
Nr. 8 |
33,3 g |
2,5 x 2,2 cm |
ΔΗ[ΜΟΣΙΟΝ]
/ Δ |
? |
Von den acht Marktgewichten (s.
Tabelle 1) stammen drei Gewichte aus dem Kunsthandel/
Privatbesitz (Marktgewicht Nr. 1–3) und fünf wurden im Rahmen
von Ausgrabungen in Assos entdeckt (Nr. 4–8):
-
Marktgewicht Nr. 1, welches bereits bei Killen 2017 aufgeführt worden ist[98], misst ca. 8 x 7 cm und besteht aus Blei. Es entstammt einer Privatsammlung. Als Fundort wird Assos angegeben. Es trägt die Inschrift ΔΗ(ΜΟΣΙΟΝ) / ΑΣΣΙ(ΩΝ) – »Vom Volk von Assos«. Das Stück besitzt eine Masse von 616,4 g und wird von Killen an das Ende des 2. Jh. v. Chr. datiert[99].
-
Marktgewicht Nr. 2 (Abb. 20) wurde 2023 durch die Nomos AG auktioniert. Das Gewicht aus Blei misst ca. 8,2 x 7,6 cm und wiegt ca. 943 g. Unten findet sich die Inschrift MΔ[100]. Dem Gewicht nach wäre eine Einordnung als doppelte attische Mine von ca. 487 g denkbar. Diese war zwischen dem 1. Viertel des 4. Jh. v. Chr. und dem späten 3. Jh. v. Chr. in Gebrauch[101]. MΔ ließe sich so zu Mνᾶ Δυο aufzulösen. Diese zeitliche Einordnung kann aufgrund der Unsicherheiten und fehlender Vergleichsexemplare jedoch nur als eine Orientierung dienen.
-
Ebenfalls im Jahr 2023 wurde durch die Nomos AG das Marktgewicht Nr. 3 (Abb. 21) versteigert. Es misst ca. 7,1 x 7,0 cm, besteht aus Blei und wiegt ca. 452 g. Oben und unten befindet sich die Inschrift ΑΣΣΙΩΝ / ΔHM(ΟΣΙΟΝ)[102]. Das Gewicht würde zur attischen Mine von ca. 453 g (um 480 v. Chr. bis 1. Viertel des 4 Jh. v. Chr.)[103] oder zur attischen Mine von ca. 487 g (1. Viertel 4. Jh. v. Chr. bis spätes 3. Jh. v. Chr.)[104] passen.
-
Das Marktgewicht Nr. 4 (Abb. 22) stammt aus einem geschlossen Fundkontext eines hellenistischen Grabes (C IX Gr 1) aus der Westnekropole[105]. Es misst ca. 6,5 x 6,0 cm, besteht aus Blei und wiegt 241 g[106]. In der oberen linken Ecke lässt sich ein Δ erkennen, so dass die Ergänzung der Aufschrift zu ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΑΣΣΙΩΝ möglich erscheint. Durch seine Masse würde das Marktgewicht als halbe Mine zu den ca. 487 g der attischen Mine passen, die zwischen dem 1. Viertel des 4 Jh. und dem späten 3. Jh. v. Chr. in Gebrauch war[107].
-
Ein fünftes Marktgewicht mit einem nach rechts gelagerten Greifen wurde 2023 bei den Ausgrabungen am Nymphäum in Assos gefunden. Nähere Informationen liegen nicht vor[108].
-
Zu den drei Streufunden aus Assos gehört das Marktgewicht Nr. 6 (Abb. 23). Es misst 5,2 x 5,0 cm und wiegt 287,69 g[109]. Als Inschrift ist A[...]Ω[…] zu erkennen, was sich eventuell wiederum zu ΑΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ergänzen ließe. Eine Datierung ist bei aller Unsicherheit grob möglich. Aufgrund des Gewichts wäre die Hälfte einer attischen Mine von ca. 600 g (ab dem späten 3. Jh. v. Chr.) oder jener von 648 g (ab dem Ende des 2. Jh. v. Chr.)[110] denkbar.
-
Das Marktgewicht Nr. 7 (Abb. 24), das als Streufund aus der Westtor-Nekropole stammt, ist deutlich kleiner als die anderen und misst ca. 3,5 x 3,0 cm. Eine Gewichtsangabe liegt leider nicht vor. Auffällig ist, dass dieses Marktgewicht keine Inschrift trägt. Eine Datierung ist mangels Vergleich nur bedingt möglich. Arslan ordnet es als hellenistisch ein[111].
-
Auch das Marktgewicht Nr. 8[112] wurde als Streufund in der Westtor-Nekropole gefunden. Das kleine Stück misst 2,5 x 2,2 cm und wiegt 33,3 g. Hierauf findet sich nach Freydank die Inschrift ΔΗ[ΜΟΣΙΟΝ] und ein Δ, welches Freydank δέκα ergänzt. Eine Datierung nimmt Freydank nicht vor[113]. Eine Einordnung des Gewichts kann aufgrund fehlender Vergleiche aus Assos nicht erfolgen. Die stilistische Beschaffenheit, die Freydank beschreibt[114], passt aber wiederum zu den übrigen hier behandelten Stücken und erlaubt eine ähnliche Einordnung.
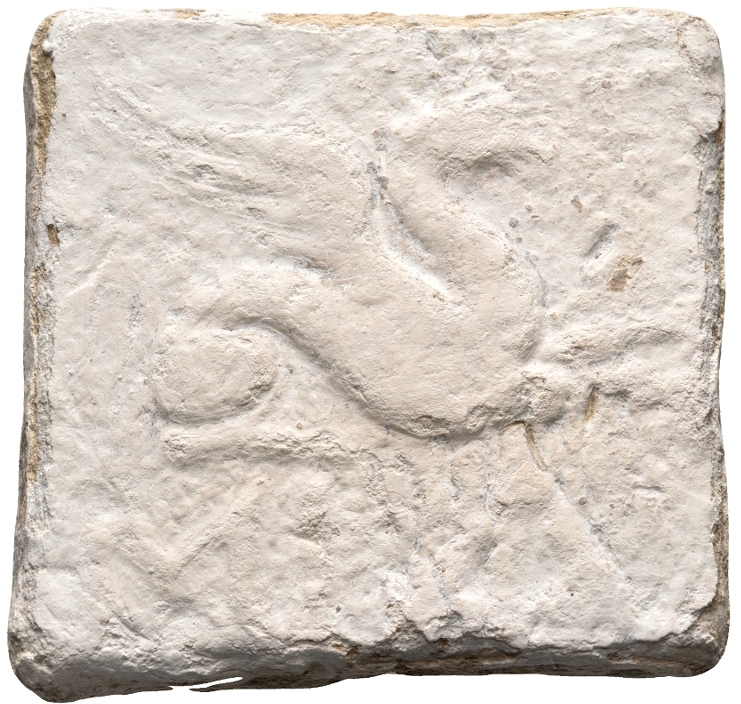
Abb. 20: Marktgewicht Nr.
2 (hellenistisch) Blei, ca. 8,2 x 7,6 cm, 943 g
M(νᾶ)-Δ(ύο).
Ein Greif liegt nach r.
Nomos AG 2023a,
Obolos
Webauktion 27, Lot 434

AΣΣIΩΝ ΔHM(ΟΣΙΟΝ). Ein Greif liegt nach r.
Nomos AG 2023b, Obolos Webauktion 29, Los 293

Δ[…]. Ein Greif liegt nach r.
Foto der Assos-Grabung

A[ΣΣI]Ω[N]. Ein Greif liegt nach r.
Foto der Assos-Grabung

Ein Greif liegt nach r. Keine Inschrift erkennbar
Foto der Assos-Grabung
Alle acht Marktgewichte zeigen einen
Greifen (vgl. Abb. 20–24): Er befindet sich in liegender
Position nach rechts. Die linke Pfote ist erhoben. Ebenso ragen
Kopf und Schwanz auf. Die Flügel sind etwas gedrungener
gestaltet als auf den Münzen und ihre Federn ragen leicht
geschwungen nach oben. Er wird damit stets gleich dargestellt
und ähnelt im Ganzen der bevorzugten Darstellungsweise auf den
Münzen (wobei dort die Blickrichtung variiert)[115].
Zwar lassen sich die Marktgewichte
zeitlich nicht genau einordnen – bis auf drei Exemplare, die
wahrscheinlich zwischen dem späten 3. Jh. und dem Ende des 2.
Jh. v. Chr. und ans Ende des 2. Jh. v. Chr. datieren – doch die
unterschiedlichen Massen der Gewichte lassen den Schluss zu,
dass verschiedene Gewichtsstandards zugrunde lagen. Die acht
Exemplare verteilen sich somit höchstwahrscheinlich auf
verschiedene Phasen innerhalb der späten Klassik und des
Hellenismus.
Während es in der Münzprägung von
Assos kurzzeitige Wechsel des Münzbildes gab, wie in Abschnitt 2
dargelegt wurde, zeigen die vorgestellten Marktgewichte allesamt
den Greifen. Auch die in der Bronzeserie von 280–240 v. Chr.
gezeigte Darstellungsvariante mit einem stehenden Greifen
(Lenger-Serie 5) scheint sich hierbei nicht durchgesetzt zu
haben.
Mit insgesamt acht
Greifen-Marktgewichten konnte nun eine breitere Materialbasis
für die Beurteilung der Frage nach dem Parasemon von Assos
geschaffen werden. Die Funktion des liegenden Greifen als
Parasemon wird somit deutlich.
4. Der Greif als
identitätsförderndes Bild für Assos
Der Greif ist ein
mythologisches Mischwesen aus Raubvogel und Löwe. Damit
verkörpert er zugleich die Elemente Luft und Erde[116].
Bei den Griechen nahm er stets eine ambivalente Rolle ein. Der
Greif war zum einen ein Wächter von Toren und Kostbarem und zum
anderen ein unberechenbares Ungeheuer. Er war Jäger und
gleichzeitig jagdbar. Beim Tierkampf wird er häufig mit Löwen
dargestellt[117].
Als Wächter beschützte er die Seelen der Toten vor Ungeheuern
und findet sich häufig im Totenkult, so etwa auf Sarkophagen[118].
Greifen wurden von
den Griechen verschiedenen Göttern zugeordnet. Nach Aischylos
sollen sie die Wächter von Zeus gewesen sein[119].
Nonnos beschreibt sie als Begleiter von Nemesis[120].
Gleichsam steht er in Verbindung zu Dionysos[121].
Er taucht aber auch in Begleitung von Athena[122]
oder Artemis[123]
auf. Aufgrund ihres Wohnortes im goldreichen Norden Skythiens
und als Nachbarn der Hyperboreer, bei denen Apollon im Winter
verweilte, werden Greifen oft mit Apollon in Bezug gesetzt[124].
In römischer Zeit ist der Greif vor allem der Begleiter
Apollons, dessen Sonnenwagen er zieht und der Greifenritt ist
ein verbreitetes Motiv[125].
In der Folge wurde er auf weitere Sonnengötter, wie Mithras,
übertragen[126].
In welcher Verbindung
steht der Greif nun zu Assos? Als Parasemon der Stadt muss er
eine besondere Bedeutung und einen identitätsfördernden
Charakter für die Bewohner besessen haben. In der Troas sind in
griechisch-römischer Zeit zwei Kulte besonders verbreitet, der
Kult des Apollon Smintheus und der Kult der Athena Ilias: Als
Mäusegott (Smintheus), der aus Rache den vor Troja lagernden
Achäern die Pest schickt, tritt Apollon in der Ilias auf[127].
Auf Münzstätten der Troas, etwa Alexandria Troas oder Hamaxitos,
wird er dargestellt, in Alexandria Troas teilweise mit Maus[128].
Letztere zeigt den Gott in der römischen Kaiserzeit zudem
zeitweise auf einem Greifen reitend[129].
Das Heiligtum des Apollon Smintheus, das Smintheion, liegt nur
ca. 25 km von Assos entfernt beim heutigen Ort Gülpınar und Nahe
dem Kap Lekton. Auf eine ehemalige Verbindung zwischen dem
Smintheion und Assos deutet das Teilstück einer antiken Straße
hin, das zwischen den Orten Koyunevi und Balabanlı gefunden
wurde[130].
Bereits Lazzarini schlug daher vor,
den Greifen auf den assischen Münzen auf den Kult des Apollon
Smintheus zu beziehen[131].
Lenger verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass das
unwahrscheinlich erscheint, da Apollon, sowohl in griechischer
Zeit als auch in der Kaiserzeit, nie auf Münzen aus Assos
erscheint. Athena sei hingegen über einen langen Zeitraum im
Münzbild präsent[132].
Tatsächlich sind die Belege einer
Verehrung des Apollon in Assos, trotz der Bedeutung des
Smintheion für die Region, sehr gering. Lediglich eine einzige
Inschrift aus dem Grabungsdepot in Assos aus dem 3. Jh. n. Chr.
erwähnt Lucius Calventius Faustinus als Gewinner im Pankration
der Jungen bei den Smintheia-Pauleia-Spielen, die in Alexandria
Troas stattfanden. Allerdings wurde diese in Çamköy, also
zwischen Gülpınar und Assos, gefunden, womit der Bezug zu Assos
unklar ist[133].
Weitere Überlieferungen oder archäologische Funde, die einen
ausgeprägten Kult für Apollon in Assos belegen könnten, gibt es
zurzeit nicht[134].
Dass der Kult einen zentralen identitätsfördernden Charakter für
die Stadt besaß, erscheint somit unwahrscheinlich. Allerdings
sollte die Bedeutung des Smintheions als extraurbanes Heiligtum
für die gesamte Region nicht außer Acht gelassen werden.
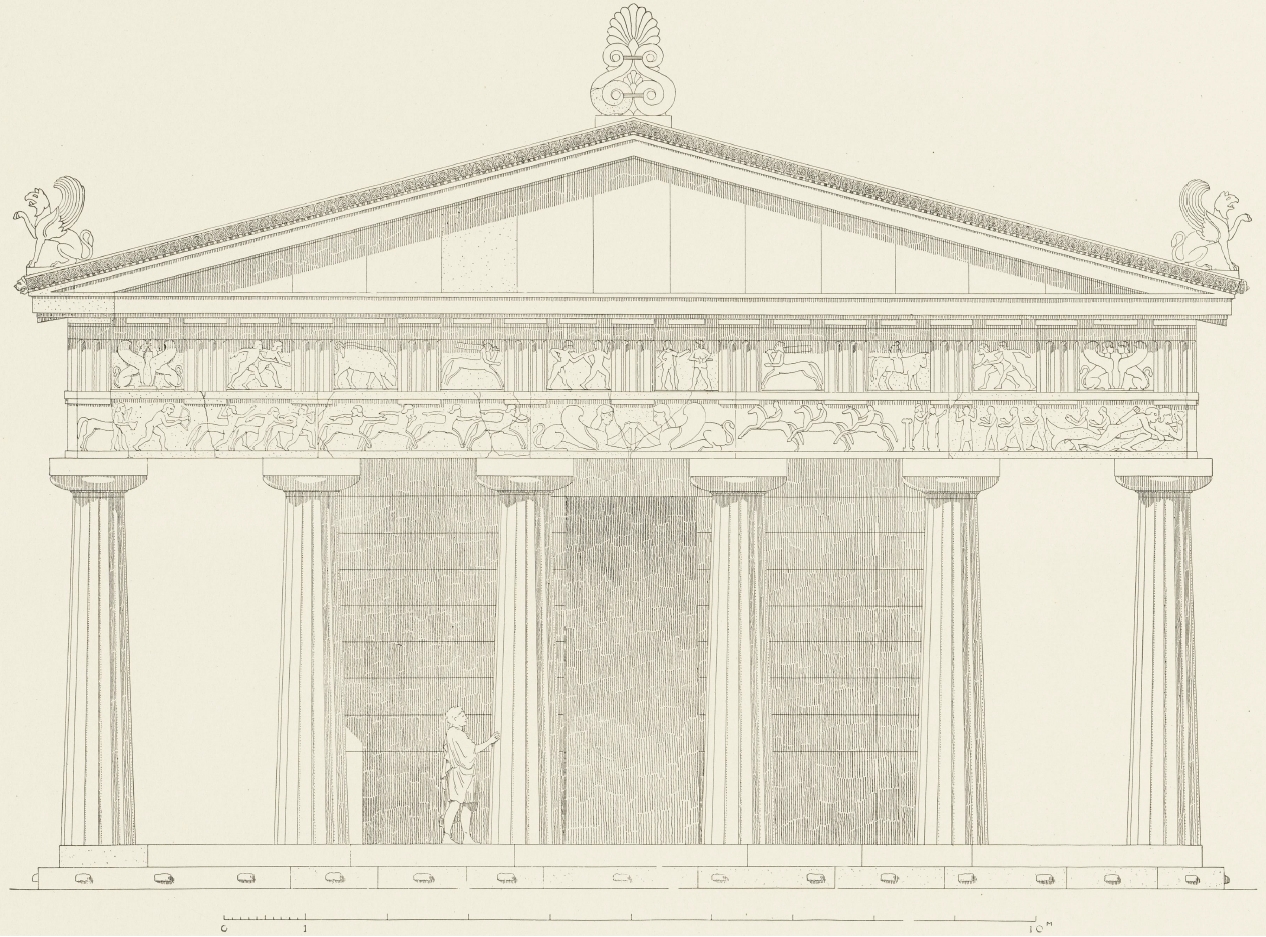
Dahingegen ist der
Kult der Athena in Assos gut nachzuweisen: Nicht allein die
Darstellungen auf Münzen oder der Tempel auf der Akropolis (Abb.
25)[135]
zeigen die Bedeutung der Göttin für die Stadt. Assos war zudem
Mitglied im Koinon der Athena Ilias, einem Bund äolischer,
ionischer und dorische Gemeinschaften sowie einiger Poleis aus
der Region der Propontis, die das Heiligtum in Ilion und die
Panegyris gemeinsam verwalteten, religiöse Abgesandte
entsendeten und Beiträge für die Opferzeremonien leisteten[136].
Athena Ilias besitzt die Wesenszüge einer wehrhaften Kriegerin
und die einer Handwerkerin[137].
Charakteristisch für die Ikonographie ist das Tragen einer Lanze
und einer Spindel[138],
wie es Münzen aus Ilion zeigen (Abb. 26)[139].
Auffällig hierzu ist die Ähnlichkeit der in Assos zwischen 410
und 400 v. Chr. geprägten Tetradrachme (Abb. 6).
Sie zeigt das archaische Kultbild der Göttin auf einer Basis.
Wie die Athena Ilias trägt sie einen Speer und Wollbinden mit
einem Objekt, das Riedel als Spindel deutet, womit ebenfalls
eine Darstellung der Athena Ilias vorläge[140].
Weiterhin zeigt sich in der Verehrung von Athena eine mögliche
Verbindung zur Metropolis Methymna. Auch dort war Athena die
Stadtgottheit. Die Übernahme von Kulten und Bildern aus den
Mutterstädten in die Apoikien ist belegt[141].


Av. Kopf der Athena nach r. / Rv. IΛI. Palladion auf Sockel nach l., in der r. Hand ein Speer und in der l. Hand eine Tänie und Spindel
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18279160 (B. Weisser)
In Assos selbst
finden sich zahlreiche weitere Hinweise auf die Verehrung der
Göttin. Eine Terrakotte der Athena mit Gorgoneion auf der Brust
(heute im Archäologischen Nationalmuseum Athen) zeigt bereits um
500 v. Chr. ihre Verehrung (Abb. 27)[142].
Zwei Inschriften, gefunden bei den amerikanischen Grabungen
1881–1883, belegen den hohen Stellenwert der Gottheit. Sie
nennen die Athenapriesterin Lollia Arlegilla und beschreiben in
römischer Zeit die Verehrung der »pure virgin« (Athena) durch
die Vorfahren[143].
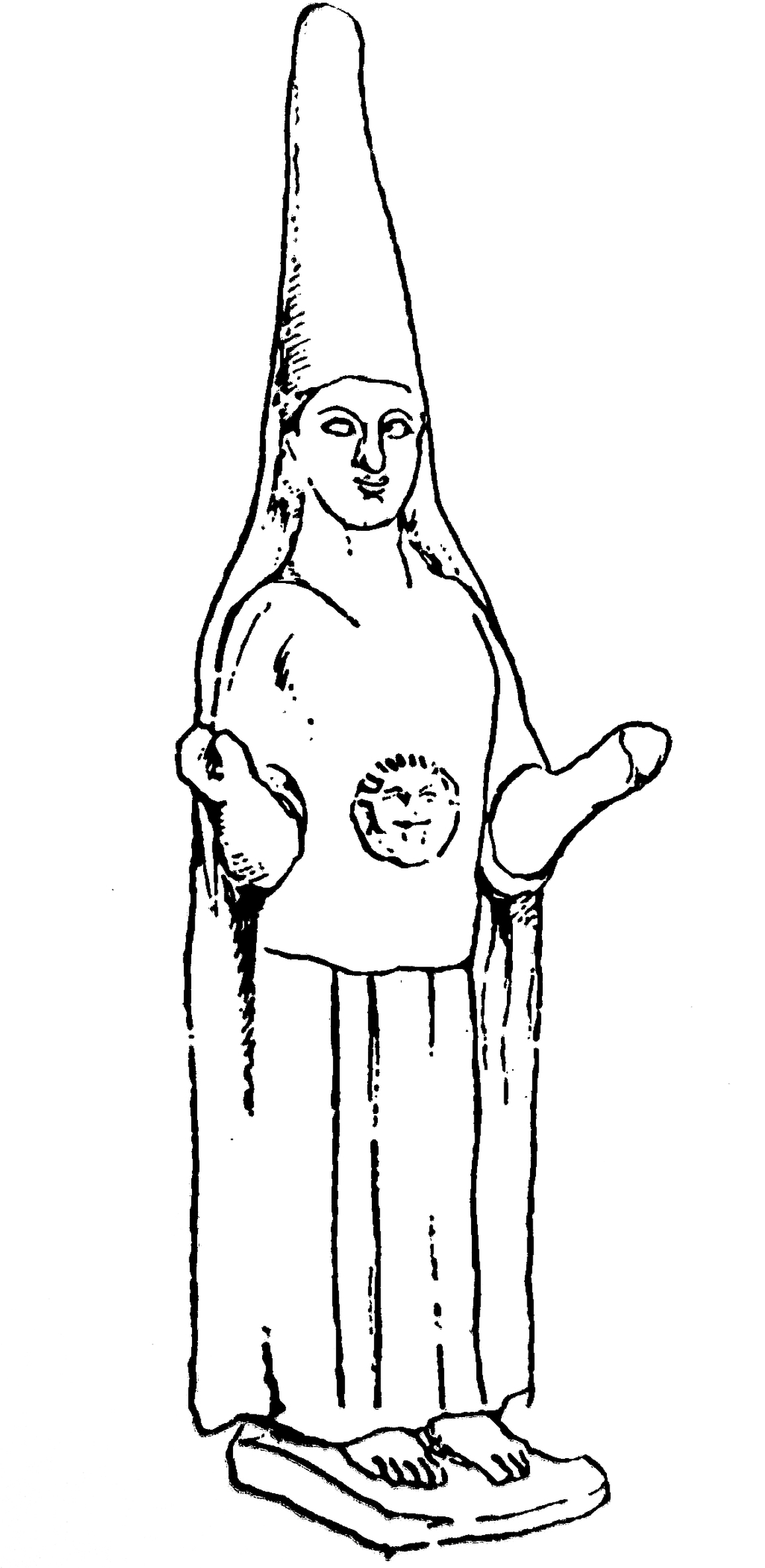
Athena stehend im Peplos, auf der Brust ein Gorgoneion. Auf dem Kopf ein hoher Polos. Die Arme sind leicht gehoben
Archäologisches Nationalmuseum Athen; nach: Winter 1903, Taf. 54
Es kann somit
festgehalten werden, dass Athena die zentrale Stadtgottheit von
Assos war. Möchte man folglich den Greifen mit einer
Stadtgottheit in Bezug setzen, dann müsste es diese Göttin sein.
Athena ist für Assos maßgeblich von Bedeutung und die
Kombination des Greifen mit ihr auf der Vorder- und Rückseite
ist auf den assischen (Bronze-)Münzen durchaus geläufig. Hierbei
besteht jedoch die Frage, inwieweit sich Verbindungen zwischen
dem Greifen und der Athena erklären lassen. Denn anders als bei
den genannten Zuordnungen zu anderen Gottheiten ist die
literarische Überlieferung für Athena spärlich und der Bezug
somit schwer zu fassen[144].


Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach l. Auf dem Helm ein Greif. Unter dem Hals eine Robbe nach l. / Rv. Viergeteiltes Quadratum incusum
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18311889 (B. Seifert [Lübke & Wiedemann])


Av. Kopf der Athena mit attischem Helm mit drei Helmbüschen in der Dreiviertelansicht nach r. Vor dem mittleren Helmbusch eine Sphinx, vor den zwei seitlichen Helmbüschen je ein Greif / Rv. ΣΙΓΕ. Eule steht nach r. Im linken Feld eine Mondsichel
Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18279497 (B. Weisser)
Mehr Anhaltspunkte für eine Verbindung beider gibt es allerdings in der ikonographisch-archäologischen Überlieferung. So ist die Abbildung des Greifen auf dem Helm der Athena auf der 410–400 v. Chr. in Assos geprägten Tetradrachme (Abb. 6) kein Einzelfall. Wir kennen diese Darstellung von mehreren Münzstätten in der Region, wie Phokaia (Abb. 28)[145], Sigeion (Abb. 29)[146] oder Pergamon[147]. Sie ist aber auch im griechischen Mutterland, etwa in Athen[148], auf den Münzen des thessalischen Bundes[149] oder in Unteritalien, etwa in Thurioi oder Herakleia (Lukanien)[150], bekannt[151].
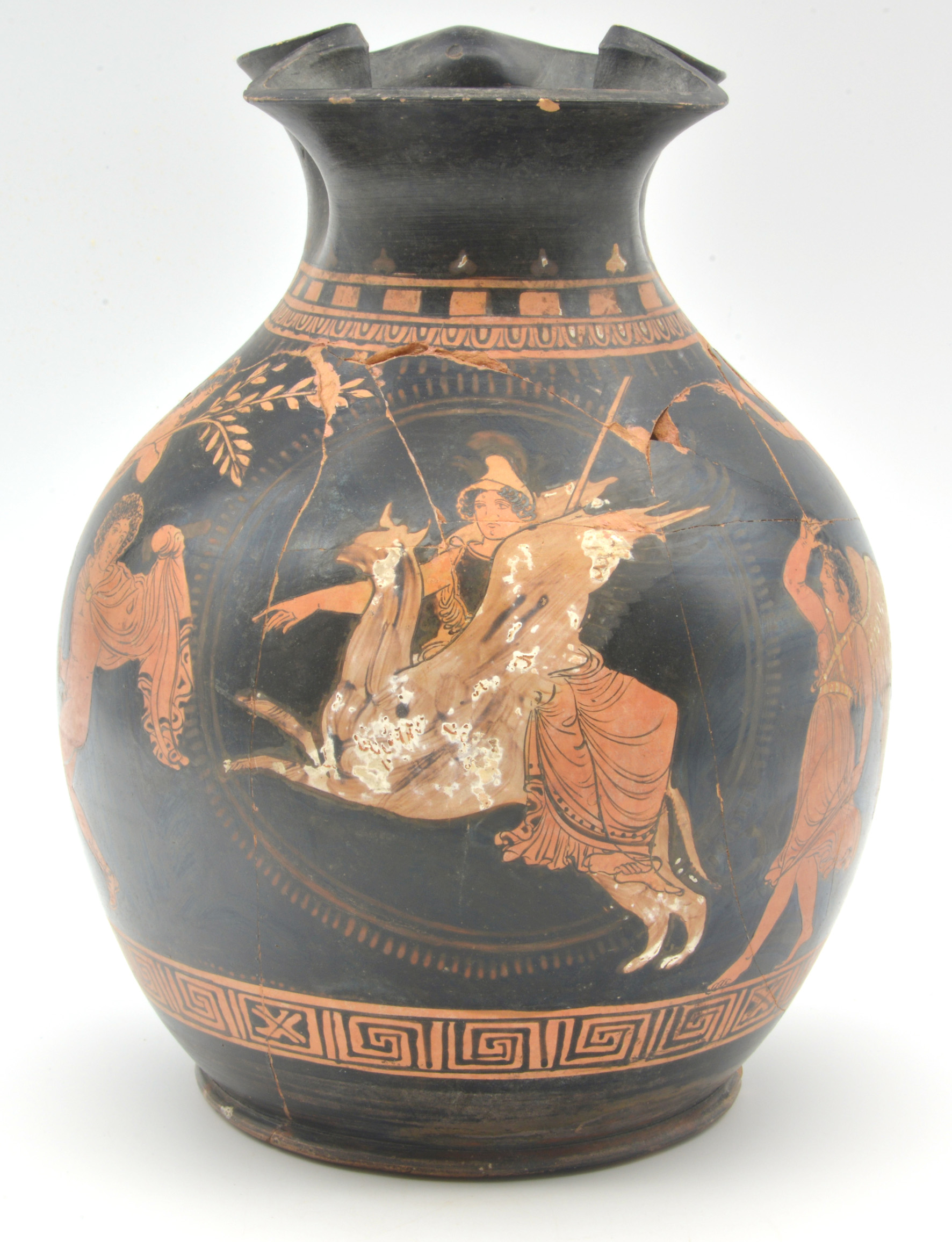
Athena in Gewand (Peplos) und Helm reitet auf einem Greifen nach l., in der l. Hand einen Speer, die r. Hand erhoben
Museo Archeologico Nazionale Tarent, Inv. N. 214005.
Ein weiterer
archäologischer Hinweis findet sich im ionischen Phokaia. Dort
wurde Athena ebenfalls als Stadtgottheit verehrt und die Stadt
prägte zeitweise Greifen auf ihre Münzen. Aus dem dortigen
Athenaheiligtum stammen zwei Greifenprotomen, welche die
Innenwände zierten und als Wächter fungierten. Während Lenger
hierin einen Bezug zu Athena sieht[152],
schließt Aylin Tanrıöver den Greifen als Begleitwesen der Göttin
in Phokaia aus, erläutert dies allerdings nicht genauer[153].
Festzustellen ist eine Verbindung weiterhin im Athenatempel von
Chios. Dort trug das archaische Kultbild der Göttin neun
Greifenprotomen, die wahrscheinlich an ihrem Helm bzw. einer
Stephane befestigt waren[154].
In Assos selbst finden sich jenseits der Münzprägung keine konkreten Anhaltspunkte, die den Bezug von Greif zu Athena belegen. Die Metopen und Friese des Athenatempels zeigen verschiedene wilde Tiere, Löwen-, Stier- und Sphingengruppen. Ein Bild oder eine Skulptur eines Greifen wurde bislang jedoch nicht gefunden[155].
Es ließe sich weiterhin überlegen, inwiefern der Athena
von Assos Elemente einer früheren anatolischen Gottheit
beigeordnet worden sind. Als die Griechen von Lesbos aus den Ort
besiedelten, fanden sie möglicherweise ältere Spuren eines
Kultes vor, den sie Athena zuordneten. Schließlich zeigen Funde
im Bereich des Tempels Siedlungsspuren, die zurück in die
Bronzezeit reichen[156].
Die bereits angesprochene und in Assos gefundene
Athena-Terrakotte (Abb. 27) aus der Archaik trägt ein
Gorgoneion auf der Brust und einen hohen, im griechischen
Mutterland ungewöhnlichen, Polos. Dieser ist bei hethitischen
Gottheiten üblich[157].
Bekannt ist aus griechischer Zeit ein Synkretismus der Athena
mit der älteren luwischen, lykischen und hethitischen Göttin
Maliya. Wenngleich Maliya als Vegetations- und Wassergottheit
galt, verband sie mit Athena der Charakter als Stadtbeschützerin[158].
Auf einem silbernen Kopfgefäß aus Lykien wird Athena als
Mal[ija] bezeichnet[159].
Von Lesbos stammt ein Fragment, das Malis (Maliya) beschreibt,
die mit einer Spindel einen feinen Faden spinnt[160].
Damit trägt sie in diesem Fall das gleiche Attribut wie die
Athena Ilias. Eine Begleitung älterer anatolischer Gottheiten
durch Greifen ist bekannt[161].
Allerdings kennen wir für Maliya bislang vor allem als Nymphen
interpretierte Begleiter, aber keine Greifen[162].
Es liegen hierbei also keine Belege für eine Beziehung zwischen
Greifen und der Göttin vor.
So bleiben die
ikonographisch-archäologischen Funde die einzigen Belege für
eine Verbindung von Greif und Athena. Der mythologische
Hintergrund bleibt unklar. Dass der Greif sich in Assos auf
Athena bezieht, ist nicht die einzige Möglichkeit. Aufgrund der
hohen Bedeutung der Göttin als Stadtgottheit von Assos und der
evidenten Kombination beider auf den städtischen (Bronze-)Münzen
ist diese Möglichkeit aber durchaus als die aktuell
wahrscheinlichste anzusprechen und könnte somit den
identitätsfördernden Charakter des Bildes für die Stadt erklären[163].
5. Resümee
Der Greif ist das Parasemon von
Assos. Im Verlauf der assischen Münzprägung ist er das
bestimmende Bild und wird von den Anfängen in der Archaik bis in
römische Zeit, abgesehen von kürzeren Unterbrechungen durch
andere Münzbilder, verwendet. In seiner Gestaltung hat er je
nach Blickrichtung die linke oder rechte Pfote erhoben. Ebenso
ragen Kopf und Schwanz auf. Die Flügelpositionen variieren.
Jedoch setzt sich mit der Zeit eine Darstellungsweise durch, in
denen die Flügel abgeknickt und dann gerade am Körper oder
leicht geschwungen entlanggeführt werden. Unterstützend kommt im
Zusammenhang mit den Münzen die Verwendung des Bildes auf den
Alexander-Tetradrachmen hinzu, die gemeinhin prägnante Bilder
von Prägestätten tragen.
Insgesamt zeigen acht Marktgewichte,
von denen fünf gesichert aus Grabungen in Assos stammen, den
Greifen in der gleichen Darstellungsweise, wie auf den Münzen.
Die Gewichte gehören unterschiedlichen Gewichtsstandards an.
Diese lassen sich in den meisten Fällen nicht genau bestimmen.
Dass aber offensichtlich mehrere Wechsel des Standards
stattfanden, zeigt die Verwendung von Marktgewichten mit Greifen
über einen längeren Zeitraum, der sich zumindest mit der
Spätklassik und dem Hellenismus eingrenzen lässt. Die Frage
danach, ob in der Zeit, in der Assos andere Bilder auf seine
Münzen prägte, auch andere Bilder auf Marktgewichten oder
anderen instrumenta publica verwendet wurden, kann nach
dem aktuellen Stand verneint werden. Der Greif blieb das einzige
Parasemon von Assos. Damit kann der Zuordnung des assischen
Parasemons durch Simone Killen nun auf einer breiteren
Materialbasis gefolgt werden.
Als weiterhin schwierig gestaltet
sich die Frage nach dem Hintergrund des identitätsfördernden
Charakters des Greifen für Assos. Zwei Kulte sind in der Troas
von hoher Bedeutung. Der Kult des Apollon Smintheus und der Kult
der Athena Ilias. Während in Assos selbst nach aktuellem
Forschungsstand keine Belege für einen Apollonkult existieren,
ist der Athenakult sehr präsent. Athena ist die Stadtgöttin von
Assos. Sie erscheint nicht nur auf den Münzen, sondern bereits
in der Spätarchaik als Terrakotta-Statuette. Der ihr
zugeschriebene Tempel nimmt den prominenten Platz auf der
Akropolis ein. Zwei Inschriften belegen zum einen ihre hohe
Bedeutung in der Stadt und zum anderen die lange Tradition ihrer
Verehrung. Wenngleich der Greif mehreren Gottheiten zugeordnet
wird und in Bezug auf Athena nur eine spärliche literarische
Überlieferung existiert, so lässt sich die Verbindung zu Athena
ikonographisch-archäologisch fassen. Die genaue Ausformung und
die mythologischen Verknüpfungen zwischen dem Greifen und Athena
sowie der genaue Bezug zu Assos bleiben hingegen unklar. Zuletzt
muss festgehalten werden, dass eine Verbindung des Greifen zu
anderen Kulten weiterhin nicht ausgeschlossen werden kann. Der
Bezug zu Athena ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Jedoch
kann man diesen aufgrund der wichtigen identitätsfördernden
Rolle der Athena als Stadtgöttin von Assos nach aktuellem Stand
als den wahrscheinlichsten betrachten.
[1] Arslan –
Böhlendorf-Arslan 2014, 10. 26.
[2] Schwertheim 1997,
112; Arslan – Rheidt 2013, 195. 210; Lazzarini 2017, 32.
[3] Siehe Abschnitt 2.
[4] Schwertheim 1997,
113; Böhlendorf-Arslan 2008, 121; Arslan – Rheidt 2013,
197.
[5]
Lenger 2009a, 24; Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 52.
[6] Bell
1921, 295–313.
[7]
Lenger 2009a, 24; Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 52.
[8]
Freydank 2000, 60–62; Lenger 2009a, 31.
[9] Arslan – Rheidt
2013, 195.
[10] Böhlendorf-Arslan
2008, 130.
[11] Weisser – Gorys
2022, 42.
[12] Lenger 2009a.
[13]
Lazzarini 2017, 31–41.
[14] Genauer wird dies
in Abschnitt 2 erläutert.
[15] Während Metalle
wie Gold und Silber einen intrinsischen Wert besitzen,
ist dies bei Legierungen und unedlen Metallen
schwieriger. Um dennoch Vertrauen in das Geld zu
schaffen, waren offizielle Symbole hilfreich, die den
Wert garantierten: Mittag 2016, 44; Killen 2017, 71–73.
76–78.
[16] Killen 2017, 1–5.
[17] Killen 2017,
71–73. 76–78.
[18] Simone Killen
untersuchte Parasema in ihrer wichtigen
Dissertationsschrift von 2017 und ordnete darin den
Greifen als Parasemon unter anderem Assos zu. Als
zweites instrumentum publicum der Stadt neben der
Münzprägung führte Killen ein assisches Marktgewicht mit
einem Greifen aus der 2. Hälfte des 2. Jh. v. Chr. an.
Dieses stammt aus einer Privatsammlung: Killen 2017,
218.
[19] Siehe Abschnitt
3.1.
[20] Killen 2017, 1 f.
[21] Killen 2017, 1–5.
[22] Siehe Abschnitt
4.
[23] Die im Folgenden
vorgestellte Münzprägung von Assos erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient der
Darstellung von Veränderungen des Münzbildes im Laufe
des Prägezeitraums der Polis.
[24] Arslan –
Böhlendorf-Arslan 2014, 66–71; Lazzarini 2017, 32.
[25]
Lazzarini 2017, 34 f. (Lazzarini-Serie 2);
CN Type 12238.
[26]
Clarke 1898, 185–188; Calmeyer-Seidl – Niemeyer
1998, 1217 f.
[27]
Lazzarini 2017, 34 f. (Lazzarini-Serie 2); Classical
Numismatic Group, LLC 2012, Auction 90, Lot 273.
[28]
Lenger 2009a, 109; Lazzarini 2017, 35.
[29]
Lazzarini 2017, 35 (Lazzarini-Serie 3);
CN Type 12244.
[30]
Lazzarini 2017, 35.
[31]
Lazzarini 2017, 35 (Lazzarini-Serie 4);
CN Type 12245.
[32] Arslan – Rheidt
2013, 196; Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 35.
[33] Schwertheim 1997,
112.
[34]
Lazzarini 2017, 36 (Lazzarini-Serie 6);
CN Type 12359.
[35] Lenger 2009a,
124. Die Rolle der Athena in Assos und die lediglich
indirekte Zuweisung des Akropolis-Tempels zu Athena
werden in Abschnitt 4 ausführlich erläutert.
[36]
Lazzarini 2017, 37 f. (Lazzarini-Serie 8);
CN Type 12361;
Bibliothèque Nationale de France, Département des
Monnaies, Médailles et Antiques Paris, Inv-No.
41768756.
[37] Riedel 2016, 70
f. (siehe Abschnitt 4).
[38] Lazzarini 2017,
36 f. (Lazzarini-Serie 7);
CN Type 20302; Leu Numismatik AG
2020, Webauktion 11, Los 836.
[39] Lenger 2009a, 110
(Lenger-Bronzeserie 1); Lazzarini 2017, 35 f.
(Lazzarini-Serie 5).
[40] Arslan –
Böhlendorf-Arslan 2014, 35.
[41] Lenger 2009a,
33–36 (Lenger-Serie 2); Lazzarini 2017, 38 f.
(Lazzarini-Serie 9);
CN Type 12363.
[42] BMC Troas etc. 36
f.; Bell 1921, 301 f.
[43] Babelon 1910,
1269–1274.
[44] Lazzarini 2017,
38 f.
[45] Lenger 2009a, 111
f.
[46] BMC
Troas etc. 37 f.; Lenger 2009a, 113–115.
37–50 (Lenger-Serie 3);
CN Type 13073 und
CN Type 19519.
[47] Schwertheim 1997,
112; Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 35; Arslan –
Rheidt 2013, 196.
[48] Arslan – Rheidt
2013, 196.
[49] Arslan –
Böhlendorf-Arslan 2014, 35. 37.
[50] Arslan – Rheidt
2013, 196.
[51] Lenger 2009a,
116–118 (Lenger-Serie 4); Lenger 2017, 100–103;
CN Type 20409.
[52] Bell vermutete
zunächst, dass die Exemplare aus Methymna stammen: Bell
1921, 306.
[53] Bell
1921, 306; Lenger 2009a, 51 f.
[54]
Pillot 2020, 676 f.
[55] Lenger 2009a, 53
f. 109 (Lenger-Serie 5);
CN Type 19539.
[56] Lenger 2009a,
119.
[57] Die
Alexander-Tetradrachmen wurden von den Diadochen nach
dem Tod Alexanders des Großen massenhaft geprägt. Durch
ihre große Anzahl und Verbreitung entwickelten sich
diese heute auch Alexandreier genannten Tetradrachmen
zum gängigen reichsübergreifenden Münztyp und wurden von
den Nachfolgern
bis in das 2. Jh. v.
Chr. geprägt: Mittag 2016, 166 f.
[58] Ellis-Evans 2021,
70.
[59] Mittag 2016, 167.
[60] Die Zuweisung der
Münzen zu Assos gestaltete sich nicht einfach. Zur
Diskussion der Zuweisung der Tetradrachmen an Assos
siehe Abschnitt 3.1.
[61] Schwertheim 1997,
112.
[62] »Wir aber zogen
voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort
Paulus zu uns nehmen; denn er hatte es so befohlen, weil
er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er uns nun traf in
Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen nach Mytilene«:
Apg. 20,13–14.
[63] Arslan – Rheidt
2013, 217.
[64] Schwertheim 1997,
113.
[65] Arslan –
Böhlendorf-Arslan 2014, 40.
[66] Arslan –
Böhlendorf-Arslan 2014, 39.
[67] Arslan –
Böhlendorf-Arslan 2014, 40.
[68]
Lenger 2009a, 55;
CN Type 18612;
RPC I Online Nr. 2320.
[69]
Lenger 2009a, 60;
CN Type 18678;
RPC III Online Nr. 1581.
[70]
Lenger 2009a, 63;
RPC IV,2 Online Nr. 2587 (temporary).
[71]
Lenger 2009a, 217;
CN Type 18928;
RPC IV,2 Online Nr. 62 (temporary).
[72] Hiermit
unterscheidet sich die Darstellung klar von anderen
Münzstätten, wie Teos, Abdera, Phokaia oder
Pantikapaion, die den Greifen in der Regel sitzend,
stehend oder springend oder als Protome zeigen: Mittag
2016, 114. 128; Ellis-Evans 2021, 58; Killen 2021,
90–99.
[73] Eine weitere
Greifendarstellung fand sich in Assos auf einem Mosaik
in einem Gebäude im Süden des Bouleuterions. Es zeigt
Vogel- und Löwengreifen. Aufgrund der unklaren Funktion
des Gebäudes wird die Darstellung hier nicht behandelt:
Clarke u. a. 1902, 21. 121; Arslan – Böhlendorf Arslan
2014, 94.
[74] Killen 2017, 16.
[75] Price 1991, 291
f.
[76] Siehe Abschnitt
2.
[77] Price 1991, 236;
291.
[78] Ellis-Evans 2021,
50 f.
[79]
Ellis-Evans 2021, 58.
[80]
Price 1991, 236.
[81]
Ellis-Evans 2021, 63.
[82] Leschhorn 2009,
693.
[83] Merkelbach 1976,
Nr. 68; Ellis-Evans 2021, 62 f.
[84]
Ellis-Evans 2021, 55.
[85]
Price 1991, 236.
[86]
Price 1991, 236.
[87]
Ellis-Evans 2021, 70.
[88] Mittag 2016, 187
f.
[89] Kroll 2021, 1.
[90] von Reden 2000,
136 f.; Killen 2017, 133.
[91] Killen 2017, 71.
[92] Hierneben sind
zwei Marktgewichte ohne Relief oder Inschriften bekannt.
Vergleichsfunde aus Olynth datieren vor 348 v. Chr.:
Bischop 1992, 154 f. Verwiesen sei an dieser Stelle auch
auf eine Mensa Ponderaria aus hoch- oder
späthellenistischer Zeit, die während der amerikanischen
Ausgrabungen 1881–1883 in Assos gefunden wurde. Auch sie
besitzt, abgesehen von Bezeichnungen für die Maßangaben,
keinerlei offizielle Reliefs oder Inschriften: Tarbell
1891, 440–443.
[93] Killen 2017, 17.
[94] Freydank 2000,
63.
[95] Hitzl 1996, 47 f.
[96] Killen 2017, 17;
Kroll 2021, 1 f.
[97] Hitzl 1996, 47 f.
[98] Killen 2017, Taf.
21,2.
[99] Killen 2017, 218.
[100] Nomos AG 2023a,
Obolos Webauktion 27. Lot 434.
[101] Hitzl 1996,
138–140; Kroll 2021, 1.
[102] Nomos AG 2023b,
Obolos Webauktion 29. Los 293.
[103] Kroll 2021, 1.
[104] Hitzl 1996, 141;
Kroll 2021, 1.
[105] Eine
Untersuchung der Bedeutung von Marktgewichten in
Grabkontexten erscheint lohnend. Eine zukünftige Studie
könnte hier wertvolle Erkenntnisse liefern.
[106] Freydank 2000,
63; Lenger 2009a, 249; Stupperich 1993, 17 f.
[107] Hitzl 1996,
138–140; Kroll 2021, 1.
[108] Keskin 2023.
[109] Assos-Grabung
2016, Fundbericht: KF 2016-873 (unpubliziert).
[110] Hitzl 1996, 140
f.; Kroll 2021, 1.
[111] Arslan 2010,
121.
[112] Keine Abbildung
vorliegend. Für die weitere Untersuchung kann daher
lediglich auf die Beschreibungen bei Freydank 2000, 63
zurückgegriffen werden, der hier ebenfalls einen nach
rechts gelagerten Greifen, wie auf den anderen
Marktgewichten beschreibt: Freydank 2000, 63; 247 f.
[113] Freydank 2000,
63; 247 f.
[114] Freydank 2000,
63; 247 f.
[115] Siehe Abschnitt
2.
[116] Flagge 1975, 30;
Calmeyer-Seidl – Niemeyer 1998, 1217 f.
[117] Flagge 1975,
27–33; Graf 1996, 865 f.
[118] Flagge 1975,
27–33; Tuzcay 2006, 191–193.
[119] Aischyl. Prom.
803–806.
[120] Nonn. Dion.
48, 381–383.
[121] Killen 2021, 98;
Tanriöver 2014, 174.
[122] Wie im Folgenden
geschildert wird.
[123] Strabon
beschreibt ein Bild des Kleanthes im Tempel der Artemis
Alpheionia, auf dem Artemis von einem Greifen in die
Höhe getragen wird: Strab. 8,3,12.
[124] Hdt. 4,13;
Flagge 1975 74 f.; Tuzcay 2006, 191–193.
[125] Flagge 1975, 75;
Lambrinudakis 1984, 230; Auch in Alexandria Troas (RPC
Online IX Nr.
407,
471 und
RPC X Type 63958) und damit in der
Nachbarschaft von Assos.
[126] Flagge
1975 74 f.; Tuzcay 2006, 191–193.
[127] Hom.
Il 1, 36–67.
[128]
Lambrinudakis 1984, 231 Nr. 378a–d; BMC Troas etc. 9.
56;
CN Type 21086
[129] SNG Kopenhagen
20, 178;
RPC IX Online Nr. 407.
[130] Kaplan 2016, 50.
53. 60.
[131] Lazzarini 2017,
38.
[132] Lenger 2009b,
217.
[133] Λ[ούκιον]
Καλβέντιο[ν] Φαυστεῖν[ον] νεικήσαντα παί[δων]
[π]ανκράτιον Σ[μίν]-[θ]εια Παύλεια ἰσ[οπύ]- [θια]: Özhan
2015, 183–185.
[134] Özhan 2015, 181.
Vereinzelte Funde
belegen Isis und Serapis: Özhan 2015, 182 f.; Lenger
2009b, 218 f.; Wescoat 2012, 7. Unbekannt ist die
Zuweisung des Agoratempels aus römischer Zeit und ob es
hier einen Vorgängerbau gab: Arslan – Rheidt 2013, 216
f. Zahlreiche Felsnischen im Süden der Stadt dienten
kultischen Handlungen: Mohr – Rheidt 2016, 140 f.
[135] Die
Identifizierung des Tempels als Athenaheiligtum erfolgte
indirekt über die zahlreichen Darstellungen und
Nennungen im numismatischen, inschriftlichen und
figürlichen Befund in Assos. Im Tempel selbst fanden
sich keine Hinweise auf Athena. Aufgrund der
Gesamtfundlage ist diese Zuweisung aber
höchstwahrscheinlich: Lenger 2009b, 218 f.; Wescoat
2012, 7. Finster-Hotz sieht weiterhin in der Darstellung
des Herakles auf den Metopen und Reliefs des Tempels
einen Beleg für diese Zuweisung, tritt Athena doch
mythologisch als Helferin des Herakles auf: Finster-Hotz
1984, 25. 41–45. 74–78. Auch die Lage ihres Tempels auf
der Akropolis ist für Athena in ihrer Funktion als
Polias, Stadtbeschützerin, häufig: Graf 1997, 160–166.
[136] Pillot 2020,
674–678.
[137] Graf 1997,
160–166.
[138] Riedel 2016, 68.
[139] Bellinger 1961,
14;
CN Type 20482.
[140] Riedel 2016, 70
f.
[141] Mittag 2016,
60–62.
[142]
Riedel 2016, 70 f.
[143]
»[…] We swear by Zeus Soter and the deity Caesar
Augustus, and by the pure Virgin (Athena) whom our
fathers worshipped, that we will be faithful to Gaius
Caesar Augustus and his house […]«: Clarke 1882, 134 f.;
Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 39 f.; »The Priestess
of Athena Polias, and keeper of her temple«: Wescoat
2012, 7.
[144] Lediglich
Pausanias beschreibt das Kultbild der Athena im
Parthenon von Athen mit »[…]beiderseits an dem Helm aber
sind Greifen angebracht«, womit er eine statuarische
Darstellung beschreibt, aber keine mythologische
Erklärung dieser Verbindung gibt: Paus. 1,24,5.
[145] SNG Aulock 6,
2131 f.
[146] SNG Türkei 9,
761;
CN Type 5366.
[147] SNG
Tübingen 4, 2382;
CN Type 12653.
[148]
Hoover 2014, 469. 473 f.; Mittag 2016, 138.
201. Zudem sei die Bronzestatue der Athena aus dem
Piräus genannt, die 375–350 v. Chr. datiert. Sie trägt
ebenfalls zu beiden Seiten ihres Helmes Greifen:
Demargne 1984, 980 f. Nr. 254 (Piräus,
Archäologisches Museum, MΠ
4646).
[149] Hoover 2014, 85
f.
[150] Hoover 2018,
338. 342. 391 f.
[151] Wenngleich
hiermit das westliche Kleinasien verlassen wird, sei an
dieser Stelle darauf verwiesen, dass in der attischen
und unteritalischen Vasenmalerei verschiedene
Darstellungen des Greifen mit Athena durchaus gängig
sind. So erscheint der Greif in archaischer und
klassischer Zeit auf dem Schild der Athena, etwa auf
einer attischen Preisamphore in Neapel, die 500–450 v.
Chr. datiert (Bentz 1998, 48–50. Taf. 71; Neapel, Museo
Archeologico Nazionale, H2764), einer ca. 500–450 v.
Chr. geschaffenen Pelike in Rom (Mingazzi 1971, Taf.
129; Rom, Museo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia, 50441) und einem Kolonettenkrater in
Rom, der ca. 500–450 v. Chr. datiert (Beazley 1971, 349;
Rom, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,
984). Eine Amphora in Basel, die 490–480 v.
Chr. datiert, zeigt den Greifen auf dem Schild im
Wechsel mit Löwen, Pferd und Ziege (Demargne 1984,
974 f. Nr. 182; Basel, Antikenmuseum und Sammlung
Ludwig, KA418). Die Athena auf der Scherbe einer
attischen Preisamphore in Athen, die ca. 530 v. chr.
datiert, trägt auf ihrem Kopf eine Stephane mit
Greifenprotome (Ridgway 1990, 602 f.; Athen, Akropolis
Museum, 923). Auf einer Oinochoe (Abb. 30) in der
Sammlung des Archäologischen Museums in Tarent, die in
die Mitte des 4. Jh. v. Chr. datiert, findet sich die
Darstellung einer Athena, die auf einem Greifen reitet
(Demargne 1984, 961 Nr. 38; Tarent, Museo
Archeologico Nazionale, Inv. Nr. 214005).
[152] Lenger 2009b,
218.
[153] Tanriöver 2014,
174.
[154] Boardman 1967,
25–28.
[155] Finster-Hotz
1984, 93. Serdaroğlu sah in dem gefundenen Vorderbein
eines Akroters den Beleg für einen Greifen. Die Sphingen
des Tempels sind allerdings bis auf den Kopf ganz
ähnlich gestaltet, so dass dieses Bein genauso zu einer
Sphinx gehören könnte: Lenger 2009b, 218 f. In
unterschiedlichen Tempelrekonstruktionen werden die
Akrotere trotzdem häufig als Greifen dargestellt (vgl.
Abb. 25): Rekonstruktion nach J. T. Clarke:
Clarke u. a. 1902, 145; Rekonstruktion nach F. Sartiaux:
Wescoat 2012, 14.
[156] Schwertheim
1997, 112; Arslan – Rheidt 2013, 195. 210.
[157] Winter 1903,
Taf. 54; Riedel 2016, 34 f.
[158] Lebrun 1982, 124
f.
[159] Barnett 1974,
894.
[160] Payne 2019, 242.
[161] Goldman 1960,
327 f.
[162] Lebrun 1982, 124
f.
[163] Für zukünftige
Forschungen zu diesem Thema sollte die übliche
Verbindung vom Greifen zu Apollon nicht außer Acht
gelassen werden. Ebenso ist die Möglichkeit denkbar,
dass der Greif als eigenständiges Bild für sich
gestanden hat, ohne dabei eine näher ausgestaltete
Verbindung zu einer bestimmten Gottheit zu haben.
Bildnachweise
Abb. 1, 6: Corpus Nummorum; Abb. 2:
Classical Numismatic Group LLC.,
cngcoins.com; Abb. 3–5, 9–14, 16–17, 19, 26, 29:
Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin (Fotos: Bernhard
Weisser); Abb. 15, 28: Münzkabinett der Staatlichen Museen zu
Berlin (Fotos: Lübke & Wiedemann); Abb. 7: Leu Numismatik AG
Winterthur (CH); Abb. 8, 18 sowie 22–24: Assos-Grabung
(Münzfotos B. Weisser); Abb. 17: Reproduktion nach Winter 1903;
Abb. 20–21: Nomos AG Zürich (CH); Abb. 25: Reproduktion nach
Clarke u.a. 1902.
Für die Überlassung der Abbildungen
22, 23 und 24 danke ich herzlich Herrn Prof. Nurettin Arslan
(Çanakkale Onsekiz Mart Universität) von der Assos-Ausgrabung.
Die Verwendung der Abb. 30 erfolgt mit Genehmigung des Museo
Archeologico Nazionale in Tarent.