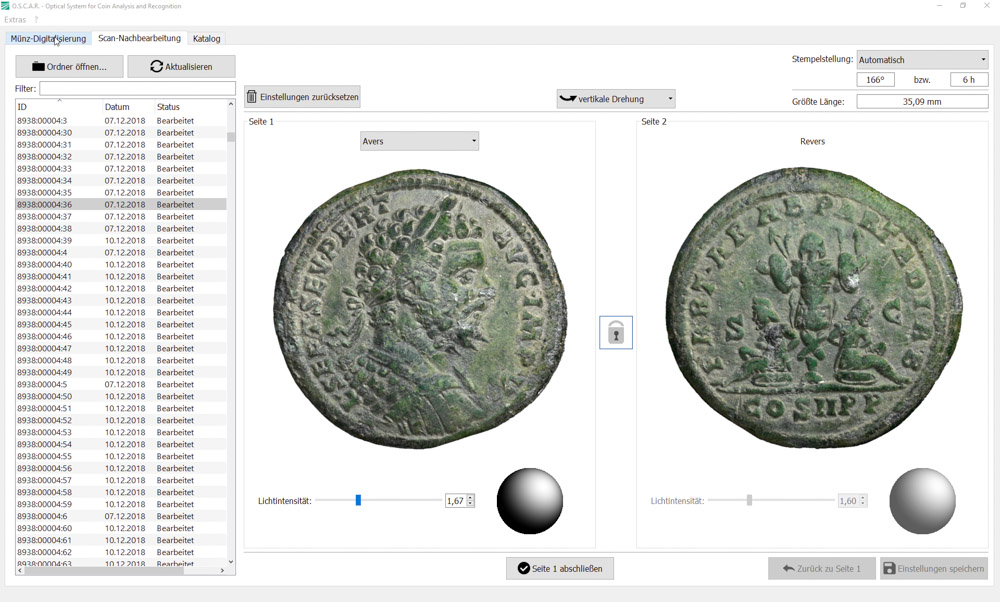Identifizierung von Münzen anhand eines digitalen Fingerabdrucks
Zusammenfassung: Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie - Landesmuseum für Vorgeschichte - Sachsen-Anhalt hat in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg ein innovatives Verfahren entwickelt, mit dem einzelne Münzen anhand eines individuellen »digitalen Fingerabdrucks« eindeutig und unverwechselbar beschrieben und identifiziert werden können. Dieses »Optical System for Coin Analysis and Recognition«, kurz O.S.C.A.R., ist ein optisches Datenerfassungssystem mit Softwareanalyseverfahren und basiert auf der photometrischen Stereoanalyse. Messdaten zur Objektgeometrie, Farbigkeit und Oberflächenstruktur einer Münze werden dabei genutzt, um einen individuellen Erkennungsschlüssel zu generieren, der bei einer Suchabfrage mit der Datenbank abgeglichen wird.
Schlagwörter: Digitalisierung; Fundmünzen; »Optical System for Coin Analysis and Recognition«
Abstract: The Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie - Landesmuseum für Vorgeschichte - Sachsen-Anhalt has developed an innovative process in cooperation with the Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg, with which coins can be described and identified unmistakably by an individual »digital fingerprint«. This »Optical System for Coin Analysis and Recognition«, O.S.C.A.R., is an optical data acquisition system with software analysis techniques based on photometric stereo analysis. Measurement data on the object geometry, color and surface structure of a coin are used to generate an individual recognition key, which is matched to the database during a search query.
Key Words: Digitization; found coins; »Optical System for Coin Analysis and Recognition«
Bereits seit Sommer 2017 werden die Fundmünzen im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale (http://www.lda-lsa.de/; https://www.landesmuseum-vorgeschichte.de/) nun systematisch neu erfasst und digitalisiert. Den Auftakt dazu bildete eine Sondervereinbarung der Staatskanzlei und dem Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Im Rahmen des Projektes mit dem Titel »Digital Heritage 2017/2018« wurden die Grundlagen geschaffen, neben zentralen Beständen aus Archiven und Sammlungen auch die Fundmünzen strukturiert neu zu erschließen und in zeitgemäßer Form digital zu sichern, um so eine Nutzung nicht nur intern, sondern auch durch externe Wissenschaftler und die Öffentlichkeit zu ermöglichen.
Ausgangssituation
Der Fundmünzbestand des Landesamtes für
Denkmalpflege und Archäologie beläuft sich derzeit auf insgesamt
etwa 25.000 Exemplare aller Zeitstufen, von der Antike bis zur
Neuzeit, und wächst durch Ausgrabungen, Prospektionen und
ehrenamtlich Beauftragte stetig. Bis dato lag
die Dokumentation der Fundmünzen zum größten Teil in Form von
Aufzeichnungen auf Papier vor. Darunter sind vor
allem umfangreiche Bestandslisten aus den 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts. Noch mit der Schreibmaschine getippt
verzeichnen diese Listen alle Münzen zu einem Fund mit einer
groben Einordnung der jeweiligen Münztypen und einem zugehörigen
Bild. Jedoch waren zum Zeitpunkt dieser Gesamtinventur
Teilbestände bereits nicht mehr ihrem einstigen Fundort
zuzuordnen und wurden in der sogenannten Vergleichssammlung
zusammengefasst. Vor allem die Dokumentation des Altbestandes,
der zwei Kriege zu überstehen hatte und zahlreichen
strukturellen Veränderungen unterlag, ist unvollständig. Einige
Münzen sind, wenn überhaupt, nur noch mit hohem Rechercheaufwand
ihrem einstigen Fundkontext zuzuordnen, bei anderen kam es über
die Jahre zu Verwechslungen, die nur schwer aufzuklären sind. So
etwa beim Fundplatz Piesdorf im Salzlandkreis, wo verschiedene
Münzfunde zu Tage kamen, die aufgrund der heute nur noch
unvollständig vorliegenden Dokumentation kaum mehr zu
unterscheiden sind. Zudem finden sich Abweichungen zwischen den
Unterlagen der ersten Funddokumentation, die den Fundortsakten
des Hausarchivs zu entnehmen sind, der Registrierung beim
eigentlichen Fundeingang und den Unterlagen der oft deutlich
später erfolgten Fundbearbeitung, wobei auch nicht der komplette
Bestand bearbeitet ist. Verschiedene
Nummernsysteme zur Individualisierung der Einzelstücke fanden
hier nebeneinander Verwendung und so wurde die Situation im
Laufe der Jahre und mit wechselnden Bearbeitern zunehmend
unüberschaubarer. Um die vorhandenen Informationen nun zu
sichern und digital zusammenzuführen, war eine neue
systematische Erschließung der Bestände dringend nötig.
Zur Erfassung der Metadaten jeder einzelnen
Münze wird nun das virtuelle Münzkabinett KENOM (»Kooperative
Erschließung und Nutzung der Objektdaten von Münzsammlungen«;
https://www.kenom.de/institutionen/isil_DE-MUS-805310/)
genutzt, da es sich hier um eine Datenbank handelt, die speziell
auf die Erfassung numismatischer Objekte ausgerichtet ist. KENOM
bildet nicht nur den Rahmen unsere Münzbestände wissenschaftlich
qualifiziert und mit Hilfe von Normdaten neu zu erschließen,
sondern bietet auch die Möglichkeit unsere Daten auf einer
Plattform für Forschung, Lehre und Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Da es für die Erfassung der Fundmünzen von besonderer
Bedeutung ist, auch die Informationen zum Fundort und damit zum
archäologischen Kontext aufzunehmen, bietet KENOM die
Möglichkeit zum Münzfundkatalog der Numismatischen Kommission
der Länder zu verlinken (https://kenom.gbv.de/fundkomplex/).
Um auch bei der Organisation und
Strukturierung der Sammlung eine deutliche Verbesserung der
Situation zu erzielen und für die Zukunft einen adäquaten
Workflow zu integrieren, wurde in den vergangenen Jahren bereits
begonnen, die oft in Konvoluten zusammengefassten Münzen zu
vereinzeln und jedes Stück mit einem individuellen Barcode bzw.
QR-Code zu versehen, mit dem dann wiederum die numismatischen
Informationen zum Stück verknüpft sind. Um bei Entnahmen aus dem
Depot die Verwechslungsgefahr und den damit einhergehenden
Informationsverlust auszuschließen, da Münzen die klassische
Kennzeichnung direkt am Objekt nicht zulassen und ein gewisses
Verwechslungsrisiko bleibt, wurde nach einer technischen
Möglichkeit einer Individualisierung der Stücke gesucht.
In Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut
für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg (https://www.iff.fraunhofer.de/)
konnte dann ein innovatives Verfahren entwickelt werden, mit dem
einzelne Münzen, basierend auf etwa 1.000 optischen Merkmalen,
die einen Erkennungsschlüssel, quasi einen »digitalen
Fingerabdruck« der Münze bilden, eindeutig und unverwechselbar
beschrieben und identifiziert werden können. Dabei handelt es
sich um charakteristische Prägemerkmale und individuelle
Beschädigungen, wie Kratzer, Dellen, Risse, Ausbrüche aber auch
Korrosion, die so auch dokumentiert werden. Dies ist nicht nur
für die Organisation innerhalb der Sammlung essentiell, sondern
auch im Leihverkehr mit anderen Museen von besonderer
Wichtigkeit.
Erfassung mit O.S.C.A.R.
Mit dem »Optical System for Coin Analysis
and Recognition«, kurz O.S.C.A.R., können Gold-, Silber-,
Bronze- und Kupfermünzen mit einem Durchmesser von fünf bis 75
Millimeter digital erfasst werden.
Dabei beruht die Erfassung der Münzen auf
einem Verfahren, welches im Deutschen »photometrisches Stereo«
oder »photometrische Stereoanalyse« genannt wird. Dieses
Verfahren geht auf eine Arbeit von Robert J.
Woodham aus dem Jahr 1980[1]
zurück. Die Grundidee kann nachvollzogen werden, wenn man
einen matten hellgrauen Würfel in einem Raum mit nur einer
Lichtquelle betrachtet. Eine der drei sichtbaren Seiten
erscheint heller, da sie der Lichtquelle mehr zugewandt ist als
die anderen. Dieser Effekt wird genutzt, um die Orientierung von
Oberflächen bezüglich mehrerer Lichtquellen zu analysieren. Die
Kamera, Lichtquellen und das Objekt sind dabei fest installiert.
Das Objekt wird nacheinander von den Lichtquellen aus
verschiedenen Richtungen beleuchtet und aufgenommen. So kann für
jeden Bildpunkt bestimmt werden, bei welcher Beleuchtung er am
hellsten erscheint und entsprechend auch festgestellt werden,
welcher Objektpunkt der Lichtquelle am meisten zugewandt ist.
Dieses Verfahren ermöglicht es, visuelle Effekte der
Oberflächentopographie und der Materialfarbe zu trennen. Auf
Basis dieser Daten können dann verschiedene
Beleuchtungssituationen für die Analyse einer Münze simuliert
werden[2].
Das zur digitalen Erfassung der Münzen
speziell angefertigte Gerät besteht aus einer hochauflösenden
Kamera, die im Zenit einer Kuppel platziert wurde, in deren
Innerem 36 LEDs angebracht sind, siehe Abb. 1. Um den
Auflagebereich für die Münze sind Farbkeile, Referenzbohrungen
und zwei schwarze Keramikkugeln angebracht. Die
Referenzbohrungen dienen als Maßstabsverkörperungen, und über
Reflexionen in den Keramikkugeln können die Positionen der 36
LEDs in Bezug auf die Kamera ermittelt werden. Damit enthält
jede Aufnahmeserie die vollständigen Kalibrierinformationen,
obwohl die Aufnahmebedingungen unter normalen Umständen konstant
sind.

Abb. 1: O.S.C.A.R.
Nach dem Einlegen der Münze und dem
Schließen der Kuppel wird der Aufnahmeprozess über einen
Knopfdruck in der Software gestartet. Für jede Lichtquelle
werden mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen
Belichtungszeiten angefertigt, um die
Lichtintensitätsunterschiede in einem größeren
Dynamikbereich zu erfassen. Zusätzlich wird die Münze bei
spezieller Beleuchtung mit einer zweiten Kamera von unten
aufgenommen. Dies ermöglicht eine genaue Erfassung der
Kontur und das spätere automatische Freistellen. Aus den
zahlreichen Bildern berechnet die Software für jeden
Bildpunkt die Normalenrichtung und RGB-Farbwerte, die mit
den Farbkeilen abgeglichen wurden, siehe Abb. 2-5.
Für die Digitalisierung der anderen Münzseite muss die Münze
von Hand gewendet werden.




Abb. 2-5: Die Bilder zeigend die RGB-Farbwerte (oben) und die Oberflächenstruktur (unten) der Münze © LDA Sachsen-Anhalt
Nach der Datenerfassung, Verarbeitung
und Speicherung kann ein Abgleich mit der systeminternen
Datenbank vorgenommen werden, um zu verifizieren, um welches
Stück es sich handelt. Für die eindeutige Identifikation
einer Münze wird als erstes die Kontur herangezogen. Durch
den Vergleich einfacher skalarer Merkmale, wie etwa
Durchmesser, Abweichungen von der Kreisform, Rissen
und Ausbrüchen, kann die Menge ähnlicher Münzen
bereits stark eingeschränkt werden. Bei vielen antiken und
mittelalterlichen Münzen ist der Konturverlauf einzigartig
und von dem anderer Münzen gut unterscheidbar. Bei modernen
maschinell geprägten Münzen sind Unterschiede in den
Konturen zwischen Münzen gleichen Typs kaum messbar.
Im folgenden Schritt der Identifikation
werden Topographie (Normalen) und Farbinformation zu einem
synthetischen Grauwertbild kombiniert und in verschiedenen
Auflösungsstufen skaleninvariante Merkmale bestimmt. Das
sind einzelne Bildpunkte, in deren Umgebung die Grauwerte
charakteristisch verteilt sind. Diese Art von Merkmalen
werden auch dazu genutzt, in überlappenden Bildern
korrespondierende Punkte zu finden, um beispielsweise
Panoramabilder zu erzeugen. Die Merkmale zweier Münzseiten
werden dann in einem mehrstufigen Prozess miteinander
verglichen. Begonnen wird mit der geringsten Auflösung.
Zuerst werden potentiell korrespondierende Merkmalspunkte
anhand der Grauwertmerkmale bestimmt. Wenn hinreichend viele
solche Paare gefunden wurden, wird geprüft, ob diese Punkte
zur Deckung gebracht werden können, wobei einzelne Ausreißer
entfernt werden. Scheitert dieser Prozess, so wird
angenommen, dass die Münzseiten verschieden sind, es sich
also nicht um dieselbe Münze handelt. Wird jedoch die
höchste Auflösungsstufe erreicht, so dient der Anteil der
Punktpaare aus dem Merkmalsvergleich, die zur Deckung
gebracht werden konnten, als ein Maß für die Ähnlichkeit.
Stimmen über 98 Prozent der Merkmale überein, kann die
Identifizierung des Stücks als sicher gelten. Dieses
Verfahren wurde in umfangreichen Stichproben anhand des
aktuellen Datenbestands erfolgreich getestet.
In einem zusätzlich entwickelten
Bearbeitungs-Tool können die automatisiert entstandenen
Bilder der Vorder- und Rückseiten, die aus dem Prozess der
Individualisierung ohne größeren Aufwand errechnet werden,
auch nachbearbeitet werden, siehe Abb. 6. Dabei wird
die Münze bereits im Prozess der Bilderzeugung direkt
freigestellt. Sollten Vorder- und Rückseite vom
Digitalisierer vertauscht oder das Motiv nicht korrekt
ausgerichtet worden sein, sind Avers und Revers ebenso
anpassbar, wie die Drehung der Münze. Ferner errechnet das
Programm auf Basis der Münzkontur automatisch den
Durchmesser und die Stempelstellung, die dann abgelesen
werden können. Indem die Drehung um die vertikale bzw.
horizontale Achse einstellbar ist, besteht die Möglichkeit
zwischen Kehr- und Wendeprägung zu unterscheiden.
Voraussetzung für die automatische Erkennung der
Stempelstellung ist allerdings, dass ausreichend viele
Merkmale zur Beschreibung der Kontur vorhanden sind und
beide Münzseiten dem Motiv entsprechend auf die 12
Uhr-Position gedreht wurden. Ist der Münzrand
besonders regelmäßig, wie es bei maschinellen Prägungen
zumeist der Fall ist, kann die Verdrehung von Vorder- und
Rückseite zueinander technisch nicht festgestellt werden, da
hier ausschließlich die Kontur abgeglichen wird.
Die mit den unterschiedlichen
Beleuchtungspositionen und -intensitäten erzeugten Bilder
erlauben es zusätzlich bei der Betrachtung in einem
speziellen Viewer, nicht nur die Stärke, sondern auch die
Position der Lichtquelle virtuell zu verändern und über die
Münzoberfläche zu bewegen, siehe
Video. Ähnlich dem
Drehen der Münze durch das Sonnenlicht oder der
Streiflichtmethode, kann die Oberflächenstruktur so genauer
betrachtet werden, womit sich, besonders für die häufig
korrodierten Fundmünzen, die Möglichkeit einer genaueren
Typenbestimmung ergibt. Die Belichtung der standardisiert
aufgenommenen Bilder kann individuell angepasst werden, je
nach Reflexionseigenschaften des Münzmaterials. Das fertige
bearbeitete Bild wird dann im TIF-Format abgespeichert und
über KENOM mit den historischen und technischen Daten zur
Münze verknüpft, siehe Abb. 7-8.


Fazit
Im Vordergrund stand für das Landesamt
für Denkmalpflege und Archäologie die Entwicklung eines
Instruments zur individuellen Erfassung jeder einzelnen
Münze und somit die Möglichkeit zu verifizieren, ob, etwa im
Falle von Leihgaben, Standortveränderungen im Depot oder
sonstigen Entnahmen, auch die richtige Münze zweifelsfrei
ihrer Inventarnummer zugeordnet werden kann. Diese
Zielsetzung konnte vollumfänglich erreicht und durch
zusätzliche Entwicklungen, wie die Erfassung von Durchmesser
und Stempelstellung, die Erzeugung freigestellter
standardisierter Bilder und die virtuelle
Belichtungssteuerung, noch übertroffen werden.
Seit Inbetriebnahme von O.S.C.A.R., im
Sommer 2018, konnten bereits über 12.000 Münzen
individuell erfasst und in der systeminternen
Vergleichsdatenbank gespeichert werden. Der Durchsatz
beträgt etwa 10 Münzen pro Stunde. Durch die automatisierte
Digitalisierung konnte die Dokumentation der Bestände, im
Gegensatz zur digitalen Fotografie und Nachbearbeitung in
einem Bildbearbeitungsprogramm, nicht nur entscheidend
beschleunigt, sondern auch die eindeutige Zuordenbarkeit
einer Münze sichergestellt werden. Zudem ermöglicht
O.S.C.A.R. eine bisher einzigartige Normierung der
Bilderfassung.
Die Kooperation mit dem
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung
(IFF) wird auch weiterhin fortgeführt und die beschriebene
Individualisierungssoftware laufend verbessert. Aktuell
prüfen wir zudem, welche Informationen sich aus den bereits
erfassten Münzdaten zusätzlich ableiten lassen, um
beispielsweise Ähnlichkeiten zu erkennen oder
Klassifizierungen vornehmen zu können. Gegenwärtig endet das
Identifizierungsverfahren damit, markante Merkmale in den
Bildern zu jeder Münze individuell zu definieren und
wiederzuerkennen. Perspektivisch könnten diese Merkmale
genutzt werden, um etwa bestimmte Münztypen mit ähnlichen
Charakteristika zu identifizieren. Dafür müsste die Software
zwischen Prägemerkmalen und individuellen Beschädigungen
unterscheiden und spezifische Muster registrieren. Wir sehen
hier großes Entwicklungspotential mit technischen
Assistenzen die inhaltliche Erschließung von Münzen
zu unterstützen und zu erleichtern. Die Grundlagen dafür
sind bereits geschaffen.
Die Dokumentation des Münzreliefs durch
unterschiedliche Beleuchtungspositionen und -intensitäten
bietet die Möglichkeit einer interaktiven Analyse und
Auswertung von Prägemerkmalen. Diese Methode
erlaubt es Details hervorzuheben, die auf einfachen
Fotografien kaum sichtbar sind, und wird bereits zur
Untersuchung beispielsweise von Felsbildern oder Inschriften
angewendet. Durch O.S.C.A.R. ist sie nun auch in größerem
Rahmen speziell auf Münzen anwendbar. Um die Visualisierung
der Münzdaten mit variabler Beleuchtungsanpassung auch
unabhängig von der Bediensoftware öffentlich nutzen zu
können, soll eine Webanwendung entwickelt werden, die eine
Integration in einen Webbrowser ermöglicht. Dies würde auch
den wissenschaftlichen Austausch durch detailliertere
Darstellungsmöglichkeiten der Münzen erheblich vereinfachen.
In ähnlicher Form stellt bereits das Museo Palazzo Blue in
Pisa Teile seine Münzbestände vor (http://vcg.isti.cnr.it/PalazzoBlu/).
Weitere Informationen finden sich auch
unter:
https://www.lda-lsa.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/pressearchiv/2018/
(Pressemitteilung vom 03.12.2018)
https://www.iff.fraunhofer.de/de/presse/2019/gesichtserkennung-fuer-muenzen.html
https://muenzenwoche.de/digitalisierte-gesichtserkennung-fuer-muenzen/
https://www.mdr.de/wissen/digitaler-fingerabdruck-muenzen-100.html
[1] R. J.
Woodham, Photometric method for determining surface
orientation from multiple images, Optical Engineerings
19, I, 1980, 139–144. (https://www.researchgate.net/publication/242557620_Photometric_Method_for_Determining_Surface_Orientation_from_Multiple_Images)
[2] »Reflectance
Transformation Imaging« (RTI), auch »Polynomial
Texture Mapping« genannt, nutzt das gleiche
Aufnahmeschema mit fester Kamera-Objekt-Beziehung und
Variation der Position der Lichtquelle. RTI schätzt die
Leuchtkraft eines jeden Pixels als Polynom zweiten
Grades der Komponenten der Beleuchtungsrichtung. Das
»photometrische Stereo« bestimmt im Gegensatz dazu die
Richtung der Oberfläche für jeden Pixel.