
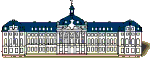
 |
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
|
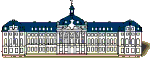 |
| Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin Albert-Schweitzer-Str. 33 48149 Münster Direktor: Univ.- Prof. Dr. H. Van Aken |
Tel. (0251) 83- 47252 / 53 /58
Fax: (0251) 88704 e-mail: anaest@anit.uni-muenster.de www: http://medweb.uni-muenster.de/institute/anaest |
|
|
|
||||
|
|
Forschungsschwerpunkte 2001 - 2002 Fachbereich 05 - Medizinische Fakultät |
|||
|
Experimentelle Intensivmedizin - Multiorganversagen
Sepsis und Lungenversagen zählen zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung eines
Multiorganversagens, dessen Pathomechanismus nach vielen Jahren intensiver Forschung noch immer nicht als
geklärt gelten kann. Es existieren zahlreiche Modelle des Lungenversagens und der Sepsis, einer
Infektions- bedingten systemischen Entzündungsreaktion. Berichte über
Organveränderungen im Sinne eines Multiorganversagens durch Induktion einer Sepsis oder eines
Lungenversagens liegen dagegen nicht vor. Es ist daher naheliegend, im klinischen Szenario nach
Gemeinsamkeiten dieser beiden Krankheitsbilder zu suchen, die für die Entstehung eines
Multiorganversagens von Bedeutung sein könnten. Eine solche Gemeinsamkeit ist das besonders hohe
Risiko der beiden Patientenkollektive, im Krankheitsverlauf eine Hypovolämie zu entwickeln, die
aufgrund einer Vasokonstriktortherapie unerkannt bleibt, d.h. maskiert wird.
Zunächst wurde ein tierexperimentelles "Doppel-"Hit"-Modell (Vasokonstriktor-maskierte
Hypovolämie und Endotoxin) des Multiorganversagens etabliert. Repetitive Endotoxinämie, die
eine Sepsis imitiert, führte zu keinen Organschäden. Auf dem Boden einer ausgeprägten
Katecholamin-maskierten Hypovolämie (KMH) entwickelten die Schafe jedoch ein Versagen des
kardiovaskulären Systems und der Nieren, während alleinige KMH lediglich in einer moderaten
Einschränkung der Nierenfunktion resultierte.
In einer zweiten Studie konnte in einem neuen
Modell eines schweren Permeabilitäts-Lungenödems gezeigt werden, dass hohe
Volumensubstitution unter selektiver pulmonaler Vasodilatation mittels NO zu keiner Zunahme des
Lungenwassers im Vergleich zu einer mit wenig Flüssigkeit therapierten Gruppe, die kein NO erhielt,
führte. Bei hoher Volumensubstitution ohne NO-Gabe war das Lungenödem
erwartungsgemäß signifikant stärker. Volumengabe unter gleichzeitiger Senkung des
Pulmonalisdruckes könnte daher eine Therapieoption bei Katecholamin-maskierter Hypovolämie
und Lungenödem sein, wenn Multiorgandysfunktion droht.
Beteiligte Wissenschaftler: Veröffentlichungen: |
||||